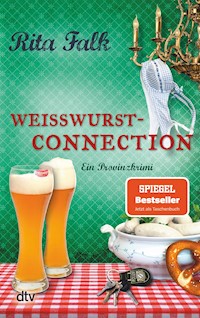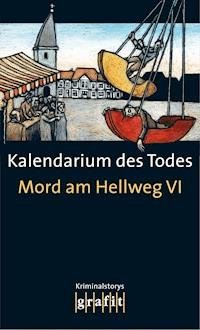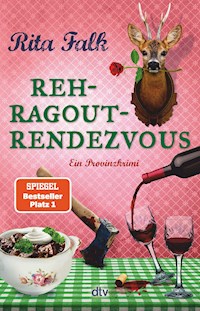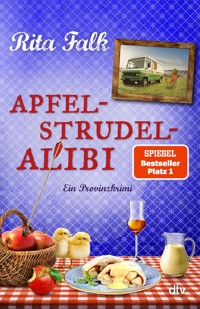9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Franz Eberhofer
- Sprache: Deutsch
Es ist angerichtet - Der dritte Fall für den Eberhofer Franz! Ein blutiger Schweinskopf im Bett von Richter Moratschek führt Franz Eberhofer auf die Spur eines gefährlichen Psychopathen. Hannibal Lecter ist ein Dreck gegen Dr. Küstner, der in Niederkaltenkirchen sein Unwesen treibt. »Ekelhafte Sache, das mit dem Schweinskopf im Bett vom Richter Moratschek. "Es ist der Pate", sagt der Moratschek und erschreckt mich zu Tode. "Welcher Pate?", frag ich den Moratschek. "Na, der vom Fernsehen halt. Der mit dem Corleone, dem Marlon Brando, wissen`S schon." "Das war aber ein Pferdekopf." "Pferdekopf … Schweinskopf … was spielt denn das für eine Rolle. Jedenfalls ist es grauenvoll." "Besonders für die Sau."« Auszug aus ›Schweinskopf al dente‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über das Buch
Anruf von der PI Landshut beim Eberhofer Franz: Dr. Küstner, zu fünfzehn Jahren Haft wegen Mordes verurteilt, ist aus dem Gefängnis entflohen und muss rasch wieder eingesammelt werden. Doch obwohl der Franz dem Küstner quasi schon auf der Spur ist, geschehen merkwürdige Dinge in Niederkaltenkirchen: Das halbe Dorf wird nach dem Verzehr von Omas Rotweinkuchen ins Krankenhaus eingeliefert, Termiten belagern das Büro vom Franz, und wer ist bitte dieser »Cousin«, mit dem die Gattin des Richters in Bad Wörishofen gesehen wurde? Währenddessen läuft Dr. Küstner noch immer frei herum …
Rita Falk
Schweinskopf al dente
Ein Provinzkrimi
Kapitel 1
So ein Stern kommt gut, ganz klar. Natürlich nur, wenn er in Silber ist. Nein, Gold kommt noch besser. Hab ich aber nicht. Was ich hab, ist Silber. Seit gestern. Seit gestern hab ich einen einzigen silbernen Stern auf jedem meiner Schulterstücke. Und ein silbernes Mützenband.
Einwandfreie Sache.
Ein silberner Stern ist tausendmal besser als vier grüne. Und so einen silbernen hab ich jetzt. Dank der Beamtenreform. Da ist ihnen einmal wirklich was Gutes eingefallen, den Herren Gschaftel und Huber, wo die wunderbaren Reformen machen. Normal fällt ihnen ja eher nix Gescheites ein. Eher so was wie Einfrierung der Gehälter oder Streichung des Urlaubsgeldes. Aber diesmal – astreine Sache.
Ich steh so vorm Spiegel und bin ziemlich zufrieden. Erstklassiger Stern. In Silber. Wobei man sagen muss: Wenn das Licht aus der Dielenlampe drauf fällt, glänzt er ganz leicht golden. Aber nur ganz leicht. Was freilich wurst ist, weil: er schaut auch so gut aus. Reißt die miese erbsengrüne bayerische Uniform unglaublich raus. Wir hier unten in Bayern müssen halt aus wirtschaftlichen Gründen immer noch diese kackefarbenen Fetzen auftragen. Nicht etwa so, wie die anderen Kollegen bundesweit, die in elegantem Blau auf Verbrecherjagd gehen. Nein. Wir machen das in Kacke. Was freilich dann schon auch wieder vernünftig ist. Ja, wirklich. Wir halten eben unser Geld noch zusammen, gell. Und hauen’s nicht für personifizierte Eitelkeiten auf den Kopf. Wir fangen unsere Gangster auch in Kacke, keine Frage. Ja, und das Silber ist halt jetzt eine großartige Aufwertung. Und es bedeutet Kommissar. Kommissar Eberhofer. Das hat schon was. Anders als Hauptmeister Eberhofer. Ganz anders.
Dann klopft die Oma ans Fenster.
»Das Frühstück ist fertig, Bub«, schreit sie, dass man sie gut noch im Nachbardorf hören kann. Sie ist halt schon taub, und manchmal vergisst sie wirklich, dass nicht die komplette Menschheit ihr Schicksal teilt. Ich mach das Fenster auf und steck mir die Finger in die Ohren.
»Mei, war ich vielleicht recht laut?«, fragt sie jetzt ein paar Dezibel drunter.
Ich nicke. Dann mach ich das Fenster wieder zu und geh in den Hof hinaus. Mitsamt meiner Uniform. Mal schauen, was sie sagt.
Sie sagt überhaupt nichts. Sie schaut mich noch nicht einmal an. Sie wandert einfach an meiner Seite durch den Hof, so, als wär alles genauso wie sonst. Ist es aber nicht. Schließlich bin ich jetzt ein Kommissar, und das ist gut sichtbar. Sehr gut sogar. Selbst für die Oma, weil: ihre Augen sind ja noch einwandfrei. Ich geh ziemlich langsam. Das muss sie doch merken. Tut sie aber nicht. Sie geht einfach nur genauso langsam.
Unglaublich.
Wie wir in die Küche kommen, sitzt der Papa schon am Frühstückstisch und liest seine Zeitung. Er quetscht sich ein »Morgen« über die Lippen und schaut noch nicht einmal auf. Aber gut, da hab ich sowieso nichts anderes erwartet. Wenn es nämlich im Leben vom Papa außer den Beatles, Joints und Sauen noch irgendwas anderes gibt, was ihn interessiert, dann ist es die Samstagszeitung. Weil die halt quasi sein gesamtes Interessengebiet abdeckt. Komplett. Immer wieder mal ein netter Bericht über Paul McCartney, ständig was über Schweine auf der Landwirtschaftsseite und die Drogenszene kommt auch nicht zu kurz. Was will man mehr? Da ist die Beförderung des eigenen Sohnes doch wohl ein nasser Furz dagegen.
»Unglaublich«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Da hat wieder so ein Studierter, ein Herr Psychologe sogar, sein Weib brutal abgemurkst und streitet natürlich alles ab. Ein Gutachter soll jetzt zugezogen werden. Dass ich nicht lache! Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus«, sagt er, faltet die Zeitung und legt sie auf den Tisch. »Weißt du etwas über den Fall, Franz?«
»Nein, keine Ahnung. Schließlich bin ich nicht bayernweit aktiv«, sag ich und stehe noch immer ziemlich unschlüssig und zugegebenermaßen auch etwas angepisst herum. Da schaut mich endlich die Oma an. Sie ist grad im Begriff, sich hinzusetzen, und hat die Kaffeekanne in der Hand, wie sie mich eben jetzt anschaut.
»Himmel, Franz!«, schreit sie ganz begeistert und setzt sich nieder. »Du schaust ja wunderbar aus! Genau wie ein General!«
»Himmel Arsch!«, schreit dann der Papa und reißt seine Zeitung in die Höh. Weil die Oma vor lauter Hurra jetzt direkt den Kaffee verschüttet hat. Exakt über die wertvolle Lektüre von meinem Erzeuger. Er versucht, das Malheur in seiner Tasse zu versenken, indem er eine Rinne formt. Mit seiner geliebten Samstagszeitung. Ein Jammer.
Der Papa gibt auf. Legt das nasse Blatt beiseite und widmet mir endlich die Aufmerksamkeit, die mir auch zusteht.
»Höhöhö, alles in Silber. Kann das womöglich eine Beförderung sein?«
Ich nicke.
»›Kommissar‹ heißt das Silber. ›Kommissar Eberhofer‹, sozusagen.«
Dem Papa entweicht ein Grinserl. Ein stolzgeschwängertes, würd ich mal sagen. Er steht auf.
»Ja, dann gratulier ich dir recht herzlich, Kommissar Eberhofer«, sagt er, haut mir auf die Schulter und schüttelt mir dann die Hand.
Die Oma steht jetzt auch wieder auf, und nachdem sie die Pfütze vom Tisch gewischt hat, ist sie an der Reihe. Sie gratuliert mir ebenfalls, und ich krieg ein Bussi auf jede meiner Backen.
Dann gibt’s endlich das Frühstück.
Ah – alles vom Feinsten. Mit frischen Semmeln und weichen Eiern, einem mageren Frühstücksspeck, der selbstgemachten Marmelade von der Oma und einem erstklassigen Früchtequark, freilich auch aus eigener Herstellung.
Alles wäre jetzt perfekt gewesen, wenn nicht kurz drauf dem Leopold sein Auto in den Hof hineingequietscht wär. Und das mein ich wörtlich. Er rast in den Hof, dass der Kies nur so fliegt, und drückt dann auf die Bremse, bis die Beläge qualmen. Typisch.
Die Augen vom Papa sprühen Funken. Freudenfunken, versteht sich.
»Da schau einer an, jetzt kommt auch noch dein Bruder. Geh, Franz, tu ihm ein Gedeck aus dem Küchenkasten. Magst?«, sagt der Papa.
Nein, der Franz mag nicht. Tut es aber trotzdem. Zwengs Familienharmonie eben.
»Servus, miteinander«, sagt der Leopold, gleich wie er zur Tür reinkommt. »Ah, Frühstück. Ja, da komm ich wohl grad recht.«
So schnell kann man gar nicht schauen, da hockt er auch schon am Tisch.
»Da, schau her, Oma, was ich dir mitgebracht hab«, sagt er und legt ihr ein Kochbuch hin. Internationale Küche. Wahrscheinlich wieder so ein Ladenhüter aus seiner blöden Buchhandlung. »Damit du nicht immer den gleichen bayrischen Scheißdreck kochen musst, gell«, sagt er weiter.
Die Oma freut sich, weil sie ja den Schwachsinn nicht hört, den er absondert.
Ich reich ihm sein Geschirr.
»Ja, Franz, wie schaust denn du aus? … Wie ein Christbaum«, lacht er. »Nein, ehrlich, wie ein Christbaum.«
Das soll mich treffen. Tut es aber nicht. Weil es vom Leopold kommt. Und der Leopold ein Arschloch ist.
»Der Franz ist jetzt ein Kommissar«, sagt der Papa, um die Lage zu entschärfen.
»Sag bloß?«, sagt der Leopold und beißt in eine Marmeladensemmel. Es ist meine.
»Ja, sag einmal, geht’s noch«, fahr ich ihn an. »Schmier dir doch deine blöden Semmeln selber!«
»Du, was anderes«, sagt er dann zum Papa gewandt. Mich ignoriert er komplett.
Dann erfahren wir, dass er gestern in einem Reisebüro war, wegen den Urlaubsplänen für sich und seine Familie. Und, dass es ein Fiasko war. Ein Fiasko sondergleichen, sagt er. Die Angebote quasi unter aller Sau. Weil das eine zu teuer, das andere zu weit weg und das dritte ungeeignet für kleine Kinder. Also keine Möglichkeit, die sauer verdienten Moneten in ferne Länder zu tragen.
Aber heut Nacht, sagt der Leopold, heut Nacht, hatte er eine großartige Idee. Weil: heut Nacht ist ihm nämlich das perfekte Urlaubsparadies eingefallen, für sich und seine Lieben. Und das auch noch direkt vor der eigenen Haustür.
»Lass hören«, sagt der Papa ganz interessiert.
»Urlaub auf dem Bauernhof«, sagt der Leopold kauenderweise.
»Das klingt gut«, sagt der Papa weiter und schaut seinen Älteren aufmunternd an.
»Klingt gut?«, kaut der Leopold. »Das klingt phantastisch!«
Beide nicken.
Kommt da jetzt noch irgendwas, oder war das etwa schon das Highlight in seinem popeligen Leben? Ich setz mich wieder dazu, weil nur noch eine einzige Semmel im Korb liegt. Und die heißt es zu sichern, eh die gefräßige Verwandtschaft erbarmungslos zuschlägt.
»Und wohin soll’s gehen?«, will der Papa jetzt wissen.
Der Leopold strahlt ihn an, dass es eine wahre Freude ist.
»Ja, zu euch natürlich«, sagt er und schnappt sich die letzte Semmel.
»Nur über meine Leiche!«, schrei ich jetzt und reiß ihm die Semmel aus der Hand. Dann steh ich auf und geh. Dann kehr ich wieder um und nehm den ganzen Frühstücksspeck mit.
Schnurstracks hinaus, Tür zu und fertig.
Den Rest vom Wochenende verbring ich mit dem Ludwig in der freien Natur. Weil der nämlich aufgrund übermäßigen Frühstücksspeckkonsums einen Mordsdurchfall kriegt, was für Hund und Herrchen gleichermaßen ärgerlich ist.
Wie ich am Montag Früh in mein Büro fahr, hab ich selbstverständlich auch wieder die Uniform an. Obwohl ich das normal nie mache. Immer Zivilklamotten. Jeans und Lederjacke, und alles ist perfekt. Aber jetzt will man freilich auch mal zeigen, was man erreicht hat, auf seinem harten Weg nach oben. Drum eben Uniform.
Zuerst einmal hol ich mir einen Kaffee. Die drei Verwaltungsschnepfen ratschen grad fleißig, zwei davon sind über ein Handarbeitsheft gebeugt. Die dritte hat ein Strickzeug in der Hand und zählt Maschen. Ja, es ist schon ein Scheißstress in der Gemeindeverwaltung von Niederkaltenkirchen.
»Einen wunderschönen guten Morgen, Mädls«, sag ich so beim Reingehen und schlendere zur Kaffeemaschine.
»Ah, du weißt also schon Bescheid, Franz«, sagt dann das Strickzeug, und ich weiß nicht im Geringsten, wovon sie redet.
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, sag ich und schenk mir einen Kaffee ein.
»Ja, wegen deiner Uniform halt. Weil der Bürgermeister gesagt hat, er braucht dich heut unbedingt in Uniform.«
»So, so, hat er das gesagt.«
Sie nickt.
»Vielleicht schaust gleich einmal bei ihm im Büro vorbei«, sagt sie weiter und wendet ihren Blick von den Maschen auf die Uhr. »Er müsste eigentlich schon da sein.«
»Ja, wenn er schon da sein müsste, dann schauen wir halt einmal rüber, gell«, sag ich und bleib noch einen Augenblick an der Bürotür stehen. Aber nix. Kein Wort über mein Silber. Sie haben es nicht mal gemerkt, die blöden Weiber. Stattdessen starren sie begeistert auf die Gebrauchsanweisung ihrer Wollverwertung. Aber was will man da auch anderes erwarten? Von Verwaltungsangestellten. Seien wir doch einmal ehrlich, so arg viel Hirn brauchst jetzt da nicht für diesen Job. Und schon gar nicht bei uns in Niederkaltenkirchen.
Ich geh also rüber zum Bürgermeister, und da – eine völlig neue Situation.
»Ja, Eberhofer«, sagt er und steht gleich einmal auf. »Kommen S’ rein. Lassen Sie sich anschauen. Hervorragend … ehrlich, ganz hervorragend schauen Sie aus.«
Er geht einmal komplett um mich rum und schaut mich von oben bis unten an. Das tut schon gut, wirklich.
»Ja, ja, ich hab’s schon gehört. Kommissar Eberhofer, gell. Hört sich doch gleich ganz anders an, hähä. Und wie das schon ausschaut, ehrlich. Wie ein Offizier und Gentleman, muss ich direkt sagen. Ja, mein Großvater, Gott-hab-ihn-selig, der hat auch immer gut ausgeschaut seinerzeit. Wissen’s schon, damals in seiner Offiziersuniform. Schneidiges Mannsbild, wirklich. Da könnte man tatsächlich neidisch werden, gell«, lacht er versonnen und setzt sich dann hinter seinen Schreibtisch. »Aber lassen wir das, Eberhofer. Zwecks was ich Sie eigentlich brauche, ist Folgendes. Die Özdemirs im Tannenweg, die kennen Sie doch auch, oder? Der Jüngere spielt Fußball im FC Rot-Weiß. Erstklassiger Mittelfeldspieler. Schießt beidfüßig. Wunderbare Technik, vielleicht haarscharf am Ballack vorbei. Aber leider zu dick. Fünfzehn Kilo, würd ich mal sagen.«
Er tastet seinen Ranzen ab. »Also, was ist, die kennen S’ doch, oder?«
Ich zuck mit den Schultern.
»Ja, was heißt jetzt da kennen. Gesehen hab ich sie schon so ein paarmal. Aber kennen direkt tu ich sie nicht.«
»Das wird sich jetzt aber ändern, Herr Kommissar. Und da ist es geradezu hervorragend, dass Sie heute die Uniform tragen. Weil: bei den Türken, da macht das halt schon noch was her, gell. Besonders jetzt, mit so viel Silber.«
»Und was genau soll ich bei denen?«, frag ich und setz mich derweil auf seinen Schreibtisch. Das mach ich manchmal. Besonders gern, wenn er was von mir will, der Herr Bürgermeister. Das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Irgendwie überlegen halt.
Und dann erfahr ich, dass der Ältere der Özdemirs, also quasi der Vater, eine Anzeige bekommen hat. Und zwar von seiner eigenen Tochter. Weil er die nämlich zwangsverheiraten möchte. Mit einem Cousin zweiten Grades. Die ganze Familie wusste darüber Bescheid. Nur leider die zukünftige Braut nicht. Und genau in dem Moment, wo die dann urlaubsweise in die Türkei fährt, schenkt ihr ein Onkel reinen Wein ein. Holt sie vom Flughafen ab und sagt ihr gleich klipp und klar, was Sache ist. Was er von ihr erwartet und mit ihm natürlich die ganze restliche Sippschaft. Und was macht das Kind, das undankbare? Rennt, kaum in Ankara angekommen, pfeilgrad zur deutschen Botschaft und zeigt sie alle an. Den Vater, den Onkel, den Bräutigam und den kompletten Türkenclan halt. Der, ganz im Gegensatz zu ihr selbst, freilich informiert war über die dubiosen Hochzeitspläne.
Ja, und meine ehrenwerte Aufgabe ist es jetzt, den Teil der Familie zu verhören, der halt hier in Deutschland bei uns im Dorf so wohnt. Gut, sag ich zum Bürgermeister, das dürfte kein Problem werden. Schließlich leben wir hier nicht mehr im Mittelalter. Und wenn die Özdemirs in unserem wunderbaren Land sein wollen, dann sollten sie schon auch unsere Regeln einhalten. Da kann man doch nicht einfach so mir nichts, dir nichts ein junges, hübsches Ding an einen übrig gebliebenen Vetter verscherbeln, oder? Ja, wo kämen wir denn da hin!
Der Bürgermeister schaut mich dankbar an, und ich schüttel ihm gönnerhaft die Hand. Ich werd die Sache regeln, sag ich. Gar keine Frage.
Kapitel 2
Die Özdemirs wohnen in einem alten Bungalow, einem Relikt aus den frühen Siebzigern, und sie wohnen zur Miete dort. Den Eigentümer kenn ich, der baut alle zehn Jahre neu, weil ihm das alte Haus immer zu schäbig wird und er es dann eben vermietet. Und weil er das Haus jeweils im Urzustand vermietet, kriegt er halt auch keine gescheiten Mieter, gell. Höchstens Sozialhilfefälle. Oder eben Türken. Wobei man ja schon sagen muss, den Türken fällt so was ja gar nicht auf, glaub ich. Ich war nämlich schon einmal in der Türkei und weiß genau, wie die dort hausen. Da ist ja dieser grindige Bungalow praktisch das reinste Neuschwanstein dagegen. Das muss man jetzt schon einmal sagen.
Ich steh also vor der Haustür und läute. Es hat noch mal zu schneien angefangen, was Anfang März natürlich nervt, aber gut.
Die Tür geht auf, und wenn mich nicht alles täuscht, ist es der übergewichtige Fußballgott, der mir jetzt gegenübersteht. Ich komm gar nicht erst zu Wort, nein, er bittet mich nämlich gleich weiter und zwar auf Deutsch.
»Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich bin der Murat. Kommen Sie rein, kommen Sie doch«, sagt er und geht vor mir her durch die Diele. Ich weiß gar nicht recht, wie mir geschieht, und folge ihm trotzdem auf Schritt und Tritt.
Wir betreten das Wohnzimmer, und ich muss ehrlich sagen, dass mir jetzt beinah die Luft wegbleibt. Perserteppiche, wohin man schaut, in mehreren Schichten auf dem Boden, dass man direkt mit dem Fuß einsinkt. Auch an den Wänden, Teppiche in wunderbaren Farben und Mustern, dazwischen Plastikblumen, soweit das Auge reicht.
Auf einer Eckcouch, die außerordentlich niedrig ist, sitzt ein Mann im Kleid und raucht eine Wasserpfeife. Wie er mich sieht, steht er auf, unglaublich langsam zwar, fast zeremoniell, aber immerhin erhebt er sich. Das zeugt von Respekt. Dann klatscht er in die Hände, und wie aus dem Boden gewachsen steht plötzlich eine kleine Frau vor ihm, und sie trägt ein Kopftuch. Er flüstert ihr was zu, und sie entschwindet auf die gleiche Weise, wie sie grad erschienen ist. Bisher bin ich noch immer nicht zu Wort gekommen.
»Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Heim, Herr Kommissar. Bitte nehmen Sie doch Platz«, sagt er, deutet auf das Sofa und nimmt seine vorherige Position wieder ein.
Jetzt bin ich einigermaßen überrascht, muss ich sagen. Nicht nur dieses ganze Willkommens-Trara, sondern auch, dass sie meinen Dienstgrad erkennen. Damit hätt ich nicht gerechnet. Dann setz ich mich auf die tiefen Polster und versinke darin. Im Grunde kann ich kaum über meine Knie drüberschauen.
Die Frau von eben wächst wieder aus dem Boden, und diesmal hat sie einen Tee dabei. Es ist wohl Pfefferminze, jedenfalls riecht es danach. Sie stellt das Tablett auf einem winzigen Tisch genau vor uns ab und löst sich wieder in Luft auf.
Der Hausherr beginnt einzugießen. Und das ist jetzt ein Theater, das kann man gar nicht glauben. Er hält die Teekanne in schwindelerregende Höhen und gießt ein Glas halbvoll. Dann schwenkt er die Kanne, schüttet das halbe Glas wieder zurück, übrigens aus der gleichen Höhe, und schwenkt erneut. So geht das ein paarmal. Mir wird schon ganz schwindelig von der ganzen Höhe und dem Geschwenke, aber schließlich überreicht er mir ein randvolles Glas. Wir prosten uns zu, was bei Pfefferminztee vielleicht ein bisschen dämlich ist, aber gut.
Schmecken tut er aber ganz großartig, der Tee. Wobei jetzt Tee vielleicht nicht unbedingt mein Lieblingsgetränk ist. Nein, gar nicht. Den trink ich höchstens einmal, wenn ich krank bin. Sehr krank natürlich. Aber der hier ist gut. Da gibt’s nix zu deuteln.
Es hilft aber alles nix, weil: Dienst ist Dienst, drum fang ich jetzt an.
»Herr Özdemir, es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Von Ihrer Tochter Medine. Die behauptet, Sie wollten sie zwangsverheiraten in der Türkei. Damit liegt der Tatbestand der Nötigung vor. Das macht in unserem wunderbaren Staat eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu langen zehn Jahren. Ist Ihnen das klar?«
Er fängt wieder an zu schwenken und gießt nach.
»Herr Kommissar, wenn Sie erlauben, davon verstehen Sie nichts«, sagt er ruhig und freundlich.
»Das ist mir jetzt aber persönlich vollkommen wurst, ob ich davon was versteh oder nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass Sie sich damit strafbar machen«, sag ich jetzt ebenso ruhig, wenn auch nicht ganz so freundlich, und trinke meinen Tee.
Draußen in der Diele läutet das Telefon, wird aber sofort abgenommen. Der Hausherr gießt Tee nach. Und mir schlafen bei dem niedrigen Gehocke langsam, aber sicher die Haxen ein.
»Sehen Sie, Herr Kommissar, meine Tochter Medine ist mein kleiner Engel. Sie war schon immer mein kleiner Engel. Gehorsam, brav, klug …« Er schaut ganz versonnen in sein Teeglas, sagt eine Weile nichts, und weil mir zwischenzeitlich auch nichts einfällt, fährt er schließlich fort.
»Ja, klug war sie wirklich. Das war wahrscheinlich auch das Unglück daran. Wissen Sie, Herr Kommissar, wir leben seit über zwanzig Jahren hier in Ihrem großartigen Land. Meine Kinder sind hier zur Welt gekommen und auch zur Schule gegangen. Medine war eine kluge Schülerin. Sie hat das Abitur gemacht. Und hat sich dafür noch nicht einmal besonders anstrengen müssen.«
Er legt wieder eine Gedenkminute ein, und ich trink derweil meinen Tee.
»Ja«, sag ich dann, weil wir so gar nicht weiterkommen. »Das nutzt Ihnen aber jetzt auch nichts. Selbst wenn das Mädchen noch so gescheit ist, kann man sie nicht so einfach mit jemandem verkuppeln, verstehen Sie? Zumindest nicht bei uns da.«
Der Özdemir steht auf und geht zum Wohnzimmerschrank. Holt ein Album heraus und setzt sich wieder hin. Darin blättert er kurz und nimmt dann ein Foto heraus.
»Medine«, sagt er und reicht es mir rüber.
Jesus Christus!
Ich muss mich kolossal zusammenreißen, hier nicht das Schreien zu kriegen. Auf Anhieb wird mir klar, warum dem Özdemir diese Heirat so wichtig ist.
Mein kleiner Engel.
Der arme Mann.
Hat eine Tochter, die ausschaut wie der Glöckner von Notre Dame. Oder zumindest wie eine Schwester davon. So was hat auf dem freien Markt natürlich keine Chance. Nicht die geringste.
»Sie studiert Politik«, sagt der gepeinigte Vater jetzt. Sie studiert also. Na, wenigstens etwas. Da ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Weil, sagen wir einmal so, hässlich sein allein reicht eben nicht aus, gell. Da muss man sich schon noch was anderes einfallen lassen. Schließlich muss man ja irgendwann einmal von irgendwas leben. Und wenn man keinen Mann abkriegt, muss man halt seine Kohlen selber verdienen. Außerdem lenkt so ein Studium ja auch ungemein ab. Sogar vom eigenen Spiegelbild.
Der Fußballgott kommt ins Zimmer und macht ein betretenes Gesicht. Sein Vater deutet ihm an, sich hinzusetzen, und er gehorcht.
»Was ist los?«, fragt er den Sohnemann.
Der senkt seinen Blick genau auf das herrliche Teppichmuster.
»Hassan hat angerufen«, sagt er.
Der Özdemir nickt.
Der Jüngere hebt kurz den Kopf, lässt ihn aber gleich wieder plumpsen.
»Hassan möchte keine Heirat mehr«, sagt der Murat dann weiter. »Er hat sich mit Medine getroffen und ausgesprochen.«
Pause. Beide schweigen.
Ich schau hin und her zwischen den betretenen Gesichtern, und mir schwant etwas.
»Wie lange haben sich denn der Hassan und die Medine nicht mehr gesehen?«, muss ich jetzt wissen.
»Sie haben sich überhaupt noch nie gesehen«, sagt der Murat.
Ja, das war ja eigentlich klar.
»Wunderbar«, sag ich und quäl mich aus den tiefen Polstern. Meine Beine kribbeln, ich kann sie kaum mehr spüren. »Dann hat sich das ja wohl erledigt, mit der Anzeige, gell. Weil: wenn beide nicht mögen, dann wird’s ziemlich schwierig, Herr Özdemir.«
Aber ich glaub, er hört mich schon gar nicht mehr. Er hält die Hand vor die Augen und hat den Kopf gesenkt. Schaut vermutlich das herrliche Teppichmuster an. Da weiß ich jetzt gar nicht, warum der so schaut: Immerhin studiert die Schwester vom Glöckner doch Politik. Da wird sie schon für sich selber sorgen.
Der Murat bringt mich zur Tür und will mich dort dann umarmen. Das weiß ich aber zu verhindern. Ich schüttel ihm die Hand und sag, er soll sich um seinen Vater kümmern. Das will er tun.
Schon wie ich in den Streifenwagen steig, merk ich es deutlich. Die Blase drückt. Der Tee muss raus. Und zwar schleunigst. Also Blaulicht an und Sirene. Und mit Karacho zurück ins Büro. Jetzt haben wir ja bei uns im Rathaus natürlich nur ein Männerklo. Was auch für den Bürgermeister und mich normalerweise völlig ausreichend ist. Anders ist es heute. Heute nämlich pressiert’s mir dermaßen, und akkurat jetzt hockt der Bürgermeister auf dem Thron.
Na bravo.
»Eberhofer?«, schreit er mir durch die Klotür her.
»Ja, ich bin’s«, ring ich mir mit zusammengepressten Beinen heraus. Ich steh so vorm Waschbecken und betrachte im Spiegel mein verzerrtes Gesicht. Hoffentlich muss er nur bieseln. Die Geräusche allerdings lassen einen deutlich größeren Umfang erahnen.
»Und, wie ist es gelaufen bei Ihren Türken?«, dröhnt es zu mir raus.
»Wunderbar. Alle sind wieder friedlich, und die Anzeige ist Geschichte«, quetsch ich jetzt über die Lippen.
»Ja, das hab ich mir schon gedacht, dass Sie das hinkriegen. Allein schon, weil Sie so gut ausgeschaut haben heut.«
»Brauchen S’ noch länger, Bürgermeister?«
»Ja, wissen S’ Eberhofer, das kann man schlecht sagen, gell. Nach meinem Darmverschluss vor ein paar Jahren muss ich halt schon immer ein bisschen vorsichtig sein. Da hab ich übrigens eine Mordsnarbe davon. Wollen S’ die mal anschauen?«
Ich schüttel den Kopf.
»Nein«, stöhn ich, und mir drückt’s das Wasser in die Augen. Drüber im Damenklo hör ich lautes Gelächter. Dieser Fluchtweg ist also deutlich versperrt.
»Was ist denn los mit Ihnen? Ist es Ihnen vielleicht eilig?«, tönt’s jetzt wieder durch die Klotür.
»Nein, jetzt nimmer«, sag ich und lass grad den Tee ins Waschbecken ab. Eine immense Erleichterung macht sich in mir breit. Bei aller Liebe. Aber vor einem beidseitigen Nierenversagen muss die Hygiene halt hinten anstehen.
Zum Mittagessen fahr ich heim und hoff, dass die Oma was Schönes gekocht hat. Dieser ganze Pfefferminzgeschmack hängt mir noch immer derart in der Gurgel und beeinträchtigt sogar meinen Geruchssinn ganz enorm. Selbst das wunderbare Essen im Ofen von der Oma kann ich nicht erschnüffeln. Alles riecht heut einfach nach Minze. Ich mach den Tisch zurecht und setz mich dann erwartungsfroh nieder. Was es wohl Feines gibt? Der Papa kommt rein und setzt sich ebenso erwartungsfroh nieder. Was uns aber dann tatsächlich erwartet, sind englische Lammkoteletts in Minzsoße. Das Rezept ist aus dem nagelneuen Kochbuch vom Leopold. Und es ist einfach ekelhaft. Ekelhaft und völlig ungenießbar. Selbst die hammermäßigen Bratkartoffeln, wo die Oma immer schon macht, schmecken heut einfach nur minzig. Ich kann’s beim besten Willen nicht essen, geh rüber zum Mülleimer und kipp das Zeug weg. Der Papa tut’s mir gleich. Und obwohl die Oma ansonsten sehr empfindlich ist, was ihre Kochkunst betrifft, folgt auch ihr Tellerinhalt prompt den unseren. Das neue Kochbuch fliegt gleich hinterher.
»So ein Haufen Arbeit wegen nix. Das kann er recht schön selber fressen, der gescheite Leopold«, knurrt die Oma.
»Ich hol uns ein paar Warme beim Simmerl«, sag ich.
»Mach das«, sagt der Papa.
Und dann bin ich auch schon weg.
»Servus, Simmerl«, sag ich, gleich wie ich die Metzgerei betrete.
»Ja, Eberhofer, was ist denn mit dir los? Wieso hast denn heut dein Kasperlgewand an?«, fragt der Simmerl und meint offenbar meine Uniform. Wenn aber die Berufsbekleidung eines Menschen aus blutverschmierten Schürzen und Gummistiefeln besteht, hat er von so was halt grundsätzlich keine Ahnung.
»Gib mir acht Leberkässemmeln und halt einfach dein Maul«, sag ich und leg ihm gleich mein Geld auf den Tresen. Während der Simmerl die Semmeln herrichtet, sagt er: »Du, Franz, heut ist doch beim Wolfi der Hausball. Wie schaut’s aus? Gehst da mit hin? Ich mein, maskiert bist ja sowieso schon. Also, die Gisela und ich, wir gehen da jedenfalls hin«, grinst mir der blöde Metzger über den Tresen und reicht dann meine Semmeln rüber. Und ich geh lieber mal, bevor es eskaliert.
Nach Feierabend schau ich tatsächlich noch zum Wolfi rein. Aber nicht etwa wegen dem ganzen Faschingstamtam, sondern vielmehr, weil ich diese Pfefferminz-Orgie aus meinem Hals spülen muss. Ich bestell mir ein Bier.
»Du bist früh dran. Aber originelle Verkleidung, wirklich, ausgesprochen originell, Franz«, sagt der Wirt, langt mir mein Glas her und fährt dann fort, kilometerlange Luftschlangen im Lokal zu verteilen. Das Bier schmeckt nach Minze. Ich geb’s auf.
Daheim schnapp ich mir den Ludwig, und wir drehen unsere Runde. Er läuft heute weit vor mir her. Wahrscheinlich kann er mich auch nicht recht riechen. Wegen dem Wahnsinnstempo, das er vorgibt, brauchen wir nur eins-sechzehn dafür. Das ist eine unserer Bestzeiten. Und das stimmt mich fröhlich.
Wie wir heimkommen, raufen der Papa und die Oma grad um eine Tube Schuhcreme. Weil der Papa nämlich jetzt zum Wolfi will wegen Fasching und darum halt verkleidet ist. Als Bob Marley, wie jedes Jahr. Und die Oma es beim besten Willen nicht einsieht, schon wieder eine Bettwäschegarnitur wegschmeißen zu müssen.
»Franz, jetzt sag doch du auch einmal was! Er soll sich sein Gesicht nicht wieder so anschmieren, verdammt. Weil er mir jedes Mal mit dem Schmarrn die ganze Wäsche versaut!«
Ich nehm den beiden die Tube aus den Händen. Die ist quasi beschlagnahmt. Der Papa schüttelt verständnislos seinen Kopf, dass die Rasta-Locken nur so fliegen.
»Ja, sag einmal, hab ich denn da herinnen gar nix mehr zu sagen? Nimmt mich eigentlich überhaupt noch irgendwer für voll?«
»Schau dich im Spiegel an. Vielleicht beantwortet das deine Frage«, sag ich und geh dann zum Kühlschrank. Ein neues Bier, ein neuer Versuch. Diesmal schmeckt es schon besser. Deutlich besser. Die Minze auf dem Rückzug, quasi. Ein Segen.
Der Papa steht jetzt vorm Spiegel.
Er hat eine Jeans an und ein T-Shirt mit Jamaikaflagge. Und natürlich Rasta-Zöpfe. Bis runter zum Arsch.
Großartige Verkleidung, wirklich.
»Großartige Verkleidung, wirklich«, sag ich.
»Es schaut Scheiße aus mit dem weißen Gesicht«, sagt er brummig.
»Es schaut wunderbar aus«, sag ich. »Viel besser als mit Schuhcreme. Und der Marley, der war ja auch gar nicht richtig schwarz. Mehr so Mulatt, weißt du. Schmier dich lieber mit Schokolade ein, vielleicht lutschen’s dir dann später die Weiber runter.«
Jetzt muss ich grinsen.
Er grinst nicht. Vielmehr macht er ein finsteres Gesicht.
Ein finsteres weißes Gesicht. Dann schreitet er von dannen.
»Was ist denn mit dir los? Gehst du nicht rüber zum Wolfi?«, will die Oma jetzt wissen. Ich mach mit Hilfe meiner Hände und dem Kopf das Ich-bin-müde-Zeichen und zieh mich dann in meinen Saustall zurück.
Der Umbau ist jetzt fast fertig. Vielleicht ein paar Feinheiten noch. So was wie Wände verputzen oder Fenster streichen. Aber das Wesentliche ist getan. Eine Heizung ist drin und ein großartiges Bad. Gut, die Fliesen sind gewöhnungsbedürftig. Erbsengrün und senfgelb im Schachbrettmuster. Ich hab sie jetzt seit einem Jahr, und bisher hab ich mich noch nicht so recht dran gewöhnt. Dafür waren sie billig. Sehr billig sogar. Sie waren so dermaßen billig, dass die Oma den ganzen Restbestand aufgekauft hat. Und damit wurde dann halt mein Bad gefliest. Und der Eingangsbereich. Und die Küche natürlich.
Um drei Uhr in der Früh tönen vom Wohnhaus rüber die Beatles in anzeigepflichtiger Lautstärke. Es ist so unerträglich, dass sogar der Ludwig das Jaulen kriegt. Also muss ich da rüber mitsamt meiner Waffe. Mr. Rastaman hockt im Kerzenschein auf dem Boden und säuft Rotwein direkt aus der Flasche. ›A hard day’s night‹ tobt aus den Boxen. Zuerst schieß ich ihm die Kerze aus. Dadurch wird es dunkel, aber nicht leiser. Sein Feuerzeug klickt. Er steht jetzt vor mir und schreit mich an. Ich kann ihn aber leider nicht verstehen und zuck mit den Schultern. Er macht das Licht an und stellt die Musik ab. Und jetzt ist es wie im freien Fall. Der Körper kann so schnell gar nicht reagieren. Dem Papa geht es genauso wie mir. Wir schwanken ein bisschen.
»Wenn du hier noch ein einziges Mal rumschießt, dann werd ich das deinem Vorgesetzten melden«, sagt der Papa und dreht sich einen Joint. Das passt ganz großartig zu seinem Outfit.
»Und wenn du hier noch ein einziges Mal rumkiffst, dann werd ich das auch meinem Vorgesetzten melden«, sag ich, steck meine Pistole ein und geh wieder rüber.
Jeden Rosenmontag dasselbe. Immer diese dämlichen Faschingsdepressionen. Weil er nämlich an einem Rosenmontag die Mama kennen gelernt hat. Die große und einzige Liebe seines Lebens. Und ich hab sie auf dem Gewissen. Weil sie bei meiner Geburt gestorben ist. Es ist zum Kotzen!
Kapitel 3
Am nächsten Tag in der Früh kommt ein Anruf von der PI Landshut. Sie brauchen mich zur Verstärkung. Bei Gericht. Und wenn die werten Kollegen aus Landshut rufen, macht sich der dienstbeflissene Kommissar Eberhofer natürlich prompt auf den Weg.
Es geht um einen mutmaßlichen Mordfall, genau genommen um den, von dem der Papa schon aus der Zeitung wusste. Indizienprozess. Der Typ soll seine Geliebte auf dem Gewissen haben, weil er an ihr Geld ran wollte. Aber der streitet natürlich alles ab.
Sein Anwalt plädiert auf unschuldig. Logisch. Dafür wird er ja auch bezahlt. Der Staatsanwalt will lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ein ganz normaler Fall eigentlich. Was aber nicht normal ist und eben auch mich auf den Plan ruft, ist, dass der Angeklagte ein Psychopath ist. Also eigentlich ist er ein Psychologe, rein aus beruflicher Sicht, mein ich. Aber laut Gutachter und laut Richter Moratschek eben gemeingefährlich. Hannibal Lecter ein Scheißdreck dagegen, sagen sie. Und die müssen es ja wissen. Jetzt könnte man meinen, Psychopath und Psychologe, wie passt denn das zusammen? Aber offenbar passt das ganz wunderbar zusammen. Und sagen wir mal so: Wer könnte besser wissen, wie sich ein Psychopath zu verhalten hat, als eben ein Psychologe? Eben.
Nein, was ich eigentlich sagen wollte: Wir müssen ihn halt jetzt bewachen, den Küstner. Das ist sein Name. Dr. Küstner. Angeklagt wegen vorsätzlichen Mordes aus niederen Beweggründen. Wie wir zur JVA hinkommen, ist er von den Kollegen schon geschellt an Händen und Füßen. Und er macht einen Zirkus, das kann man gar nicht erzählen. Er kann so nicht laufen und ihm tun die Handgelenke weh und außerdem hat er eine Edelstahlallergie und so weiter und so fort. Ein Weichei sondergleichen praktisch. Wobei man ja jetzt sagen muss, wenn er wirklich so gefährlich ist, wie gesagt wird, dann kann das schon auch gut eine Masche von ihm sein, eine psychopathische. Also sind wir tierisch auf der Hut. Sind auf der Hut und hauen ihm mit den Schlagstöcken hinten auf die Oberschenkel, damit er sich vom Fleck bewegt. Nicht sehr fest, aber trotzdem fällt er hin. So geht das bis zum vergitterten Transportbus, Sauwagen, wie wir ihn liebevoll nennen. Wir brauchen insgesamt zwanzig Minuten bis zum Fahrzeug. Beachtlich. Aber irgendwann sitzt er dann drin, der Küstner, und weint. Und wir können endlich losfahren.
Das Verlesen der Anklageschrift ist endlos und langweilig, die Stimme vom Staatsanwalt gleichmäßig und ruhig. Der Idealfall für ein Nickerchen. Wenn man kein Schnarcher ist, dann kann man das normalerweise gut einschieben. Heute aber ist das anders. Weil heute nämlich zwischen den Worten des ehrenwerten Herrn Staatsanwalts immer wieder die hysterischen Rufe des Psychopathen ertönen. Nervtötend bis zum Dorthinaus. Jedes Mal, wenn ich kurz wegnicke, kreischt er wieder los, dass ich fast vom Stuhl fall. An ein Schläfchen überhaupt nicht zu denken.
In der Mittagspause treff ich den Moratschek am Kaffeeautomaten.