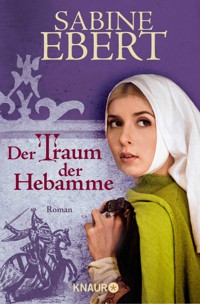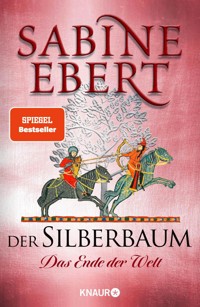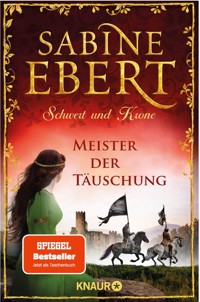
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Barbarossa-Epos
- Sprache: Deutsch
Der neue historische Roman und ein großes Epos der Bestseller-Autorin Sabine Ebert über die Barbarossa.Ära. Der Auftakt zu einer neuen großen Mittelalter-Serie Dezember 1137: Kaiser Lothar ist tot, und sofort bricht ein erbitterter Kampf um die Thronfolge aus. Machtgierigen Fürsten und der Geistlichkeit ist jedes Mittel recht, um den Welfen nicht nur ihren Anspruch auf die Nachfolge streitig zu machen, sondern ihnen auch Bayern und Sachsen zu entziehen. Durch eine ausgeklügelte Intrige gelangen die Staufer, die selbst Jahre zuvor durch Ränke an der Machtübernahme gehindert wurden, in den Besitz der Krone. Konrad von Staufen wird in die Königsrolle gedrängt, obwohl ihm dieser Weg missfällt. Bald muss er erkennen, dass sogar sein Bruder und sein junger Neffe, der künftige Friedrich Barbarossa, ihm nur bedingt die Treue halten. Es beginnt ein jahrelanger Krieg – und raffiniertes Intrigenspiel, in dem Welfen, Askanier, Wettiner und viele andere mächtige Häuser mitmischen – und auch so manche Frau. Bestseller-Autorin Sabine Ebert entführt ihre Leser in die faszinierende Zeit des 12. Jahrhunderts und entfaltet ein grandioses, erschütterndes und schillerndes Panorama, das auf verbürgten Ereignissen beruht. In ihrer neuen epischen Mittelalter-Serie beleuchtet sie den Aufstieg Barbarossas zu einem der mächtigsten Herrscher des Mittelalters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sabine Ebert
Schwert und Krone – Meister der Täuschung
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue historische Roman und ein großes Epos der Bestseller-Autorin Sabine Ebert über die Barbarossa-Ära.
Der Auftakt zu einer neuen großen Mittelalter-Serie
Dezember 1137: Kaiser Lothar ist tot, und sofort bricht ein erbitterter Kampf um die Thronfolge aus. Machtgierigen Fürsten und der Geistlichkeit ist jedes Mittel recht, um den Welfen nicht nur ihren Anspruch auf die Nachfolge streitig zu machen, sondern ihnen auch Bayern und Sachsen zu entziehen. Durch eine ausgeklügelte Intrige gelangen die Staufer, die selbst Jahre zuvor durch Ränke an der Machtübernahme gehindert wurden, in den Besitz der Krone. Konrad von Staufen wird in die Königsrolle gedrängt, obwohl ihm dieser Weg missfällt. Bald muss er erkennen, dass sogar sein Bruder und sein junger Neffe, der künftige Friedrich Barbarossa, ihm nur bedingt die Treue halten. Es beginnt ein jahrelanger Krieg – und raffiniertes Intrigenspiel, in dem Welfen, Askanier, Wettiner und viele andere mächtige Häuser mitmischen – und auch so manche Frau.
Bestseller-Autorin Sabine Ebert entführt ihre Leser in die faszinierende Zeit des 12. Jahrhunderts und entfaltet ein grandioses, erschütterndes und schillerndes Panorama, das auf verbürgten Ereignissen beruht. In ihrer neuen epischen Mittelalter-Serie beleuchtet sie den Aufstieg Barbarossas zu einem der mächtigsten Herrscher des Mittelalters.
Inhaltsübersicht
Karte: Mitteleuropa bis 1147
Übersicht der Stammtafeln
Dramatis Personae
Historisch belegte Personen der Handlung:
Staufer
Welfen
Askanier
Wettiner
Ludowinger
Slawen
Geistlichkeit
Wichtige fiktive Personen:
ERSTER TEIL
Die Kaiserinwitwe
Der Königsmacher
Die Purpurgeborenen
Der Bär
Die Sanfte
Die Kämpferin
Ein unerwarteter Empfang
Alter Freund, alter Feind
Die Kaiserin und der Spielmann
Das Mädchen Adela
Der Herr zweier Marken
Die Hüter des Ostens
Auf dem Weg zum Hoffest
Eine beunruhigende Eröffnung
Der König, die Krone und der Königsmacher
Die Jungfrau und der Falke
Kämpfe und Spiele
Zerstörte Träume
Königliches Wortgefecht
Zug um Zug
Mädchen bei Hofe
Entdeckung mit Folgen
Allianzen und Pläne
Ein Verlöbnis nach schwäbischem Brauch
Gewinner und Verlierer
ZWEITER TEIL
Überrumpelt
Eilika im Feuer
Die alte Muhme
Taktieren in Meißen
Fürstliche Order
Der Spielmann und die Stickerin
Witwe im Zorn, König in Nöten
Die Jungen Mächtigen
Noch mehr Pläne, noch mehr Streit
Die junge Burgherrin
Die Kindfrau und der Heerführer
Die brennende Burg, das sterbende Land
Kämpferherz
Herausforderung
Die Frauen und der Krieg
Leben und Sterben in Zeiten des Krieges
Herausforderung zur Entscheidungsschlacht
Sechsundzwanzig Schlehen
Der Stolz und der Tod
Heimkehr
Goldene Brücken über brennendes Land
Ein Wiedersehen und vier Todesfälle
Demütigung und Trost
DRITTER TEIL
Rückkehr aus Jerusalem
Meißnische Pläne
Das Ende der Kindheit
Zwei von drei
Leben im Wartestand
Zweckgemeinschaft
Die letzte Nacht
Vorzeichen des Krieges
Schwarze Tage
Demut, Unmut, Hochmut
Gedanken am Rhein
Streit im Hause Staufen
Zwei Verlöbnisse
Verlöbnis in Speyer
Nachwort und Dank
Stammtafeln
Die Welfen und die Staufer
Die Wettiner; Die Nachkommen Konrads I., des Großen
Die Wettiner
Die Askanier
Die Ludowinger
Glossar
Zeittafel
Mitteleuropa bis 1147
Diese Landkarte finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: https://goo.gl/R8A8Zt
Stammtafel
Diese Stammtafel finden Sie auch im Internet unter folgendem Link https://goo.gl/Cpybg7
Dramatis Personae
Historisch belegte Personen der Handlung:
Staufer
Konrad von Staufen, einst Gegenkönig, dann Thronanwärter, dann König
Gertrud von Sulzbach, seine Gemahlin
Graf Gebhard II. von Sulzbach, Bruder Königin Gertruds und einer der Vertrauten des Königs
Friedrich II. von Staufen, Herzog von Schwaben (der Einäugige), Konrads älterer Bruder
Agnes von Saarbrücken, seine zweite Gemahlin
Friedrich III., sein Sohn aus erster Ehe mit der Welfin Judith (später als Kaiser Friedrich I. Barbarossa)
Leopold von Babenberg, Konrads Bruder, Markgraf von Österreich (später Herzog von Bayern)
Heinrich von Babenberg, ebenfalls Konrads Bruder und Leopolds Nachfolger als Herzog von Bayern (Heinrich Jasomirgott)
Weltliche Verbündete:
Diepold von Vohburg, Markgraf auf dem Nordgau und Herr über das Egerland
Kunigunde von Beichlingen, seine Gemahlin
Adela, Diepolds Tochter und Kunigundes Stieftochter
Markwart von Grumbach, Vertrauter Konrads
Bernhard Graf von Plötzkau
Kunigunde, seine Gemahlin
Graf Heinrich von Wolfratshausen
Graf Sizzo von Schwarzburg
Sven, Sohn des Königs von Dänemark
Welfen
Heinrich der Stolze, Herzog von Sachsen und Bayern und Markgraf der Toskana, Thronanwärter
Gertrud, Tochter des Kaisers Lothar von Süpplingenburg und der Kaiserin Richenza
Heinrich, ihr Sohn (später Heinrich der Löwe)
Weltliche Verbündete:
Richenza von Northeim, Kaiserinwitwe, verwitwete Gemahlin Lothars von Süpplingenburg, deutscher Kaiser und König von Rom, Schwiegermutter Heinrichs des Stolzen
Bruno von Haigerloch, ehemals Bischof von Straßburg, Gelehrter und Ratgeber Richenzas
Friedrich von Sommerschenburg, Pfalzgraf von Sachsen
Graf Siegfried von Boyneburg
Graf Adolf II. von Holstein
Graf Rudolf von Stade
Askanier
Albrecht von Ballenstedt, Markgraf der Nordmark, Graf von Ballenstedt, zeitweise Herzog von Sachsen (später Markgraf von Brandenburg)
Sophia von Winzenburg, seine Gemahlin
Otto, Hermann, Adalbert, Dietrich, Siegfried, Heinrich und Bernhard – beider Söhne
Hedwig, beider Tochter
Eilika von Ballenstedt, Mutter Albrechts
Weltliche Verbündete:
Hermann Graf von Winzenburg, Sophias Bruder
Otto Graf von Hillersleben, getreuer Vasall Albrechts
Wettiner
Konrad von Wettin, Markgraf von Meißen und der Lausitz (später Konrad der Große)
Luitgard von Ravenstein, seine Gemahlin
Otto, beider ältester Sohn (später Otto der Reiche)
Dietrich, ihr zweitältester Sohn (später Dietrich von Landsberg)
Dedo, Heinrich, Friedrich (weitere Söhne)
Oda, Bertha, Gertrud, Adela, Agnes, Sophia (seine Töchter)
Mathilde von Seeburg (seine Schwester)
Werner von Brehna, sein Marschall
Radebot von Meißen, Ministerialer
Ludowinger
Landgraf Ludwig I. von Thüringen
Landgraf Ludwig der Eiserne, sein Sohn
Slawen
Niklot, Fürst der Abodriten auf der Mecklenburg
Pribeslaw, genannt Heinrich, Fürst (ehemals König) über Brandenburg und Spandau
Petrissa, seine Frau
Jacza, sein Neffe (künftiger Fürst von Köpenick)
Geistlichkeit
Albero von Montreuil, Erzbischof von Trier
Otto, Bischof von Freising, Halbbruder Konrads von Staufen
Abt Wibald von Stablo, Leiter der königlichen Kanzlei (später auch Abt von Corvey)
Anselm, Bischof von Havelberg
Konrad von Querfurt, Erzbischof von Magdeburg
Arnold, Domprobst von Köln, Kanzler
Erzbischof Arnold von Köln, Erzkanzler Italiens
Bernhard von Clairvaux, Abt von Clairvaux und Kreuzzugsprediger
Beatrix II. von Winzenburg, Äbtissin des Stiftes Quedlinburg, Halbschwester von Sophia, der Gemahlin Albrechts des Bären
Godebot (gest. 1140) und Reinward (ab 1140), Bischöfe von Meißen
Adalbert von Saarbrücken, Erzbischof von Mainz (gest. 1141)
Markolf, Erzbischof von Mainz (1141–1142)
Wichtige fiktive Personen:
Lukian, Spielmann, Spion und Schreiber in Meißen
Hanka, seine Frau
Christian, ihr Sohn
Josefa, Heilerin in Meißen, genannt »die alte Muhme«
Ulrich von Lauterstein, Vertrauter des Königs
Edwin, meißnischer Truchsess
ERSTER TEIL
Zwei Kronen, ein Thron
Die Kaiserinwitwe
Richenza von Northeim; Breitenwang in Tirol, 4. Dezember 1137
Der Kaiser ist tot!«
Seit Stunden hatten sie in Schnee und eisigem Wind auf diesen Ruf gewartet. Hunderte Männer in Rüstung, viele der Edelsten des Reiches, versammelt vor der erbärmlichen Hütte, die zum Sterbeort Lothars von Süpplingenburg geworden war.
Reihe um Reihe knieten sie nun nieder, die Schwerter vor sich in den Schnee gerammt, senkten die Köpfe und beteten. Einige weinten. Doch auf den meisten Gesichtern stand nicht Entsetzen oder Trauer, sondern Verbitterung.
Hatte Gott sie verlassen? Obwohl sie doch für Ihn in diesen Krieg geritten waren, für Ihn und Seinen Stellvertreter auf Erden, den Papst?
Geschlagen musste sich ihr Heer aus Italien zurückziehen, sich im tiefsten Winter über die Alpen quälen, mit all den Verwundeten und Kranken. Eine Seuche wütete unter den Männern. Und um das Scheitern dieses Feldzuges vollständig zu machen, war nun auch noch der Kaiser gestorben. In diesem vom Schnee begrabenen Dorf Breitenwang, inmitten der Wildnis der Berge.
So dachten die meisten der Knienden.
Bis sich ihnen unweigerlich die nächste Frage aufdrängte: Wer wohl Lothars Nachfolger würde.
Drinnen in der Kate saß Kaiserin Richenza, in einen mit Eichhörnchenfellen gefütterten Umhang gehüllt und dennoch vor Kälte zitternd, neben dem Leichnam ihres Gemahls. Mönche hatten den hünenhaften Körper Lothars auf einen grob gezimmerten Tisch gebettet. Sturmböen tosten und fauchten um die kärgliche Hütte, Hagelkörner prasselten gegen das Gebälk. Die Fensteröffnungen waren zum Schutz gegen Frost und Wind mit Stroh zugestopft und ließen keinen Lichtstrahl herein. Doch die Kerzenflammen flackerten im Luftzug und warfen wild tanzende Schatten.
Auch Richenza war von Entsetzen erfüllt. Der Tod ihres Gemahls schmerzte sie so sehr, dass sie am liebsten schreien, weinen und sich das Haar raufen wollte. Doch ihr Grauen rührte vor allem von den abscheulichen Dingen, die sie heute noch tun sollte.
Vergeblich versuchte sie, die schrecklichen Bilder zu verbannen, die sie im Geiste sah: wie der nackte Leichnam des Mannes, mit dem sie ihr Leben zugebracht hatte, in einen riesigen Kessel mit kochendem Wasser gestopft und gesiedet wurde, bis sich das Fleisch von den Knochen löste …
Fort, fort mit diesen Bildern! Jetzt brauchte sie alle Kraft, um ihrem Schwiegersohn den Thron zu sichern.
Sie wusste, wer sich gegen ihn wenden würde, vielleicht sogar mit Waffengewalt. Einige von ihnen standen direkt neben ihr in dieser winzigen Kate, und die anderen sammelten sich zweifelsohne schon draußen wie Aasgeier, um nach der Krone zu greifen.
Steif vor Kälte und mühsam wegen ihrer Körperfülle stemmte sie sich hoch. Ihre Stimme klang fest, als sie sich an die Männer wandte, die dem Todgeweihten in seinen letzten Stunden beigestanden hatten, darunter ein halbes Dutzend Bischöfe und Erzbischöfe.
»Unverzüglich sollen Reiter ausgesandt werden, die die Kunde verbreiten, dass Lothar, von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, Mehrer des Reiches, nach zwölf Jahren, drei Monaten und zwölf Tagen segensreicher Herrschaft am vierten Dezember im Jahr des Herrn 1137 zu Gott gerufen wurde.«
Nur der Gedanke an die Heimkehr hatte den mehr als Sechzigjährigen aufrecht gehalten. Doch der Weg über den Brenner und die im Heer wütende Seuche raubten ihm alle Kraft. Heute hatte er seinen letzten Atemzug getan – in dieser Hütte, wo der Wohlgeruch des reichlich verbrannten Weihrauchs vom Gestank des Ziegenbocks verdrängt wurde, der im hinteren Verschlag hauste und durchdringend schrie.
Richenza von Northeim richtete sich hoheitsvoll auf, obwohl ihre Gelenke schmerzten.
»Glocken sollen im ganzen Land läuten, Gebete für das Seelenheil des erlauchten Toten gesprochen werden!«, befahl sie. »Kein Untertan muss fürchten, es könnten unsichere, bedrohliche Zeiten anbrechen. Nach dem Willen Unseres geliebten Kaisers Lothar tritt der Herzog von Sachsen und Bayern und Markgraf der Toskana seine Nachfolge an. Ihr edlen Herren wart Zeugen, als mein kaiserlicher Gemahl die Reichsinsignien an seinen Erben und Schwiegersohn aus dem Hause Welf übergab: an Heinrich den Stolzen.«
Gebieterisch sah Richenza von einem Gesicht zum nächsten, um Widerspruch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sie durfte keine Schwäche zeigen.
Vor einer Stunde noch war sie Kaiserin gewesen, eine mächtige und für ihre Klugheit geachtete Frau, als Fürsprecherin gefragt und umschmeichelt.
Doch jetzt war sie Kaiserinwitwe; fast fünfzig Jahre alt, fett und schmerzgeplagt. Und sehr bald, vielleicht schon heute, würden Menschen auf den Plan treten, die ihr die Stimme verbieten wollten – weil Frauen nichts galten.
Nur Lothar verdankte sie es, dass sie an seiner Regentschaft teilhaben durfte. Jetzt lag er tot auf diesen rauhen Brettern.
Wem durfte sie nun noch trauen? Und würde ihr unbeherrschter, hochfahrender Schwiegersohn im Machtrausch noch mehr Fürsten verprellen, statt um ihre Stimmen zu werben?
»Wir brechen morgen auf und geleiten den erlauchten Toten in die Heimat«, fuhr Richenza fort. »Es ist Wille des Kaisers, im Kloster Königslutter zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Die Benediktiner sollen benachrichtigt werden, damit sie die Zeremonie vorbereiten.«
Sie atmete tief durch, rasselnd und mit jähen Stichen in der Brust.
»Jetzt geht – alle! Ich wünsche, eine Weile allein von meinem Gemahl Abschied zu nehmen.«
Mit Verbeugungen und leisen Gebeten verließen die Männer die Kate, die zum Sterbeort eines Kaisers geworden war.
Als der letzte von ihnen die schief an den Lederscharnieren hängende Tür erreichte, rief Richenza ihn zurück.
»Magister Bruno, Ihr bleibt!«
Das Gesicht des dürren Gelehrten mit dem schütteren Kinnbart zeigte keinerlei Regung. Er verneigte sich, kehrte zurück in den finstersten Winkel der Kate und wartete geduldig.
Bruno von Haigerloch war einer der verhasstesten Männer des Kaiserreiches. Dennoch hatte Richenza ihn zu ihrem Vertrauten und Berater erwählt. Sie hatte sogar dafür gesorgt, dass er das Amt des Bischofs von Straßburg zurückerhielt, als es ihm aufgrund diverser Verfehlungen entzogen worden war. Bald verlor er es jedoch erneut nach Anklagen wie Gewalttätigkeit und unrechtmäßiger Weihe.
Doch der Magister wusste, die Kaiserinwitwe brauchte ihn. Und gleich würde sie ihn mehr denn je brauchen. In einer unaufschiebbaren Angelegenheit, die nicht nur äußerste Diskretion verlangte, sondern zu der sich wegen ihrer Abscheulichkeit niemand sonst bereitfinden würde.
Jäh erstarb das Heulen des Windes. Vom Schnee gedämpft, drangen nun Geräusche in die Kate, die vom Aufbruch Dutzender Boten kündigten. Pferde wieherten, Metall klirrte, Befehle wurden erteilt.
Alles geschah so, wie es die Kaiserinwitwe angewiesen hatte.
Richenza zog sich den Umhang noch enger um den massigen Leib und sank auf einen Schemel. Still betrachtete sie den entseelten Körper des hochgewachsenen, selbst im Tod noch stattlichen Mannes, mit dem sie fast vier Jahrzehnte verheiratet gewesen war.
Nie hatte Lothar von Süpplingenburg ihr einen Vorwurf gemacht, als die ersten fünfzehn Jahre ihrer Ehe kinderlos blieben. Weder zeugte er Bastarde, noch verstieß er sie wegen Unfruchtbarkeit, was andere Männer an seiner Stelle bedenkenlos getan hätten. Er ließ sie sogar an seiner Herrschaft teilhaben, und ihr Wort wurde auch von den Großen des Reiches geachtet.
Als die Herzöge von Schwaben gegen ihren Gemahl rebellierten und sich Konrad von Staufen zum König ausrufen ließ, obwohl das Reich bereits einen König hatte, vermittelte sie nach Jahren erbitterten Krieges und brachte die Aufständischen dazu, sich zu unterwerfen.
Wehmütig erinnerte sich Richenza an den Tag vor mehr als zwanzig Jahren, als ihr der Leibarzt zu jedermanns Erstaunen doch noch eine Schwangerschaft bestätigte. Es musste ein Wunder geschehen sein; sie und Lothar hatten die Hoffnung auf einen Erben längst aufgegeben.
Doch anstelle des ersehnten Sohnes gebar sie ein Mädchen. Und wieder kam kein Wort des Vorwurfs über die Lippen ihres Gemahls. Stattdessen vermählte er seine einzige Tochter mit dem mächtigsten Fürsten des Reiches, dem Welfen Heinrich dem Stolzen. Nun würde ihr Schwiegersohn Kaiser und ihre Tochter Gertrud Kaiserin werden.
Aber zunächst hatte sie einen anderen letzten Willen Lothars zu erfüllen.
Schaudernd wandte Richenza den Blick von dem Toten ab und starrte auf das rußende Talglicht, das die Familie des Dorfschulzen hinterlassen hatte, bevor sie unter vielen Verbeugungen ihr Heim für die hohen Herrschaften räumte.
Die feinen Wachskerzen des kaiserlichen Haushalts brannten um das Haupt des Verstorbenen. Doch den Anblick des vertrauten Gesichts ertrug sie nicht in dem Wissen, was gleich mit ihm geschehen würde.
Lothar war ein Kaiser des deutsch-römischen Reiches und König von Rom gewesen. Angesichts seiner mehr als sechzig Lebensjahre, der Strapazen eines Feldzuges und der Überquerung der Alpen im Winter hatte er Vorkehrungen und Entscheidungen für den Fall seines Todes getroffen.
Er durfte sich seine Sünden vergeben lassen und Erlösung finden. Seine Gemahlin, sein Schwiegersohn, sein Beichtvater, seine Vertrauten weilten in seiner letzten Stunde bei ihm. Das war es, was man einen schönen Tod nannte.
Und er wünschte, in der Abtei Königslutter östlich von Braunschweig bestattet zu werden. Seit Jahren ließ er die Klosterkirche von italienischen Baumeistern nach dem Vorbild der Kathedralen in Aachen und Quedlinburg zu einer prachtvollen Grablege für seine Familie ausbauen. Noch war die Kirche nicht fertig, aber eines Tages würde auch sie, Richenza, dort an seiner Seite die letzte Ruhe finden.
Nur waren bis Königslutter Hunderte Meilen zurückzulegen, auf unwegsamen Gebirgspfaden und in tiefem Schnee. Die üblichen Methoden des Einbalsamierens konnten die Verwesung des Leichnams selbst im Winter nicht so lange aufhalten.
Das hatte sich auf schauderhafte Weise vor zwei Jahren beim Tod des englischen Königs Heinrich gezeigt, dem jüngsten Sohn von Wilhelm dem Eroberer. Nicht nur an den Höfen erzählte man sich immer noch schreckliche Geschichten über den bestialischen Gestank, den der Kadaver auf dem Weg von der Normandie bis zur Grabstätte nahe London verbreitete. Spielleute zogen von Dorf zu Dorf, gaben makabere Gesänge darüber zum Besten und fanden stets ein sensationslüsternes Publikum.
Um solcher Schmach zu entgehen, hatte Lothar geheime Befehle für den Fall hinterlassen, dass ihn der Tod fern von Königslutter ereilte.
Sie mussten mit der Prozedur beginnen, jetzt gleich, noch ehe die Leichenstarre einsetzte.
»Magister Bruno.«
Diensteifrig glitt der Gelehrte und vormalige Bischof von Straßburg heran und verneigte sich.
»Ist alles vorbereitet?«
»Gewiss, Majestät«, versicherte er und schob die Hände in die Ärmel seines Gewandes. »Aus Gründen der Pietät werden wir den Körper nicht zerlegen, sondern im Ganzen kochen. Sechs Stunden lang, bis sich das Fleisch von den Knochen löst. Hier in dieser Hütte, mit wenigen verschwiegenen Helfern.«
Brunos Stimme klang so gelassen, als rede er über das Wetter. Doch Richenza war starr vor Entsetzen.
»Ist das Fleisch abgekocht, werden die Gebeine mit den üblichen Ingredienzen balsamiert und in der naturgegebenen Anordnung aneinander befestigt«, fuhr der Magister ungerührt fort. »Den Kopf verhüllen wir mit feinem Leder, das Skelett wird mit prächtigen Gewändern und Schuhen bekleidet, wir legen ihm Sporen an und setzen ihm eine bleierne Grabkrone auf. Niemand wird bemerken, dass wir nur die Gebeine überführen. Die Würde Eures kaiserlichen Gemahls bleibt gewahrt. Wie er es wünschte.«
Der Gelehrte steckte die Hände noch tiefer in die Ärmel seines Gewandes und verneigte sich erneut.
»Dann beginnt!«, befahl die Kaiserinwitwe.
Wieder versuchte sie vergeblich, das Bild zu verdrängen, wie ihr toter Gemahl stundenlang gesotten wurde. Woher wollte der Magister in dieser Einöde überhaupt ein ausreichend großes Gefäß finden, um den Leichnam nicht zerstückeln zu müssen?
Nein, keine Bilder, keine Einzelheiten!
Hastig erhob sie sich, was die Kerzen noch stärker zum Flackern brachte. Der Ziegenbock in seinem Verschlag schrie nun ohrenbetäubend.
Jäh von Angst durchflutet, hämmerte Richenza gegen die morsche Tür. Kaskaden von Staubkrumen und feinen Holzsplittern rieselten herab.
Der Anführer der kaiserlichen Leibwachen öffnete. Vor der Tür warteten wie befohlen ihre Hofdamen, schweigend und vor Kälte zitternd.
»Begleitet mich zum Gebet in die Kirche!«, befahl Richenza, wobei ihr Atem zu weißen Wolken gefror.
Sie musste dringend fort von hier eingedenk dessen, was gleich in dieser Kate geschehen würde – und ihr Hofstaat ebenso.
Sollten sie beten. Vielleicht half es.
Der Königsmacher
Albero von Trier und Konrad von Staufen; Heerlager in Breitenwang, 4. Dezember 1137
Mit lässig gespreizten Beinen, die Daumen unter den Gürtel gehakt, stellte sich Herzog Heinrich der Stolze vor den im Schnee wartenden Fürsten auf.
»Unser dahingeschiedener Kaiser bestimmte mich zu seinem Nachfolger und Erben. Als Zeichen dessen übereignete er mir die Reichsinsignien. Ich erwarte Eure Huldigung!«, forderte er schallend.
Das löste ein leises, aber zorniges Raunen aus. Nur mit Rücksicht auf den Toten protestierte niemand laut. Und eingedenk dessen, dass eintausendfünfhundert Ritter den Welfenherzog auf diesem Feldzug begleiteten, weit mehr, als jeder andere Fürst hier mit sich führte.
Der hagere Bischof von Havelberg durchbrach das Raunen und rief für alle vernehmlich: »Huldigen sollten wir als fromme Christen in dieser traurigen Stunde dem Andenken unseres Kaisers. Beten wir für sein Seelenheil. Dem neuen König huldigen wir nach seiner Wahl. So, wie es Brauch und Sitte gebieten.«
Dass ausgerechnet Anselm von Havelberg ihm offen widersprach, bewies die Maßlosigkeit von Heinrichs Forderung, denn der Bischof war einer der Berater der Kaiserin.
Mit aufloderndem Zorn starrte der Herzog von Sachsen und Bayern den Rufer an. Mühsam unterdrückte er einen seiner gefürchteten Ausbrüche. Auch wenn er vor Wut fast platzte – solch einem frommen Einwand durfte er nicht widersprechen. Vor allem, wenn er von einem Bischof kam, der gerade erst für Lothar in Konstantinopel Bündnisverhandlungen mit dem Kaiser von Byzanz geführt hatte. Wollte Heinrich unangefochten herrschen, brauchte er Frieden mit dem Oströmischen Reich.
Eine zynische Entgegnung lag dem Welfen auf der Zunge: Was wohl das Wort eines Bischof wert sei, der sein Bistum noch nie betreten hatte, weil heidnische Slawen es vor zwei Jahren zurückerobert hatten und sich dort unangefochten hielten? Vielleicht sollte er dafür sorgen, dass das so blieb, wenn er erst König war.
»Dann betet für das Seelenheil meines Schwiegervaters! Und nach meiner Krönung werde ich Eure Huldigung mit besonderer Aufmerksamkeit und Freude entgegennehmen, Anselm von Havelberg!«, höhnte er stattdessen und stapfte mit wehendem Umhang davon.
Vielsagende Blicke wurden getauscht, zögernd löste sich die Ansammlung vor der Hütte auf. Da und dort bildeten sich wie zufällig Grüppchen und bahnten sich den Weg zu ihren Zelten durch von Tausenden Füßen zertretenen Schnee.
Der kleine Talkessel, in dem das Dorf Breitenwang lag, bot kaum Platz, um das heimwärts ziehende Heer aufzunehmen. Die meisten Edlen verzichteten lieber darauf, sich in einer der Bauernkaten einzurichten, um das Quartier nicht mit den Haustieren und dem Ungeziefer teilen zu müssen. Auf jedem freien Platz standen daher Zelte, die bald im Schnee begraben sein würden, sollten die Flocken weiter so dicht vom Himmel fallen. Schon bogen sich die Leinenbahnen unter der schweren Last.
Betont beiläufig wandte sich der überaus prächtig gekleidete Erzbischof von Trier an den hellblonden, etwa vierzigjährigen Mann neben ihm, dessen Miene sich bei den Worten des Welfen in Stein verwandelt hatte.
Konrad von Staufen, der jüngere Bruder des Herzogs von Schwaben und Herrscher über das östliche Franken, war gerade äußerst übel gelaunt.
Was der Erzbischof genüsslich ignorierte.
»Ließt Ihr Eure Zelte nicht ganz in der Nähe errichten, Durchlaucht?«, fragte der Geistliche beschwingt. »Mein Lager steht fast eine Meile entfernt, will mir scheinen. Habt die Güte und gewährt einem gebrechlichen alten Mann einen Platz am Feuer und einen Becher mit heißem Würzwein!«
Konrad neigte höflich den Kopf und wies einladend in Richtung seines Lagers. Leibwachen bahnten ihm und dem Erzbischof einen Weg durch das Gewühl aus Rittern, Reisigen, Pferdeknechten und Tieren. Links und rechts verneigte sich jeder vor ihnen.
Zum Glück lag das staufische Lager wirklich ganz in der Nähe, was dem Vorwand des Erzbischofs einen Hauch von Glaubwürdigkeit verlieh.
Albero von Trier war zwar beinahe sechzig Jahre alt, doch ein sehr weltlicher und kämpferischer Mann und alles andere als gebrechlich, obgleich er sich beim Gehen gelegentlich stützen ließ, wenn der jähe, wiederkehrende Schmerz im Rücken ihn heimsuchte. Er hatte mehr als fünf Dutzend Ritter samt Knappen und Knechten in diesen Feldzug geführt und trug häufiger Rüstung als Ornat, doch beides stets gleichermaßen prächtig. Er liebte die Tafelfreuden und geistreiche Gespräche, bei denen er durch Humor glänzte.
Die bevorstehende Unterredung würde allerdings gewiss nicht heiter werden.
Konrad von Staufen führte den Gast in sein Prunkzelt, in dem ein Kohlebecken glühte und Felle auf dem Boden lagen, um die Kälte von den Füßen fernzuhalten. Er ließ heißen Wein einschenken, der mit Honig und kostbaren Gewürzen verfeinert war. Die Diener schickte er nicht fort, um keinen Verdacht zu wecken. Albero stammte aus Montreuil und sprach Französisch. Die Bediensteten würden nichts von ihrer Unterhaltung verstehen.
»Haltet jegliche Lauscher von meinem Zelt fern!«, wies der Staufer den Anführer seiner Leibwache an. Der nickte und ging hinaus, nachdem er sich vor seinem Herrn und dem hohen Gast verneigt hatte.
Seinem engsten Vertrauten, einem Ritter mit ergrauendem Haar, bedeutete Konrad mit einem Blick, am Zelteingang zu wachen.
Albero trat zum Feuer, streifte die hirschledernen Handschuhe ab und spreizte seine Finger über den glimmenden Kohlen.
»Die Begeisterung, den herrschsüchtigen Welfen als König vor die Nase gesetzt zu bekommen, war eben fast mit Händen greifbar«, eröffnete er voller Sarkasmus das Gespräch. »Der Welfenherzog wird Euer bester Fürsprecher, ohne es zu merken. Dieser Auftritt eben!«
In gezierter Missbilligung schüttelte der Erzbischof den Kopf. »Habt Ihr die finsteren Blicke der anderen Fürsten bemerkt? Oder wart Ihr zu sehr mit Eurer eigenen Entrüstung beschäftigt?«, fragte er spitz.
»Selbst wenn er der beste Mann auf dem Thron wäre, so müsste er doch gewählt werden für diese Würde!«, entgegnete Konrad finster auf Französisch. »Gewählt von vierzig Edelleuten der wichtigsten Stämme. Zehn Franken, zehn Schwaben, zehn Sachsen, zehn Bayern. Hat nicht Lothar selbst diese Sitte wieder eingeführt – auf Kosten meines Bruders? Das Prinzip der freien Königswahl anstelle des Erbrechts? Überdies kann ein Vater den Titel nur dem Sohn, nicht dem Schwiegersohn vererben. Doch Lothar scherte sich nicht darum, bestimmte seinen Nachfolger allein und schuf noch mit seinem letzten Atemzug Tatsachen!«
Wütend starrte der Staufer in seinen Becher, ohne einen Schluck zu trinken.
»Wir werden Tatsachen schaffen«, versicherte der Erzbischof von Trier gelassen, während er auf einem mit Schaffell bedeckten Stuhl Platz nahm. Er kostete von dem dampfenden Würzwein und schloss genüsslich die Augen. Gleich darauf jedoch richtete er jäh und fordernd den Blick auf sein Gegenüber.
»Vorausgesetzt, dass Ihr Euch endlich entschließt, unserem Plan zu folgen! Ihr seid der rechtmäßige Anwärter auf den Thron. Und Ihr seid der aussichtsreichste Kandidat für die Wahl. Euer Bruder kommt dafür nicht mehr in Frage.«
Friedrich von Staufen hatte im Krieg gegen Lothar ein Auge verloren. Nach uraltem Brauch musste ein König körperlich unversehrt sein.
»Vor zwölf Jahren brachte Lothar von Süpplingenburg Euren Bruder durch eine List um seinen rechtmäßigen Anspruch. Niemand kann uns verübeln, wenn auch wir zu einer List greifen. Diesmal wird es gelingen. Alles liegt nun bei Euch!«, beschwor Albero den Staufer. »Entscheidet Euch jetzt, Durchlaucht, und ich beginne sofort damit, in aller Diskretion Verbündete für Euch zu sammeln. Außerdem schicke ich noch heute einen Vertrauten nach Würzburg, wo all jene Fürsten auf die Rückkehr des Kaisers warten, die nicht mit uns nach Italien gezogen sind. Noch weiß keiner von ihnen, dass sich die Lage soeben drastisch verändert hat.«
Konrad von Staufen verharrte stehend. Nur das nervöse Trommeln der Finger am Becher verriet seine Unruhe.
Nichts an der Rede des Erzbischofs war neu oder unerwartet für ihn. Jedermann hatte in Betracht gezogen, dass der betagte Kaiser diesen Feldzug nicht überleben könnte, Lothar selbst eingeschlossen. Und ebenso die Partei jener, die einen Staufer auf dem Thron wünschten.
Heute musste er sich entscheiden. Jetzt und hier, in diesem Zelt.
»Die Krone liegt zu Euren Füßen. Ihr müsst Euch nur bücken und sie aufheben. Oder fürchtet Ihr Euch?«, provozierte der Erzbischof, als sein Gastgeber schwieg.
Konrad galt als mutiger und erfahrener Kämpfer, deshalb erfüllte sein Zögern Albero mit Ungeduld. Muss ich wirklich den Hund zum Jagen tragen, nur weil er nicht durch den Schlamm waten will?, dachte er grimmig, ohne sich etwas von seiner Anspannung anmerken zu lassen. Ich weiß, was für das Reich das Beste ist, und ich werde nicht zögern, alles zu tun, was dafür getan werden muss.
»Seht mich an!«, forderte Konrad den verblüfften Erzbischof von Trier auf und breitete die Arme aus.
»Ginge es nach der Erblinie, hätte niemand größeren Anspruch auf den Thron als ich. Geht es nach den Eigenschaften, die ein König und Kaiser vorweisen muss: Ich bin aus edlem Haus, bewährt als Herrscher und Kämpfer, Gott treu ergeben. Ich pilgerte ins Heilige Land. Neun Monate nach der Hochzeit gebar mir meine Gemahlin einen Sohn. Einen Sohn! Sie wird mir weitere schenken. Bei meiner Wahl zum König – fast auf den Tag genau vor zehn Jahren – stimmten die meisten Fürsten des Reiches für mich. Und doch wurde ich als Usurpator geächtet und gebannt. Unsere Rebellion scheiterte, mein Bruder und ich mussten uns unterwerfen. Barfuß und im Büßergewand vor dem gesamten Hof.«
Konrad ließ die Arme sinken und blickte dem Geistlichen ins Gesicht.
»Ihr seid ein weiser Mann, ein Vertrauter des Papstes. Sagt mir, Albero von Montreuil: Ist es Ehrgeiz, der mich treibt? Oder Rachsucht? Was eine Todsünde wäre. Ja, ich gestehe: Seit Jahren will ich die Schmach tilgen und meinem Haus endlich zu seinem rechtmäßigen Platz verhelfen.«
Er zögerte und legte die Stirn in Falten. »Doch ist es auch zum Besten des Reiches, was wir planen? Provozieren wir nicht einen erneuten Krieg? Riskiere ich eine zweite Niederlage?«
Ungeduldig schwenkte der Erzbischof die Hand, an der ein auffällig geformter goldener Ring mit einem dunkelblauen Saphir prangte.
»Krieg ist unausweichlich. Die Frage ist lediglich, wie lange und wie blutig er wird. Glaubt Ihr allen Ernstes, unter Heinrich dem Stolzen könnten friedvolle Zeiten anbrechen?«, fragte er zynisch. »Dann wäret Ihr ein Narr, und ich sollte sofort dieses Zelt verlassen.«
Verächtlich verzog Albero das Gesicht.
»Dieser Mann prahlt bei jeder Gelegenheit, sein Besitz reiche von Meer zu Meer, von Dänemark bis Sizilien, nachdem ihm sein Schwiegervater auch noch das Herzogtum Sachsen und die Toskana zuschanzte. Kein Fürst sollte über so viel Land herrschen. Zudem ist er erst siebenundzwanzig, jähzornig und maßlos. Vor allem aber war er so dumm, auf diesem Feldzug nicht nur die meisten der hochedlen Herren tödlich zu beleidigen, mich eingeschlossen, sondern sogar Seine Heiligkeit den Papst. Nun sagt frei heraus, Konrad von Staufen: Wünscht Ihr dem Reich einen solchen Mann auf dem Thron?«
Da keine Antwort kam, fuhr der Erzbischof unerbittlich fort: »Galt nicht sogar Lothar als Friedenskönig? Und wie viele Kriege haben wir unter seiner Regentschaft geführt? Seht Euch um!«
Mit dem rechten Arm beschrieb er einen Halbkreis, um das Heerlager im Schnee anzudeuten.
»Wir kommen gerade aus Apulien, wo wir die Normannen bekämpften, unsere Feinde erschlugen oder ihnen Ohren und Nasen abschnitten. Trotzdem konnten wir König Roger von Sizilien nicht in den Süden zurücktreiben. Dieser selbsternannte angebliche Papst Anaklet hält immer noch Rom besetzt und verwehrt dem wahren Papst den Zutritt zur Heiligen Stadt. Also müssen wir bald erneut über die Alpen ziehen.
Und an den östlichen Grenzen wird es stets Kriege mit den Slawen geben. Gerade erst sind Wirikinds Söhne in die Nordmark eingefallen. Sie haben ihren zum Christentum konvertierten Vater gestürzt, weshalb nun in Havelberg weiterhin Götzen angebetet werden. Der Bischof von Havelberg kann sein Bistum seit Jahren nicht betreten. Die Slawen werden jede Unruhe nutzen, um sich zu erheben. Vielleicht sogar mit einem großen Aufstand wie vor hundertfünfzig Jahren, als sie sich zum Lutizenbund zusammenschlossen und uns besiegten. Dafür muss sich nur ein Anführer finden, der alle Stämme eint. Sie herrschen doch längst wieder in einem breiten Landstrich zwischen unserem Reich und Polen, an Havel, Spree, Oder und Müritz.
Dies zu Eurer ersten Befürchtung. Krieg ist unausweichlich. Doch unter Heinrichs Herrschaft wird er viel blutiger werden. Die Liste seiner Gegner ist endlos. Und er ist zu anmaßend, um Frieden zu schließen, weil das nicht ohne Zugeständnisse geht.«
Albero trank einen Schluck von dem immer noch dampfenden Würzwein und lächelte zynisch.
»Aber es ehrt Euch, dass Ihr Euch um den Frieden des Reiches sorgt. Was nun Eure andere Befürchtung betrifft: Zweifellos war es für Euch und Euren Bruder außerordentlich demütigend, sich dem Kaiser zu Füßen zu werfen. Doch vertraut mir: Dergleichen wird von den Betroffenen überbewertet.«
Der Erzbischof strich sein welliges graues Haar zurück und begann genüsslich aufzuzählen.
»Vor Euch musste sich Lothar dem Kaiser Heinrich dem Fünften zu Füßen werfen und um Vergebung flehen. Heinrich wiederum, nachdem er seinem Vater den Thron geraubt hatte, war gezwungen, dem Papst so große Zugeständnisse einzuräumen, dass er sich vermutlich lieber vor ihm in den Staub geworfen hätte. Und von Kaiser Heinrich dem Vierten, Eurem Großvater mütterlicherseits, und seinem Bußgang nach Canossa werden die Menschen wohl noch in vielen Jahren reden. Also befindet Ihr Euch in äußerst erlauchter Gesellschaft. Und Ihr musstet nicht einmal drei Tage barfuß im Schnee stehen. Was einzig zählt: Mit dieser Geste, so unerfreulich sie Euch in jenem Moment auch vorgekommen sein muss, habt Ihr die Macht und die Ländereien Eures Hauses bewahrt. Womit Ihr der Gewinner des Handels seid.«
Albero von Trier trank seinen Becher leer.
»Der Papst will Euch als König sehen. Dessen könnt Ihr sicher sein nach all den Unverschämtheiten, die sich der Welfe gegen Seine Heiligkeit herausgenommen hat. Papst Innozenz ernannte mich zu seinem Legaten in deutschen Landen und wünscht, das ich mit allen Mitteln für Eure Inthronisierung sorge. Euer ärgster Feind, der Erzbischof von Mainz, hat unlängst das Zeitliche gesegnet, ebenso der Erzbischof von Köln. Das räumt uns einige … spezielle Möglichkeiten ein.«
Das joviale Lächeln auf Alberos Gesicht wich grimmiger Entschlossenheit.
»Vertraut auf Gott, und vertraut auf meinen Plan! Er ist so fein gesponnen, dass der vermeintlich nächste König längst im Schach steht, ohne es zu ahnen. Wir dürfen nur der Kaiserinwitwe keine Gelegenheit geben, die Fürsten des Ostens auf ihren Schwiegersohn als Herrscher einzuschwören. Also muss die Fürstenversammlung in Quedlinburg um jeden Preis verhindert werden. Und dann schaffen wir Tatsachen.«
Alles war sorgfältig geplant und vorbereitet, seine Verbündeten und Mittelsmänner warteten nur auf sein Zeichen.
»Um jeden Preis?«, widersprach Konrad heftig. »Soll ich meine Herrschaft auf eine solche Schurkerei gründen, wie Ihr sie plant? Ist das etwa mit ritterlicher Ehre vereinbar?«
Der Geistliche stieß einen ungeduldigen Laut aus und verdrehte die Augen.
»Durchlaucht, sagt mir eines: Wollt Ihr auf den Thron?«
Er legte eine bedeutungsschwere Pause ein, doch es kam keine Antwort.
»Dann blickt der Tatsache ins Auge, dass noch niemand im Stande reinster Unschuld dorthin gelangt ist. Ausgenommen Kindkönige, denen höchst selten ein langes Leben beschieden ist, geschweige denn eine lange Regentschaft. Wer herrschen will, der muss es auch wirklich wollen – und zwar wollen um jeden Preis. Der muss sich den Thron erkämpfen, mit allen Mitteln. Tut es, tut es zum Besten des Reiches! Oder geht unter in welfischer Vorherrschaft. Dann allerdings rate ich Euch zum Exil. Und ich fürchte, selbst dort könnte Euch ein plötzlicher Tod ereilen.«
Er studierte Konrads Miene und meinte sarkastisch: »Wenn Ihr jetzt den Kampf aufnehmt, müsst Ihr Euch nicht einmal selbst die Hände schmutzig machen und erneut Acht und Bann riskieren. Das nimmt der Markgraf der Nordmark mit Freuden auf sich.«
»Albrecht der Bär.«
Der Erzbischof von Trier verzog spöttisch die Mundwinkel. »Ein Recke vom alten Schlag. Der Bär ist der Einzige, der keine Scheu hat, sich offen mit dem mächtigsten Fürsten des Kaiserreichs anzulegen. Er hasst den Welfen. Und er will das Herzogtum Sachsen. Das könnt nur Ihr ihm geben, sobald Ihr König seid.«
… und es dem Welfen wegnehmt … unter einem Vorwand, den wir schaffen werden, dachte Albero den Satz zu Ende.
»Wir brauchen die Reichsinsignien«, brachte Konrad als letzten Einwand vor.
Da wusste Albero, dass er gewonnen hatte. Doch er verbarg seinen Triumph und zuckte gespielt gleichgültig mit den Schultern.
»Der Welfe wird sie schon herausrücken, wenn es so weit ist. Und falls nicht: Was ist eine Krone? Ein Klumpen Gold, eine Handvoll Edelsteine … Jeder halbwegs begabte Goldschmied wird Euch gern eine neue fertigen, eine schönere.«
Konrad von Staufen fuhr zusammen und starrte ins Leere, als habe er einen Geist gesehen. Sein Vertrauter am Eingang des Zeltes bemerkte das, und nun wirkte auch er höchst besorgt.
Konrad atmete tief durch und traf seine Entscheidung.
»Schickt Euern Boten zum Bären, Exzellenz! Und tut hier und in Würzburg, was Ihr für unsere Sache zu tun vermögt. Gott steh uns bei!«
Der Erzbischof von Trier erhob sich lächelnd zum Gehen. »Das wird er, mein Freund. Das wird er.«
Reglos und grübelnd sah Konrad dem Gottesmann nach.
Dieser Entschluss konnte ihm und seinem Haus größten Ruhm oder völlige Vernichtung bringen. Was hatte ihn getrieben? Ehrgeiz? Der Wunsch nach Rache? Oder die Überzeugung, der bessere Mann auf dem Thron zu sein?
Auf sein Zeichen trat der grauhaarige Ritter näher, der am Eingang des Zeltes gewacht hatte: sein engster Vertrauter und Ratgeber, langjähriger Kampfgefährte in Siegen wie Niederlagen. Ein Mann aus bescheidenen Verhältnissen, den er für seinen Mut in den Ritterstand erhoben hatte – auch für den Mut, ihm gegenüber unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Sein Gesicht war schmal und beherrscht, seine Augen graugrün. Einer alten Verwundung wegen zog er sein rechtes Bein leicht nach.
»Vertraut auf Gott!«, ermutigte Ulrich von Lauterstein seinen Fürsten. »Vertraut auf Gott und den Erzbischof von Trier; ein mächtiger Mann und ein …«, er suchte nach einem passenden Wort und formulierte vorsichtig, »… äußerst einfallsreicher Diplomat. Sogar der Papst steht auf Eurer Seite!«
Doch dann furchte Ulrich die Stirn und fragte skeptisch: »Was wird er dafür fordern? Wenn Euch die Kirche auf den Thron bringt, dann nicht um Gottes Lohn, sondern für Zugeständnisse. Land und Macht und Unterwerfung.«
»Das habe ich durchaus bedacht!«, entgegnete Konrad scharf.
»Ich werde kein Pfaffenkönig wie Lothar. Königtum und Kirche müssen gleichberechtigt sein. Doch die Kirchen brauchen den Schutz des Königs, und dafür werde ich sorgen.«
Der Lautersteiner nickte bedächtig, dann räusperte er sich. »Um des Eides willen, den ich Euch leistete: das schützende Schwert im Kampf zu sein und der Ratgeber, der mahnt, wo andere schmeicheln …«
»Welche Mahnung wollt Ihr diesmal aussprechen, Ulrich, welche von vielen?«, fiel ihm Konrad sarkastisch ins Wort.
Nun senkte der Lautersteiner die Stimme.
»Ich beschwöre Euch: Vertraut auf Gottes Gerechtigkeit und auf Euch selbst. Doch verbannt die letzte Nacht aus Euren Gedanken!«
Er sah in das Gesicht seines Fürsten und rief bestürzt, aber immer noch leise: »Ihr werdet doch nichts geben auf die Einflüsterungen einer Hexe, die für einen halben Pfennig sagt, was immer Ihr hören wollt? Ihre Worte sind Lug und Trug. Und es könnte Euch den Vorwurf heidnischen Aberglaubens einbringen, wenn es sich herumspricht.«
»Ist nicht sogar dem berühmten, heiligmäßigen Bernhard von Clairvaux eine große Zukunft vorhergesagt worden?«, widersprach Konrad.
»Von einem Seher, einem Mann der heiligen Mutter Kirche, dem die Gnade einer göttlichen Vision zuteil wurde«, erinnerte Ulrich heftig. »Und nicht von einer Hexe, die im Tross mit den billigsten Huren zieht und Männern ein langes Leben vorhersagt, die noch am gleichen Tag im Kampf fallen.«
»Ich will davon nichts hören. Lasst mich allein!«, wehrte Konrad ab.
Widerstrebend ging Ulrich von Lauterstein hinaus, nachdem er sich verneigt hatte. Er wusste, dass er jetzt nichts ausrichten konnte. Nun war er doppelt froh, vorige Nacht der Alten gefolgt zu sein. Er hatte ihr ein paar Hälflinge gegeben und gedroht, ein einziges Wort über diesen Vorfall wäre ihr Tod.
»Sind das Feuer niedergebrannt und die Runen aufgesammelt, so sind auch die Worte verhallt und vergessen«, hatte sie völlig unbeeindruckt gekrächzt.
Hätte er sie besser töten sollen? Die Alte wirkte schlau genug, sofort zu verschwinden und zu schweigen, selbst ohne seine Drohung …
Doch Konrad würde ihre Worte nicht vergessen. Jetzt nicht mehr, nicht nach dieser Bemerkung des Erzbischofs.
Natürlich wusste Konrad, dass Ulrich mit seiner Mahnung recht hatte. Es war Ausdruck seiner tiefen Verunsicherung vor dem schicksalhaften Entschluss gewesen, dass er gestern Nacht heimlich diese halbblinde Frau in sein Zelt bringen ließ, von der man im Heerlager munkelte, ihre Prophezeiungen würden stets in Erfüllung gehen, wenn auch manchmal anders als erwartet. Ein dürres Weib, in Lumpen gehüllt, die nach Schweiß und beißenden Kräutern stanken. Nie zuvor wäre ihm jemals in den Sinn gekommen, so etwas zu tun oder auch nur zu erwägen.
Sie hatte ein paar Knochen mit eingeritzten Runen auf den Boden geworfen, sie lange betrachtet und ihn dann mit stechendem Blick gemustert. Eines ihrer Augen war milchig trüb, das andere leuchtend blau.
Und dann hatte sie jene rätselhaften Sätze gemurmelt, nach denen er die Frau nur noch loswerden wollte. Er bot ihr Silber zum Lohn, doch sie lehnte ab.
»Was soll ich mit Silber, edler Herr?«
Stattdessen erbat und erhielt sie eine tote Taube.
Kaum war sie fort, hatte er sich einen Narren gescholten.
Bis eben.
Bis zu jenem Augenblick, als Albero von Trier verkündete: »Dann fertigen wir Euch eine neue Krone, eine schönere.«
Ein Schauer lief ihm über den Rücken, weil die Worte der Alten seitdem erneut durch sein Gehirn loderten:
»Ihr werdet eine Krone tragen, doch nicht Lothars.«
Konnte sie tatsächlich in die Zukunft blicken?
Wider Willen musste Konrad auch über ihre beiden anderen Vorhersagen nachgrübeln.
»Ihr werdet ein Heer zum Mittelpunkt der Welt führen und doch Euer Ziel nicht erreichen«, lautete die zweite.
Welchen Sinn sollte das ergeben? Jerusalem war der Mittelpunkt der Welt. Seit fast vierzig Jahren befand es sich in christlicher Hand. War die Heilige Stadt in Gefahr?
Und zum Schluss hatte sie gekrächzt: »Viele Jahre werdet Ihr herrschen, länger als Lothar. Aber der junge Falke, den man Rotbart nennen wird, wird dereinst all Euren Ruhm überstrahlen. Um seinetwillen wird man Euch vergessen.«
Die Purpurgeborenen
Sven und Friedrich – der Sohn des Königs von Dänemark und der Sohn des Herzogs von Schwaben; Heerlager in Breitenwang, 4. Dezember 1137
Die Knappen des staufischen Heereskontingentes übten seit Stunden unter den strengen Blicken ihres Lehrmeisters das Entwaffnen eines Gegners nach Angriff mit dem Schwert. Trotz der Kälte rann jedem von ihnen unter dem dicken Gambeson der Schweiß den Rücken hinab. Mancher hielt sich vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen. Und so hofften all diejenigen erleichtert auf eine Pause, die aus dem Augenwinkel beobachteten, wie ein Vertrauter Fürst Konrads zu ihrem Waffenmeister trat und ihm mit ernster Miene leise etwas ausrichtete.
Der schloss für einen Moment die Augen und bekreuzigte sich. Dann wandte er sich wieder seinen Schützlingen zu und brüllte donnernd: »Senkt die Waffen und kniet nieder!«
Sofort gehorchten die Burschen, die zwischen vierzehn und zwanzig Jahre alt waren.
»Unser Kaiser Lothar, Kaiser von Gottes Gnaden und Mehrer des Reiches, ist gestorben. Gedenkt seiner in stiller Trauer und mit einem Gebet für das Heil seiner unsterblichen Seele.«
Die Jungen senkten die Köpfe, falteten die Hände und beteten stumm, bis der Waffenmeister »Amen!« sagte und sie im Chor die beiden Silben wiederholten.
Dann erhoben sie sich auf das Zeichen des ergrauten Kämpfers.
Der fuhr nun wieder in seiner üblichen Schroffheit fort: »Bevor ihr Dummköpfe euch die Mäuler zerreißt über Dinge, von denen ihr nichts versteht, sollt ihr Folgendes wissen: Der Kaiser – Gott sei seiner Seele gnädig – hat noch auf dem Totenbett seinen Schwiegersohn Herzog Heinrich aus dem Hause Welf zum Erben des Throns bestimmt.«
Diese Ankündigung bewirkte, dass sämtliche Knappen schlagartig den Blick auf einen Sechzehnjährigen mit rotgoldenen Haaren richteten; fragend, schadenfroh oder betroffen.
Doch der Schwertmeister unterband jede weitere Reaktion, indem er sofort und sehr bestimmt weitersprach:
»Wenn ein Kaiser stirbt, verharrt die Welt ihm zu Ehren für einige Zeit. Deshalb werdet ihr Burschen diesen Tag dem traurigen Ereignis angemessen verbringen, und zwar mit Beten und Fasten. Das heißt: kein Waffengeklirr, kein dummes Geschwätz und vor allem keine heimlichen Besuche bei den Trosshuren! Beten und Fasten, habe ich mich klar ausgedrückt?«, wiederholte er, als er die Reaktionen auf seine letzte Anweisung in den Gesichtern der Älteren sah.
Ein einstimmiges, wenn auch zurückhaltendes »Ja, Herr!« kam als Antwort.
»Sollte ich jemanden erwischen, der sich nicht daran hält, wird er bis zu unserer Rückkehr nach Franken Tag und Nacht Rost von den Kettenhemden scheuern«, fuhr der Schwertmeister fort. Eine schlimme Drohung, denn im Schnee war es unmöglich, die Kettenhemden und alles andere aus Eisen Gefertigte frei von Rost zu halten.
»Da jedoch die Pferde und die Pferdediebe nichts davon wissen, dass die Welt stillsteht, wenn ein Kaiser stirbt, werden die Purpurgeborenen« – das sagte er ironisch und deutete auf zwei Knappen, deren Kleider und Waffen von auffallend guter Qualität waren – »die Wache an der südlichen Koppel übernehmen.«
Die beiden Abkommandierten, der Bursche mit den Locken in Rotgold und einer mit glattem blondem Haar, verneigten sich, nahmen ihre Waffen auf und liefen los.
Schneeballen fielen klatschend von den überladenen Ästen und überstäubten die zwei künftigen Ritter weiß, als sie zur Koppel am Rande des Lagers gingen. Keiner von ihnen verlor ein Wort über das spöttische purpurgeboren. Sie waren es, und sie trugen die Namen ihrer mächtigen Väter.
Der hochgewachsene Blondschopf von siebzehn Jahren war der Sohn des Dänenkönigs Sven, der Sechzehnjährige mit dem rötlichen Haar der Sohn eben jenes Herzogs von Schwaben, der dreizehn Jahre zuvor König werden sollte. Außerdem war der junge Friedrich der Neffe Konrads von Staufen und des Welfen Heinrich, der nun König werden sollte.
Der Waffenmeister forderte sie noch härter als alle anderen, denn als künftige Herrscher mussten sie in der Schlacht an der Spitze reiten und überleben. So hatten sie noch mehr Beschimpfungen als die übrigen Knappen ob ihrer vermeintlichen Unfähigkeit zu erdulden. Trotzdem konnte er ihnen einen gewissen Respekt nicht verwehren.
Erst als sie außerhalb seiner Sicht- und Hörweite waren, sagte Sven aus dem Hause Estridson: »Der alte Schinder will uns von den anderen trennen und verhindern, dass Gerüchte aufkommen.«
»Kann er verhindern, dass die Sonne auf- und untergeht?«, spottete Friedrich.
»Ihm traue ich das zu«, meinte der junge Däne grinsend. »Seit Tagen plage ich mich mit diesem Entwaffnungsmanöver. Bei ihm sieht das so aus, als wäre es nichts weiter als eine Bewegung aus dem Handgelenk.«
»Ist es auch«, versicherte der junge Staufer. »Ich würde es dir ja zeigen, Bruder Ungeschickt …«
Sie sprangen über einen Bach, der zwischen eisverkrusteten Rändern strudelte.
»Ungeschickt?«, fiel ihm Sven ins Wort. »Dich möchte ich sehen, wie du ein Schiff steuerst!«
»Wir wissen alle, das liegt dir im Wikingerblut. Doch ich habe nicht vor, unter die Seeräuber zu gehen«, spottete sein Freund weiter. »Ich könnte dir diese Entwaffnung im Nu beibringen. Aber Waffenübungen sind uns heute ausdrücklich verboten.«
Im Lager ging es tatsächlich ungewöhnlich still zu: kein Schwertergeklirr, keine Streitereien, kein Gebrüll bis auf die Schmerzensschreie der Verwundeten. Abgesehen von den Wachen ließ sich kaum jemand blicken.
»Ja, Kämpfe, Weiber und Geschwätz«, zählte Sven auf und rollte die Augen. »Glaubst du, dass sich alle daran halten und den Trosshuren fernbleiben?«
Friedrich stieß einen belustigten Laut aus. »Wie oft denkst du hier an ein hübsches junges Mädchen, an ihre Brüste und wie du bei ihr liegst?«
»Jeden Morgen beim Aufwachen, jeden Abend beim Einschlafen und die ganze Zeit dazwischen.«
»Da hast du die Antwort.«
Sven prustete verächtlich. »Was jetzt noch an Trossweibern übrig ist … Lieber schwöre ich Enthaltsamkeit, bis wir wieder in einem Ort mit einem Hurenhaus sind.«
Friedrich befürchtete schon, der Freund würde ihm nun zum hundertsten Mal von der Frau seiner Träume vorschwärmen, die unbedingt schwarze Locken haben sollte. Die hübschen Mädchen in Italien hatten es dem hochgewachsenen Dänen angetan.
Er selbst ersehnte sich eine zierliche Schönheit mit rotgoldenem Haar wie seines. Doch beide würden sie einmal irgendeine reiche Erbin heiraten müssen, die ihre Väter ohne Rücksicht auf ihre Wünsche für sie bestimmten. Deshalb verspürte er nicht die geringste Lust auf dieses Thema.
Inzwischen hatten sie die kleine, mit Seilen abgetrennte Koppel erreicht, auf der ein paar Pferdeknechte striegelten, fütterten oder mit Holzschaufeln den Schnee beiseiteräumten. Die Stallburschen verneigten sich tief vor ihnen und erwarteten Befehle, doch die hochgeborenen Knappen ließen sie einfach ihre Arbeit machen.
Entlang der Koppel schlängelte sich ein weiteres Bächlein mit eisverkrusteten Rändern.
Die Knappen suchten sich eine Erhebung, von der sie einen guten Überblick über das Gelände hatten. Inzwischen schneite es nicht mehr, die Luft war klar und kalt. Sie konnten von weitem sehen, wenn sich jemand näherte, der nichts bei den Pferden zu suchen hatte. Wer von den Bergen hinabstieg, löste unweigerlich eine Lawine aus, die ihn verriet. Und selbst die hungrigsten Wölfe würden um so eine Menschenansammlung einen großen Bogen machen.
»Hier können wir unbelauscht reden«, konstatierte Sven zufrieden, nachdem sie die Umgebung geprüft und Stellung bezogen hatten.
»Genau deshalb hat er uns als Wache eingeteilt«, versicherte Friedrich.
»Er will dich schützen«, meinte sein dänischer Freund. »Es wird eine Menge Tumult geben nach dieser Ankündigung, nicht nur im staufischen Lager.«
Sven sog tief Atem ein und witterte übertrieben. »Kannst du es riechen? Veränderung liegt in der Luft. Nicht jeder wird hinnehmen, dass Kaiser Lothar den hochmütigen Welfen zum Nachfolger erklärte. Sicher werden längst Pläne geschmiedet, um deinen Oheim Konrad auf den Thron zu bringen. Aber was auch geschieht und wie es auch ausgeht: Jedermann sieht, du bewachst hier die Koppel und bist nicht daran beteiligt.«
»Ja, er will mich schützen«, stimmte Friedrich zu. »Dich übrigens auch. Und ehe du fragst: Ich bin nicht in die Pläne meines Oheims einbezogen. Falls er überhaupt beabsichtigt, Lothars Entscheidung anzufechten.«
»Natürlich wird es Krieg um den Thron geben!« Sven prustete. »Und das nur, weil ihr euern König wählen wollt! Das gibt es bei uns Dänen nicht. Mein Vater wurde im Herbst getötet, und da ich noch zu jung bin, übernahm mein Oheim Erik als ältester lebender Verwandter den Thron. Aber sobald meine Zeit gekommen ist, werde ich König. Mein Vetter Knud wird das natürlich anfechten und wieder einmal behaupten, ich sei ein Bastard und kein Estridson. Doch solange ich nicht morgen sterbe oder ins Kloster eintrete – und ich versichere dir, keins von beidem liegt in meiner Absicht –, werde ich Vater auf dem Thron folgen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.«
»Ist die Welt bereit für einen Dänenprinzen?«, spottete Friedrich.
»Die Frage scheint mir derzeit eher: Ist sie bereit für einen Stauferkönig?«, konterte Sven.
Sein Freund schwieg; er wollte ganz offensichtlich nicht über dieses Thema sprechen. Doch der Ältere ließ nicht locker.
»Du hast mir nie erzählt, warum dein Vater vor dreizehn Jahren nicht König wurde.«
»Es weiß doch jeder«, antwortete Friedrich, der ewige Spötter, ungewohnt schroff.
»Was jeder weiß, ist Gossengeschwätz«, meinte Sven verächtlich und prustete erneut. »Ich kenne ein Dutzend Versionen der Geschichte, ganz abgesehen von der offiziellen, die von den Feinden eures Hauses erzählt wird und der man deshalb nicht trauen darf.«
Friedrich versank in Gedanken. Dann endlich gab er sich einen Ruck.
»Wir reden nicht darüber in der Familie. Es ist … zu demütigend. Und ich war noch Kind, als es geschah. Jahre später, kurz bevor ich als Knappe an den Hof meines Oheims ging, rief mein erlauchter Vater mich zu sich. Er sagte: ›Ich werde dir diese Geschichte nur einmal erzählen. Also präge sie dir gut ein!‹«
Vater fühlt sich immer noch gedemütigt, dachte Friedrich. Und als er ein Auge verlor, musste er die letzte Hoffnung auf den ihm gebührenden Platz aufgeben.
Er richtete den Blick auf eine Krähe, die laut krächzend von einem Ast aufflog, sich am Rand der Koppel niederließ und auf etwas einhackte, während er scheinbar gleichmütig erzählte, als ginge ihn die Geschichte nichts an.
»Vor dreizehn Jahren starb kinderlos Kaiser Heinrich, der fünfte und letzte aus dem Geschlecht der Salier. Mein Vater war sein Neffe und rechtmäßiger Erbe. Heinrichs Witwe übergab die Reichsinsignien dem Erzbischof von Mainz. Doch Adalbert von Mainz intrigierte und präsentierte zu aller Erstaunen plötzlich zwei weitere Kandidaten. Von jedem Thronanwärter verlangte er den Eid, sich dem anderen zu unterwerfen. Mein erlauchter Vater weigerte sich, und in seiner Abwesenheit wählten die Fürsten Lothar, der sich so demütig gegeben hatte, wie sie es wünschten.«
»Ich hörte von üblen Tumulten bei dieser Wahl«, warf Sven ein.
»So übel und würdelos, dass mein erlauchter Vater den Saal verließ. Das kostete ihn den Thron. Das und der Seitenwechsel meines welfischen Großonkels, des Bayernherzogs Heinrich des Schwarzen. Zum Lohn durfte Heinrich seinen Sohn mit Lothars Tochter Gertrud vermählen. Als Schwiegersohn des Kaisers erhielt dieser dann noch Sachsen und die Toskana. Und jetzt die Krone.«
»Noch sitzt er nicht auf dem Thron, den ihm sein Vater mit Verrat erkaufte«, widersprach der künftige Dänenkönig.
Eine Weile herrschte Stille.
Bis der junge Staufer bitter fragte: »Sollten wir heute nicht ein paar ehrende Worte für den toten Kaiser finden? Ich kann es nicht. Nicht nur, weil er meinen Vater um seinen legitimen Anspruch brachte. Lothar hat sich dem Papst unterworfen, und das ist unverzeihlich. Weltliche und geistliche Herrschaft müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Als Lothar freiwillig das Pferd des Papstes am Zügel führte und ihm sogar den Steigbügel hielt, befleckte er seine Ehre und die des Reiches.«
»Er bezeichnete es als Geste der Höflichkeit«, erinnerte Sven, obwohl er die Meinung seines Freundes teilte.
»Es wird immer als Unterwerfung interpretiert werden. Kein Kaiser darf sich so entwürdigen.«
»Und wenn der Papst mit Exkommunikation droht? Was würdest du als Kaiser dann tun?«
Nun grinste Friedrich. »Einen Gegenpapst einsetzen lassen.«
»Wird dein Oheim Konrad gegen den Welfen antreten und auf einer Wahl bestehen?«, bohrte Sven weiter.
»Ich bin Knappe, er weiht mich nicht in seine Pläne ein«, wiederholte Friedrich streng. »Und mein Vater ist in Schwaben, er beteiligt sich nicht an diesem Feldzug.«
»Keiner kann deinem Vater verübeln, dass er sich von dem Süpplingenburger fernhält. Dein Oheim wird den Welfen herausfordern. Es wäre eine Schande, wenn er es nicht wagte«, sinnierte der Ältere. »Die Fürsten haben ihn doch schon einmal gewählt.«
»Zum König, der gegen einen bereits gekrönten Rivalen antreten musste! Das ist etwas anderes. Lothar geriet mit meinem Vater schnell in Streit über Ländereien, die er als Reichsgut an den König abzugeben hätte. Als Vater Verhandlungen ablehnte, schlug ihn Lothar von Süpplingenburg in Acht und Bann. Also wählten die Anhänger unseres Hauses meinen Oheim Konrad zum rechtmäßigen König, der gerade erst von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land zurückkam und Lothar noch keinen Eid geschworen hatte. Nach zehn Jahren erbitterter Kämpfe mussten sie sich Lothar unterwerfen.«
Ganz unmissverständlich wollte er das Thema abschließen. Doch Sven wagte noch einen Vorstoß. »Du warst fünf oder sechs Jahre alt, als der Krieg begann. An einiges musst du dich doch erinnern.«
»Und dass sich mein Vater unterwerfen musste, ist erst drei Jahre her. Ich hab’s nicht vergessen«, meinte Friedrich grimmig. »Wie sie dir nachreden, ein Bastard zu sein, war ich erst der Sohn eines Geächteten, dann der eines Besiegten und Gedemütigten. Auch wenn uns der alte Schinder höhnisch die Purpurgeborenen ruft.«
Er starrte auf die feinen Schneewirbel, die der Wind in den Böschungen aufwehte.
»Ich erinnere mich noch an Speyer. Lothar belagerte die Stadt vor acht Jahren, und mein erlauchter Vater hatte Mutter und mich dort zurückgelassen, damit Speyer den Staufern die Treue hielt. Wir hungerten. Ich zwar kaum, denn meine Mutter schob mir fast jeden Bissen zu, der für sie bestimmt war. Doch sogar sie als Herzogin litt und magerte ab bis auf die Knochen. Sie hat sich nie davon erholt. Ich denke, letzten Endes starb sie daran. Daran … und an der Demütigung ihres Gemahls.«
»Aber deine Mutter war Welfin, eine Schwester Heinrichs des Stolzen, und der gehörte zu den Belagerern Speyers!«, rief Sven.
»Was uns letztlich rettete. Mein welfischer Oheim, der jetzt König werden soll, sorgte dafür, dass uns sehr großmütige Abzugsbedingungen eingeräumt wurden.«
Nach kurzem Schweigen sagte er: »Familie ist wichtig. Verwandtschaftliche Bindungen sind stärker als alle Fehden.«
Sven ließ die Worte auf sich wirken und beschäftigte sich eine Weile mit seinem Bogen, bis er eine passende Antwort gefunden hatte.
»Ganz gleich, wie sich die Dinge entwickeln: Du wirst der Neffe des künftigen Königs sein – ob es nun Heinrich aus dem Hause Welf oder Konrad aus dem Hause Staufen sein wird. Beider Frauen heißen Gertrud, also wird es eine Königin Gertrud geben, so viel ist auch sicher. Und von jetzt an wird es niemand mehr wagen, dich den Sohn eines Geächteten zu nennen. Die das taten, werden bald vor dir zur Kreuze kriechen. Genieße den Anblick! Von nun an bist du der Neffe des Königs.«
»Ich bin der Sohn des Herzogs von Schwaben. Und ich werde einmal Herzog von Schwaben sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger«, stellte Friedrich klar. Zorn und Stolz flammten über sein Gesicht. »Alle, die einst verächtlich auf mich herabsahen, all jene, die gegen mein Haus kämpften, werde ich lehren, den Namen Friedrich von Staufen mit Furcht und Ehrerbietung auszusprechen!«
Sven musterte ihn nachdenklich. »Ja, das wirst du«, sagte er nach einem Moment des Schweigens voller Überzeugung.
»Gehen wir zur Koppel«, schlug er dann vor, um den Freund auf andere Gedanken zu bringen. Die Neuigkeiten des Tages mussten ihn aufgewühlt haben. Einige Zeit bei den Pferden würde ihm gut tun. Friedrich war nicht nur ein exzellenter Reiter; die Pferde schienen ihn zu lieben.
Als sie auf die Koppel zuliefen, näherten sich ihnen sofort ein paar Stuten und Hengste.
Das Heer hatte sehr viele Reittiere in den Kämpfen und auf dem Rückzug über die verschneiten Bergpässe verloren. Die Übriggebliebenen waren schlecht ernährt und struppig. Futter war hier um diese Jahreszeit noch schwerer aufzutreiben als Essen für die Männer.
Zufrieden sah Sven, dass der Gefährte endlich wieder zu lächeln begann, während er einer Fuchsstute über die Nüstern strich und auf sie einsprach. Dann ließ er seinen Blick prüfend über die Landschaft schweifen.
»Nirgendwo ein Feind zu sehen«, meinte er und konnte das Spotten einfach nicht lassen. »Kein Wunder, denn die feindlichen Parteien sitzen alle dort in den Zelten, und wir wissen genau, in welchen. Ich bin gespannt, wie und wann sie die Sache zugunsten deines Hauses deichseln.«
Friedrich wandte sich zu ihm um und gab die gespielte Gleichgültigkeit auf.
»Nicht hier. Ich denke, es wird erst nach unserer Rückkehr geschehen. Sie brauchen die Fürsten des Westens und des Südens.«
»Glaubst du, es gibt offenen Krieg?«
»Mein welfischer Oheim hat sich viele hohe Geistliche zum Feind gemacht. Denen würde ich eher eine List zutrauen.«
»Aber früher oder später muss sich jemand ganz offen der Kaiserinwitwe und ihrem Schwiegersohn entgegenstellen«, beharrte Sven. »Wer wird es wagen, als Erster das Schwert gegen den mächtigsten Mann im Reich zu ziehen?«
»Wer ist der größte Haudrauf unter den Fürsten?«, fragte Friedrich zurück.
Einstimmig antworteten sie: »Albrecht der Bär.«
»Und er ist dem Welfen spinnefeind. Doch der Bär kämpft jetzt irgendwo weit im östlichen Grenzland gegen Wirikinds Söhne, die in seine Nordmark eingefallen sind«, wandte der dänische Kronprinz ein.
Friedrich von Staufen lächelte kühl. »Davon wird er sich nicht lange aufhalten lassen.«
Der Bär
Markgraf Albrecht von Ballenstedt; Prignitz, im Grenzgebiet von Nordmark und Slawenland zwischen Brandenburg und Schwerin, Anfang 1138
Uaaah!«
Brüllend ließ Albrecht der Bär, der hünenhafte Markgraf der Nordmark, sein Schwert niederfahren. Mit einem Hieb schlug er dem vor ihm knienden Anführer des slawischen Kriegertrupps den Kopf ab.
»Das wird euch Heidenpack lehren, in mein Land einzufallen!«, wütete er, während das Blut des Hingerichteten dampfend in den Schnee strömte und ihn rot färbte. »Fahr zur Hölle mitsamt deinem dreigesichtigen Götzen!«
Schwer atmend ließ der Markgraf das Schwert sinken.
»Brennt das Dorf nieder!«, befahl er.
Sein Marschall trat näher und räusperte sich.
»Dieses Dorf gehört Euch, mein Fürst.«
Der Bär blinzelte. Erst jetzt wich der Rausch des Kampfes von ihm.
Er ließ seinen Blick über den zerstörten Weiler schweifen, dessen Bewohner beim Einfall der Slawen in den Wald geflohen waren. Die verkohlten Überreste der Hütten am Dorfrand schwelten noch, die Katen in der Mitte waren verwüstet oder zerstört. Überall lagen Tote, denen seine Männer nun Schuhe und Waffen abnahmen. Die gefangenen Slawen – oder Wenden, wie die meisten Christen sie nannten – wurden zusammengetrieben und in Fesseln gelegt. Ein schwer verwundeter Gefangener brüllte vor Schmerz und stieß in seiner Sprache Verwünschungen aus, bis ihm einer von Albrechts Rittern die Kehle durchschnitt, ob nun aus Zorn oder Gnade. Jäh erstarb das Geschrei.
»Schickt ein paar Männer in den Wald zu den Dörflern, um ihnen zu sagen, dass sie zurückkehren und ihre Häuser wieder aufbauen können«, änderte der Markgraf der Nordmark seinen Befehl.
Der Marschall gab die Order weiter, dann schnitt er ein Stück vom Umhang des Hingerichteten und reichte es dem Fürsten, damit dieser seine Waffe säubern konnte.
Albrecht der Bär, ein vor Kraft strotzender Mann von knapp vierzig Jahren, gab sein Schwert nie aus der Hand, außer wenn es zum Schmied musste. Mehrmals fuhr er mit dem Wollfetzen über die Klinge, dann warf er ihn achtlos fort und schob die Waffe zurück in die Scheide. Das Ziegenhaar an deren Innenseite würde die Reste des Blutes vom Eisen schmirgeln.
Seit Wochen schon musste er mit seinem Heerbann im östlichen Grenzland kämpfen, weil slawische Krieger auf breiter Front eingedrungen waren, um ihr einstiges Land zurückzuerobern.
Auf dem Pfad zum Dorf näherte sich ein berittener Bote. Der Schnee dämpfte den Hufschlag, dafür zeichneten sich Pferd und Reiter deutlich gegen das Weiß der Landschaft ab.
Der Markgraf lächelte erleichtert, als er das Gesicht des Mannes erkannte, denn es verhieß gute Neuigkeiten.
Was für ein denkwürdiger Tag! Erst hatten sie die eingefallenen Wenden im blutigen Kampf besiegt, und nun …
Doch er wagte den Satz nicht zu Ende zu denken, bevor die Kunde ausgesprochen war. So etwas brachte Unheil. Rasch bekreuzigte er sich.
Der Bote stieg in aller Hast vom Pferd und lief seinem Fürsten mit eiligen Schritten entgegen. Die Ritter der Leibwache machten bereitwillig Platz, denn sie hofften mit ihrem Gebieter auf die Nachricht, die er bringen würde.
»Durchlaucht, Eure Gemahlin sendet Euch ergebene Grüße«, sagte er atemlos, während er auf ein Knie sank.
»Ja, und weiter?«, drängte der Bär ungeduldig.
»Ihr habt einen Sohn! Eure Gemahlin hat Euch einen weiteren Sohn geboren!«, rief der junge Reiter und strahlte, als hätte er einen Sohn bekommen.
»Sind die Fürstin und das Kind bei guter Gesundheit?«
»Ja, mit Gottes Hilfe!«, versicherte der Bote.
»Der Herr sei gepriesen!«, stieß Albrecht erleichtert hervor.
Sein Marschall ließ die Männer einen Hochruf auf das Neugeborene ausbringen, den siebenten Erben ihres Herrschers, dann sprachen sie gemeinsam ein Gebet.