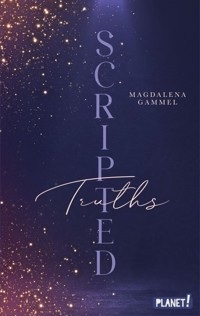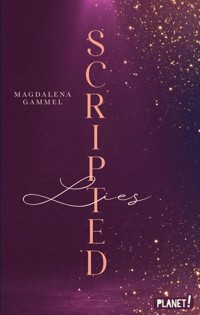
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Licht, Kamera, Action! Für Indigo wird ein Traum wahr, als sie im letzten Film der berühmten Drehbuchautorin Rosaly Everson mitspielen darf. Und Ablenkung kann Indigo nach dem Tod ihrer Mutter gut gebrauchen. Merkwürdig ist allerdings, dass auf der Beerdigung zwei attraktive Fremde eine kryptische Warnung aussprechen und Indigo Briefe mit Rätseln erhält, die die Vergangenheit ihrer Mutter infrage stellen. Am ersten Tag am Set trifft sie Avian und Julius, die neuen Sterne am Film-Himmel. Und ebenjene Männer vom Friedhof, die sie nicht nur auf der Leinwand in Versuchung führen. Als sich die dubiosen Vorfälle häufen, erkennt Indigo, dass ihr Schicksal enger mit den Familien von Avian und Julius verflochten ist, als sie ahnt … Romantic Suspense vor der schillernden Kulisse Hollywoods. »Unterhaltsam, spannend, mit einer Prise Hollywood - Scripted Lies hat mich überrascht & von der ersten Seite an neugierig gemacht!« Spiegel-Bestseller-Autorin Carolin Wahl #Enemies to Lovers #Mystery Romance #Romantic Suspense #Why Choose Romance #Hollywood Romance #New Adult #Romantic Thrill Alle Bände der Romance-Dilogie im Planet!-Verlag: - Scripted Lies - Scripted Truths (erscheint im Februar 2025)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Zurück nach gestern können wir nicht. Unser Morgen wartet.
Für Indigo wird ein Traum wahr, als sie im letzten Film einer berühmten Drehbuchautorin mitspielen darf. Indigo kann die Ablenkung gut gebrauchen, nachdem ihre Mutter gerade verstorben ist. Auf der Beerdigung überreichen zwei gut aussehende Fremde ihr ein mysteriöses Paket, dessen Inhalt die Vergangenheit ihrer Mutter infrage stellt. Am ersten Tag am Set trifft sie Avian und Julian, die neuen Sterne am Filmhimmel, die sich als die Männer vom Friedhof entpuppen. Schon bald führen sie Indigo nicht nur auf der Leinwand in Versuchung. Als sich die dubiosen Vorfälle häufen, erkennt Indigo, dass ihr Schicksal enger mit den Familien von Avian und Julius verflochten ist, als sie ahnt …
Band 1 der New Adult Suspense-Dilogie
Die Autorin
© Isabella Böhm
Magdalena Gammel wurde 1997 in München geboren. Literatur und Film waren schon immer ihre Leidenschaft. Ein paar Ausflüge in die Schauspielerei machten ihr aber klar, dass sie die Geschichten lieber erzählt, als sie darzustellen. Auf das Kunst-Abitur folgte eine Ausbildung zur Mediengestalterin für Bild und Ton. Wenn sie nicht gerade in Südafrika bei ihrer Familie nach neuen Abenteuern sucht, lebt und schreibt Magdalena in ihrer Heimatstadt München.
Für mehr Informationen über Magdalena Gammel und ihre Bücher folgt der Autorin auf: www.instagram.com/magdalena.gammel
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Planet! auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
Magdalena Gammel
Scripted – Lies
Planet!
Liebe Leser:in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte.
Auf der letzten Seite findest du eine Themenübersicht, die
Spoiler für die Geschichte beinhaltet.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest.
Wir wünschen dir das bestmögliche Leseerlebnis!
Magdalena Gammel und das Planet!-Team
Playlist
# Scripted - Girorg¡a
# Florence + The Machine – Bedroom Hymns
# OneRepublic – Counting Stars
# Bishop Briggs – Dream
# BANNERS – Supercollide
# Henrik – Half of forever
# Hozier – Sunlight
# Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours
# Dotan – Mercy
# Talos – Boy Was I Wrong
# Florence + The Machine – Over The Love
Für alle Entscheidungen, die wir uns
getraut haben zu treffen.
1. Kapitel
»Zurück nach gestern können wir nicht. Unser Morgen wartet«, flüsterte ich.
Mit einem Grab zu reden hatte etwas sehr Einseitiges.
Daher stellte ich keine Fragen und bemühte mich gar nicht erst, eine Konversation zu beginnen.
Es war mir lediglich wichtig gewesen – irgendwie richtig vorgekommen, diese Worte zu sagen.
Sie passten zu meiner Stimmung.
Sie passten zu meiner Situation.
Sie passten zu dem Friedhof, auf dem ich mich befand.
Für gewöhnlich mochte ich Friedhöfe.
Sie waren Theaterbühnen, auf denen wir unsere letzte Rolle spielten, bevor der Vorhang für immer fiel und wir uns einsam, aber als wir selbst, verabschiedeten.
Diese poetische Überzeugung kam von meiner Mutter.
Der zynische Unterton, mit dem ich stets an sie dachte, kam von mir.
Schon als kleines Mädchen hatte ich es geliebt, mit meiner Mom zusammen über die fein säuberlich angelegten Wege zu spazieren, während wir uns gemeinsam Geschichten zu den Toten ausdachten, deren letzte Verbindung zum Leben ein Grabstein mit Namen war.
Morbide? Ein wenig.
Von Therapeuten empfohlen? Keine Ahnung.
Aber diese kleine Tradition hatte uns näher zusammengebracht als irgendwelche anderen konventionellen Mutter-Tochter-Aktivitäten. Meine Mom war vieles gewesen, konventionell allerdings nicht.
Bedauernswerterweise würde sich heute mein Verhältnis zu Friedhöfen für immer ändern.
Denn anstatt mit meiner Mutter das schönste Grab zu suchen, stand ich nun vor ihrem. Mit dem potthässlichen, mickrigen Holzkreuz wirkte es besonders deprimierend.
So unübersehbar abscheulich, dass es schon wieder witzig war.
Der letzte Witz meiner Mom, der über ihr Leben hinausging.
Und er passte zu den unpassenden Gegebenheiten.
Es war ein wolkenloser, wunderschöner Sommertag, an dem die meisten New Yorker, die nicht gerade ein Familienmitglied zu Grabe trugen, das gute Wetter genossen. Die Stadt, die niemals schlief, entspannte sich etwas und vermittelte etwas ungewohnt Friedliches.
Anstatt sich also die Füße in der prallen Sonne platt zu stehen, wären die wenigen Gäste dieser Beerdigung, mich eingeschlossen, vermutlich lieber irgendwo anders.
Das klang pietätlos. Vielleicht wäre ich sentimentaler gewesen, wenn meine eigene Mutter nicht bereits zu Lebzeiten über die Sinnlosigkeit andächtiger Reden und zeremonieller Bräuche gelästert hätte.
Alles Humbug, hörte ich sie mit der kratzigen Stimme von Ebenezer Scrooge schimpfen.
Nachdem ich also ein paar Floskeln gesagt hatte, bedankte ich mich bei den Gästen für ihr Kommen, verabschiedete mich höflich und zählte in Gedanken die Sekunden, bis dieses Trauerspiel endlich überstanden war. Ich musste dringend in den Schatten. Mit dem Hauttyp Ich-werde-nicht-braun-sondern-rot-und-dann-wieder-weiß empfand ich die Sommersonne nur in Maßen als angenehm. Außerdem hatte ich zu wenig gegessen und kaum geschlafen. Mein Outfit war die reinste Körperverletzung. Das schwarze Kleid zu warm, der Haarreif zu eng, die Schuhe zu hoch und überhaupt war alles blöd. Die Beerdigung war blöd, das schöne Wetter war blöd, die Gäste waren blöd. Und dass meine Mutter tot war … ja, das war ganz besonders blöd. Was hätte sie wohl dazu gesagt?
Nicht weinen, Schatz. Ich komme dich holen, dann reden wir.
Erschrocken fuhr ich zusammen. Oh nein, nicht das schon wieder …
»Mein Beileid, Liebes. Sie war eine beeindruckende Frau und begnadete Künstlerin«, bewahrte mich eine ältere Dame vor meinen düsteren Gedanken. Sie tätschelte mir behutsam die Hand und seufzte.
»Vielen Dank«, erwiderte ich, wusste aber beim besten Willen nicht, wie sie hieß. Allem Anschein nach gehörte sie zu der Gruppe von extravagant gekleideten Frauen, die nacheinander Blumen auf das Grab legten. Spätberufene Malerinnen, die ihre Ausgefallenheit durch Bilder zum Ausdruck brachten und meine Mutter aus der Künstler-Szene kannten.
Um heute nicht allein am Grab zu stehen, hatte ich ihr Adressbuch durchforstet und ganz pragmatisch diejenigen eingeladen, deren Namen ich schon einmal gehört zu haben glaubte. Die Hälfte davon war erschienen. Und davon kannte ich zwei immerhin persönlich: Unseren Nachbar Daxton, der einen Schlüssel zu unserer Wohnung besaß, weil meine Mutter den ihren ständig verloren hatte, und Mrs Makowski, der der wenig erfolgreiche Cupcake-Laden Sprinkle Town auf der anderen Straßenseite gehörte. Die beiden waren die einzigen Menschen gewesen, für die sich meine Mutter aktiv interessiert hatte.
Denn so weit ich mich zurückerinnern konnte, waren Mom und ich immer nur zu zweit gewesen. Nie hatte sie jemand anderes in unser Leben gelassen.
Keine Freunde, keine Familie, keine Freunde der Familie. Keine Liebhaber, keine Arbeitskollegen.
»Wie wäre es mit einem ganz unkonventionellen Leichenschmaus?«, fragte mich Mrs Makowski, die sich während der Zeremonie im Hintergrund gehalten und mir mit ihrer Ruhe Kraft gegeben hatte.
Den obligatorischen Leichenschmaus hatte ich eigentlich von der Liste der Beerdigungs-Rituale gestrichen, weil ich keine weiteren Beileidsbekundungen von Menschen ertrug, die weder mich noch meine Mutter wirklich kannten. Mrs Makowski zog die Augenbrauen zusammen und musterte mich besorgt.
»Mit ein paar unkonventionellen Himbeer-Cupcakes und meiner besten Flasche Wein, hm?«
Himbeer-Cupcakes klangen gut.
Wein noch besser.
Zärtlich wie die Großmutter, die ich nie gehabt hatte, strich sie mir das rote Haar hinters Ohr. Sie war noch keine achtzig, aber das viele Zigarrerauchen und Rotweintrinken hatten sie schneller altern lassen. Der graue Lockenkopf, die bunten Röcke und ihre Vorliebe für großen, klobigen Schmuck verliehen ihr das Aussehen einer Hippie-Hexe.
»Und ich koche uns was ganz Unkonventionelles«, mischte sich Daxton ein und zwinkerte mir zu. Als selbst ernannter Nerd verdiente er sich neben seinem Brotjob als Webentwickler noch ein bisschen was durch halblegale Hacker-Aufträge dazu, um die Schulden seiner verkorksten Familie, über die er nur ungerne sprach, abzubezahlen. Aber er war Mrs Makowskis bester Kunde. »Oder was Großes. Ein Pilz-Risotto zum Beispiel.« Und er war leidenschaftlicher Koch, der überraschenderweise noch nie ein Rezept in der Hand gehalten hatte. Zu seiner Verteidigung musste man sagen, dass seine undefinierbaren Gerichte köstlich schmeckten.
»Ich komme heute Abend vorbei«, versprach ich und versuchte möglichst zuversichtlich zu klingen. Mrs Makowski und Daxton waren die einzigen Menschen, die ich mochte. Und auch die einzigen Menschen in meiner Nähe, die mich mochten.
Das wollte und durfte ich nicht mit Füßen treten. Wenigstens würde mich das vor einem Abend mit unangerührter Tiefkühlpizza retten. Mrs Makowski tätschelte mir die Wange und hakte sich bei Daxton ein. Ich sah ihnen nach und blieb, in Gedanken versunken, am Grab zurück. Entweder war es der Schock oder Schlafmangel, dass ich mich in diesem verrückten Trance-Zustand befand, der mich all das hier einfach akzeptieren ließ. Ich organisierte, ich redete, ich lächelte. Seit dem Unfall war mein Leben völlig aus den Fugen geraten, gleichzeitig bewahrte diese nicht enden wollende Flut an Veränderungen mich vor dem Zusammenbruch. Ich war gerne beschäftigt. Bereits in der Woche, in der Mom im Krankenhaus gewesen war, hatte ich begonnen, mich auf all das hier vorzubereiten. Nicht stehen bleiben, nicht durchatmen, nicht denken. Ich lebte immer ein paar Schritte in der Zukunft, damit mich die Gegenwart nicht einholen konnte und die Vergangenheit blieb, wo sie hingehörte.
Denn die Tränen waren da, das wusste ich.
Wie zum Teufel machten das andere Menschen, die plötzlich allein dastanden? Wie sollte man trauern, wenn man stundenlang mit Versicherungen und dem Bestattungsinstitut telefonieren musste?
Ich war erst vor zwei Wochen einundzwanzig geworden, und es kam mir vor, als habe dieser verfluchte Schicksalsschlag nur darauf gewartet, dass ich ihn als Erwachsene ertragen musste.
»Es tut mir leid, Mom«, murmelte ich und wusste nicht so recht, wofür ich mich entschuldigte. Vielleicht dafür, dass ich sie nie verstanden hatte? Vielleicht dafür, dass ich noch immer nicht geweint hatte? Alles, was ich wusste, war, dass ich sie bereits vermisste und dass ich mich dem Schmerz über ihren Verlust irgendwann stellen musste.
Achtung, meldete sich meine Vernunft, du wirst sentimental. Ja, das wurde ich. Und das hätte meiner Mutter gar nicht gefallen. Sie war zwar ein Mensch der Gefühlsausbrüche gewesen, aber diese hatte sie stets mit Ironie inszeniert. Ernste Gespräche waren ihr zuwider gewesen.
Also schluckte ich den Kloß in meinem Hals herunter und stockte, als mir zwei Männer auffielen, die nicht hierher passen wollten.
Ich wusste nicht, ob sie zusammengehörten, denn der eine – vornehm gekleidet im Anzug, stand neben dem Eingangstor und beobachtete die Trauergäste.
Der andere stand ganz in meiner Nähe. Uns trennten keine zehn Meter und sein von einer Sonnenbrille verdecktes Gesicht war in meine Richtung gewandt.
Kannte ich ihn?
Er trug dunkle Chinos und ein sommerliches Hemd. Entweder gehörte er nicht zur Trauergesellschaft oder aber er war mindestens so pietätlos, wie ich mich fühlte. So oder so zeigte er beunruhigend großes Interesse an meinem Kampf mit mir selbst.
Ich drehte mich ihm zu und neigte fragend den Kopf. Trotz der Sonnenbrille glaubte ich zu erkennen, wie er die Augenbrauen zusammenzog.
Da er sein Starren nicht unterbrach, entschied ich, ihn zu begrüßen.
Vielleicht gehörte er ja doch zu den Gästen, die ich auf gut Glück aus dem Adressbuch meiner Mutter gewählt hatte.
Außerdem wirkte er harmlos. Etwas mürrisch, aber harmlos. Und mit jedem Schritt, den ich mich ihm näherte, bemerkte ich, wie jung er war. Viel älter als ich konnte er nicht sein. Er zog die Sonnenbrille ab und steckte sie sich ans Hemd, das ihm bei genauerer Betrachtung unverschämt gut stand.
Alles an ihm saß perfekt. Von den teuer wirkenden Lederschuhen, bis hin zu seinem dunkelbraunen, leicht gewellten Haar, das wohl mit Absicht verwuschelt aussehen sollte. An jedem Finger trug er einen Ring und unter seinen Ärmeln lugte der Anfang von rauchartigen Tattoos hervor, die unter dem Stoff des Hemdes verschwanden.
Als ich vor dem Fremden stehen blieb, machte mein Herz einen Satz. Aus der Nähe sah er blendend gut aus.
Nein. Nicht gut. Schön.
Schön auf eine Art, die mich innerlich berührte.
Schön auf eine Art, die mich an die Bilder meine Mutter erinnerte. Sie bargen eine Freiheit, eine wilde Tiefe, die nur von Künstlern mit dem Blick für Kontraste geschaffen werden konnte.
Seine harten Züge standen im Kontrast zu seinem makellosen Gesicht. Seine aufmerksamen, grünblauen Augen im Kontrast zu seiner abwehrenden Körperhaltung.
»Kennen wir uns?«, fragte ich geradeheraus.
»Noch nicht, nein.«
Seine Stimme war tief und rau.
»Wollen wir uns kennenlernen?«
Sein Mundwinkel zuckte überrascht nach oben, dabei hatte ich meine Frage ganz anders gemeint. »Auf einem Friedhof?«
Er runzelte fragend die Stirn, doch ich zuckte lediglich mit den Schultern.
»Du beobachtest mich seit einer Viertelstunde. Da dachte ich, es wäre höflich, sich zumindest vorzustellen.«
Anstatt zu antworten, reckte er das Kinn.
»Mein herzliches Beileid.« Ich folgte seinem Blick zum Grabkreuz meiner Mutter.
»Danke«, murmelte ich.
»Freund oder Familie?«, fragte der Fremde.
»Familie.«
Er wusste also nicht, wen ich da heute zu Grabe getragen hatte, was sein gesamtes Verhalten umso eigenartiger machte.
»Darf ich fragen, was du hier willst? Oder besuchst du ebenfalls einen unter der Erde liegenden Verwandten?«
Er musterte mich belustigt.
»Bist du immer so direkt?«
»Nein. Nur während Beerdigungen und Arztbesuchen.«
Kopfschüttelnd schob er eine Hand in die Hosentasche und kam einen Schritt näher.
»Wir suchen jemanden«, flüsterte er und beugte sich zu mir hinab, wobei mir sein herber Duft in die Nase stieg. »Vielleicht bist du ja dieser Jemand«, er schenkte mir ein spöttisches Lächeln und betrachtete mich in aller Ruhe, »auch wenn ich mich noch nicht entschieden habe, ob du unseren weiten Weg wert warst.«
Ich erkannte eine Beleidigung, wenn man sie mir ins Gesicht sagte, egal, wie geschickt sie verpackt war.
»Du bist ganz schön dreist«, sagte ich und hielt dem Blick seiner grünblauen Augen stand.
Er schürzte die Lippen und kam mir noch näher, bis ich meinen rasenden Puls nicht länger leugnen konnte.
»Und für jemanden mit einem hübschen Gesicht wie dem deinen, besitzt du eine sehr uncharmante Art, neue Bekanntschaften zu machen«, erwiderte er spöttisch.
Ich ballte die Hände zu Fäusten, mit denen ich nur zu gerne auf ihn eingedroschen hätte, als mir einfiel, was er zuvor gesagt hatte.
»Wer ist wir?«, fragte ich misstrauisch.
»Ah, du bist also doch nicht so einfältig wie befürchtet«, spottete er und richtete sich gerade auf. Wer war dieser Fremde, dass er es sich erlaubte, so mit mir zu reden?
»Avian«, ertönte da eine mahnende Stimme hinter mir. Ich zuckte zusammen und wirbelte herum, nur um dem anderen Fremden direkt gegenüber zu stehen.
»Großer Gott!« Erschrocken sprang ich zur Seite. »Seid ihr beide irgendwelche Agenten oder Auftragsmörder? Wenn ja, habt ihr euch einen wirklich passenden Ort ausgesucht. Auch wenn ich einen Mord auf einem Friedhof furchtbar unkreativ fände.«
Der junge Mann im Anzug, der am Eingangstor gewartet hatte, sah erst mich, dann Mr-Dreist-aber-leider-gut-aussehend, überrascht an.
Dieser zuckte mit den Schultern und wirkte so erheitert, als sei ich sein persönliches Entertainmentprogramm.
»Wenn unser kleiner Rotfuchs hier die ist, die wir suchen, würde sie deine heldenhafte Mission um einiges interessanter machen«, sagte er, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Dann könnte sogar ich Gefallen daran finden.«
Ich schnaubte und funkelte ihn wütend an, als der andere Kerl mit seinem schweren Seufzen meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
»Du musst meinem Freund verzeihen«, sagte er und senkte den Kopf wie zu einer Verbeugung. »Er versteckt seine sensible Seite gerne hinter einer Mauer aus unerträglicher Arroganz, damit ihm niemand wehtun kann.«
»Verdammt, Julius!« Avian lachte. »Deine entwaffnende Ehrlichkeit ist hier völlig fehl am Platz.«
»Ich will nur verhindern, dass sie einen falschen Eindruck von dir bekommt«, sagte Julius.
»Zu spät«, knurrte ich.
»Siehst du«, Avian deutete auf mich, bevor er die Arme vor der Brust verschränkte, »der Schaden ist bereits angerichtet.«
»Eben. Also könnt ihr bitte gehen, da ich gewiss nicht die Person bin, nach der ihr sucht.«
»Dann ist dein Name nicht Lacie O’Malley?«, fragte er und schnaubte, als ich erstarrte.
Mein Magen verkrampfte sich, plötzlich fiel mir das Atmen schwer.
»Nein«, krächzte ich und deutete mit dem Daumen über meine Schulter. »Die liegt da hinten.«
Das ließ sogar Avians selbstgefällige Haltung bröckeln. Er und Julius sahen sich einen Moment lang überrascht an, bevor beide sich räusperten, Mitgefühl lag in ihren Zügen.
»Schwester oder Mutter?«, fragte Avian leise.
»Mutter«, murmelte ich und wich seinem Blick aus.
»Das tut mir leid.« Ich blinzelte überrascht und hob das Gesicht. Er meinte seine Worte ernst. So wie er klang, hatte er sie ebenfalls schon zu hören bekommen und wusste, dass sie den Schmerz niemals lindern würden.
»Danke.«
Auch wenn ich sein Mitgefühl nicht brauchte, tat es gut, mich nicht länger mit ihm zanken zu müssen. Heute war ich zu müde für jede Art von Stichelei, auch wenn ich ihm niemals das letzte Wort überlassen hätte.
»Ich bin Avian«, sagte er und deutete auf seinen Freund. »Und das ist Julius.« Etwas spät für eine anständige Vorstellung, aber immerhin. »Magst du uns deinen Namen verraten oder belassen wir es bei kleiner Rotfuchs?« Er lächelte schief, womit er mich beinahe zum Grinsen brachte.
»Bitte nicht.«
Ich hasste Spitznamen, die auf meine roten Haare abzielten.
»Indigo«, sagte ich.
Julius sah mich überrascht an. »Was für ein hübscher, ungewöhnlicher Name.«
So konnte man es auch sehen.
»Meine Mom war Künstlerin«, erklärte ich, »und der Meinung, dass die Kinder von Künstlern auch künstlerische Namen haben sollten.«
»Klingt vernünftig«, sagte Avian zu meiner eigenen Überraschung. »In unseren Kreisen überschlagen sich Eltern bei dem Versuch, ihren Bälgern möglichst ungewöhnliche Namen zu geben. Deine Mom scheint sich zumindest Gedanken gemacht und von deinen Augen inspiriert haben zu lassen.«
Ich nickte verwundert. Auf den Zusammenhang kamen bei der Erwähnung meines Namens nicht besonders viele.
»Kanntet ihr meine Mom?«, fragte ich und wandte mich Julius zu. Er war etwas größer als Avian und besaß offenbar auch bessere Manieren. Mit seinem frisierten, dunkelblonden Haar und dem maßgeschneiderten Anzug wirkte er wie ein echter Gentleman.
»Nein«, sagte er und schüttelte bedauernd den Kopf. »Leider nicht persönlich.«
Die Art, wie er mich mit seinen hellbraunen Augen musterte – achtsam, aber nicht unangenehm, hatte ich bis jetzt nur in Filmen kennengelernt. Es gab mir das Gefühl, gerne von ihm angesehen zu werden. Als sei ich ein lebendiges Kunstwerk, dessen Bedeutung er ergründen wollte. Mein Herz begann zu flattern. Was für merkwürdige junge Männer.
»Kann ich euch dann irgendwie weiterhelfen?«
Julius nickte und griff in die Innentasche seines Jacketts, das mehr als meine Monatsmiete gekostet haben musste.
Ich selbst besaß nicht das Geld, um mir solch subtil-teure Kleidung zu leisten. Ein Blick genügte, um zu wissen, dass Julius zu eben jener erlesenen Gruppe gehörte, die meine Mutter den Haus-in-den-Hamptons-Club getauft hatte. Kultivierte Superreiche, die es nicht nötig hatten, ihren Reichtum zur Schau zu stellen.
Er zog ein dünnes Päckchen hervor und hielt es mir zögernd hin.
»Wir sollen dir das hier überreichen, denke ich.«
»Du«, mischte Avian sich ein. »Du willst es ihr überreichen.«
»Es lag vor unserer Haustür«, brummte Julius.
»Ja, aber du hast es zu unserer Mission gemacht, es auszuliefern.«
»Was soll das heißen?«, unterbrach ich die beiden.
Es war weniger das Päckchen, das mich stutzig machte. Für Kuriere waren die beiden definitiv zu reich.
Zögerlich nahm ich Julius das kleine Paket ab und sah zwischen den beiden Männern hin und her. Während Julius sich überdurchschnittlich höflich und sehr zuvorkommend verhielt, kam mir Avian wie ein Schauspieler vor, der ganz genau wusste, wie er mit Gesten und Worten die gewünschte Wirkung erzielte.
»Von wem ist das?«, fragte ich.
»Das wissen wir leider nicht«, sagte Julius.
»Und warum gebt ihr mir es dann?«
Ich wollte nicht unfreundlich sein, aber die ganze Situation wurde immer merkwürdiger. Julius neigte den Kopf zur Seite und deutete auf das Paket. In gestochener Schönschrift stand dort der Name meiner Mutter. Darunter die Adresse des Friedhofs und die Uhrzeit der Beerdigung.
Mein Herz begann zu rasen.
War das ein grausamer Scherz?
»Woher habt ihr das?« Päckchen von fremden Männern, ganz gleich wie attraktiv und charmant diese waren, konnten böse Überraschungen enthalten. Ich schüttelte es leicht, zumindest schien keine Bombe darin zu sein, sondern etwas Kleines, Festes und etwas, das sich wie ein Büchlein anfühlte.
»Wir kennen den Inhalt nicht«, versicherte mir Avian. »Und wir haben leider keine Ahnung, von wem es ist.« Er warf Julius einen missmutigen Blick zu. »Es lag vor zwei Tagen in unserem Briefkasten und da kein Absender draufstand, konnten wir es auch nicht zurückschicken. Deshalb hat Julius es zu unserer Aufgabe gemacht, es auszuliefern.«
»Ganz echt«, sagte Julius. »Allerdings war uns nicht klar, dass uns die Adresse zu einem Friedhof führen würde. Und keiner von uns hat damit gerechnet, dass die Empfängerin bereits …«
»Tot ist?«, half ich weiter. Er nickte vorsichtig.
»Ja. Aber als Tochter der Verstorbenen bist du wohl ihre nächste Angehörige, deswegen …«
»Das klingt nach ganz schön viel Aufwand, dafür, dass ihr keine Ahnung habt, von wem das Päckchen ist, und meine Mutter nicht einmal persönlich kanntet.«
»Oh Liebes«, sagte Avian belustigt, »das versuche ich Julius seit mehreren Stunden klarzumachen.«
Julius ignorierte ihn und lächelte mich schüchtern an.
»Ich hielt es für das Richtige.«
Das erschien mir nun völlig absurd. Julius zuckte mit den Schultern und schob die Hände in die Taschen seiner Anzughose.
»Sehr nobel«, flüsterte ich und kam nicht umhin, ihn für seine Tat zu bewundern.
»Gut«, sagte Avian und schob die Ärmel seines Hemdes bis zu den Ellbogen, wodurch seine Tattoos entblößt wurden, die sich wie in Wasser gegossene Tinte über seine Arme zogen. »Damit ist unsere Mission erledigt und du kannst nachts wieder ruhig schlafen.«
Julius verdrehte die Augen.
»Heute strapazierst du wirklich meine Nerven.«
Avian lachte sanft.
»Und du, mein Freund, bist generell nicht das, was man eine angenehme Gesellschaft nennt.«
Er neigte den Kopf zur Seite und musterte mich für ein paar Sekunden mit ernster Miene.
»Es war interessant, dich kennenzulernen, Indigo.«
Ich schluckte die plötzliche Aufregung herunter und nickte knapp. Am liebsten hätte ich sie vom Gehen abgehalten, doch mir fiel kein guter Grund dafür ein.
Avian wandte sich mit einem letzten, eindringlichen Blick in meine Augen ab und marschierte davon, als habe diese Begegnung niemals stattgefunden.
»Entschuldige sein rüdes Verhalten«, sagte Julius und richtete den Kragen seines Jacketts. »Er hat es momentan nicht ganz leicht und lässt das gerne an anderen aus.«
»Ist kaum aufgefallen.«
Ich winkte ab und versuchte diese Situation mit Humor oder zumindest Ironie zu nehmen.
»Es war nett, dich kennenzulernen, Indigo.« Julius neigte höflich den Kopf. Ich glaubte sogar, so etwas wie eine leichte Röte auf seinen Wangen zu entdecken. Ich fühlte mich merkwürdig berührt davon.
»Vielen Dank für deine Mühe«, antwortete ich, weil mir nichts Besseres einfiel. Er lächelte mich noch einmal an und dabei fiel mir auf, dass Avian zwar der Schönere von beiden war, aber Julius diese unperfekte Form von Attraktivität besaß. Rau und markant, obwohl er sehr viel sanfter und kultivierter wirkte als sein ruppiger Freund.
Er verabschiedete sich und ich blieb wie ein vom Blitz getroffenes Schaf an Ort und Stelle stehen.
Was zum Henker war gerade passiert?
Und warum hatte ich Idiotin nicht nach seiner Nummer oder wenigstens seinem vollen Namen gefragt?
Ich sah zu Boden und stampfte einmal mit dem Fuß auf. Meine Mutter hatte weder an den Himmel noch an die Hölle geglaubt. Sie hatte überhaupt an gar nichts geglaubt. Ihre Idealvorstellung von einem Leben nach dem Tod war »Humus für die Erde, die ihn gebrauchen kann«.
Wörtliches Zitat.
Also stellte ich mir vor, dass nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Geist in die Natur übergegangen war.
Meine Mutter hätte solche Gedanken als Esoterik-Quatsch abgetan, doch hin und wieder tat es gut, sich etwas vorzustellen, das zwar unlogisch, dafür tröstend war.
»Hast du das mitbekommen?«, fragte ich leise. »Ich bin mir sicher, du lachst dich gerade tot.«
2. Kapitel
Auf dem Weg nach Hause befürchtete ich, dass Roger, mein alter Cadillac, ausgerechnet heute den Geist aufgeben würde. Er hustete bereits seit Monaten wie ein Esel mit Bronchitis und für die Dramaturgie dieses ohnehin schon sehr fragwürdigen Tages, hätte es ganz hervorragend gepasst, wenn mein klappriges Auto nicht weit vom Friedhof liegen geblieben wäre.
Natürlich müsste es dann noch zu regnen beginnen. Keine tragische Szene ging ohne Regen. Doch Roger blieb tapfer und hielt bis nach Hause durch.
Meine Mutter und ich wohnten seit vierzehn Jahren in Brooklyn und ebenso lang in unserem kleinen Apartment in Greenpoint. Es war eine schöne Wohngegend, vor allem was die Architektur betraf. Das ehemalige Arbeiterviertel bestand überwiegend aus Ziegelbauten und Reihenhäusern mit für Brooklyn überraschend grünen Straßen. Zwar ließ sich auch hier die Gentrifizierung nicht aufhalten, aber noch lag Greenpoint weit hinter dem angrenzenden Williamsburg, was ein entscheidendes Kriterium für Mom gewesen war.
Hier gaben sich die Leute, ihrer Meinung nach, weniger prätentiös, die Mieten waren noch halbwegs bezahlbar und die vielen Geschäfte besonders charmant.
Als Künstlerin war meiner Mutter Authentizität und Originalität immer sehr wichtig gewesen, was sich auch in ihren Bildern und unserem gesamten Lebensstil widergespiegelt hatte.
Ich parkte Roger einen Block weiter, weil in unserer Straße so gut wie nie ein Platz frei war, stellte den Motor aus und rieb mir die vor Müdigkeit brennenden Augen. Die plötzliche Stille war ohrenbetäubend und ich wusste, dass sie in der Wohnung noch lauter sein würde. Dort war es niemals ruhig gewesen. Frühmorgens hatte meine Mutter das Radio eingeschaltet, um zu Siebzigerjahre-Songs Rührei anbrennen zu lassen. Mittags, wenn sie sich auf die Galerie verzogen hatte, wo all ihre Malsachen standen, war sie zu klassischer Musik übergegangen, die gegen Abend von irgendwelchen True-Crime-Podcasts abgelöst wurden.
Ich steckte mir meine Kopfhörer ins Ohr, machte eine der Playlists an, die Mom mit mir geteilt hatte, und spazierte zur Musik von Fleetwood Mac durch die Straße.
Greenpoint war stetig im Wandel und über die Jahre hinweg immer beliebter geworden. Neben Vintage-Shops, neuen Bistros und auf alt gemachte Bars, reihten sich polnische Bäckereien und Supermärkte, die von den Menschen betrieben wurden, die bereits seit mehreren Generationen hier lebten. Mrs Makowski nannte unser Viertel stets »little Poland«, was mich dazu bewogen hatte, mir von ihr etwas Polnisch beibringen zu lassen.
Kurz vor unserer Wohnung, die im zweiten Stock eines rostroten Reihenhauses lag, unterbrach ein Anruf meine Musik.
»Hey«, meldete ich mich, nachdem ich auf dem Display gesehen hatte, dass es Nora, eine meiner zwei besten Freundinnen war.
»Ich bin ein schlechter Mensch!«, heulte sie mir ins Ohr. »Es tut mir sooo leid, dass ich erst jetzt anrufe! Hier war die Hölle los! Ganz ehrlich: Sollte ich jemals heiraten, dann halte mich bitte davon ab, meinen Junggesellinnenabschied mit einem Brunch zu beginnen. Da ist die Eskalation vorprogrammiert! Diese dummen Hühner waren bereits um halb eins so sternhagelvoll, dass mir eine von ihnen in die Blumen gekotzt hat. In die künstlichen Blumen!« Ich sah auf meine Uhr. Das war eine knappe Stunde her. Kein Wunder, dass Nora so angepisst klang. Sie war Mitte zwanzig, ein absoluter Workaholic und lebte in L.A. Dort war ich ihr auch das erste Mal begegnet. In ihrem damals frisch eröffneten Restaurant, dem Hungry Angels, auf dessen Speisekarte ausschließlich taiwanesische Rezepte von ihrem Vater standen, die sie etwas der kalifornischen Küche angepasst hatte. Ich hatte mich vor zwei Jahren dort hineinverlaufen, um meinen Text für ein anstehendes Casting zu lesen. Kurzerhand hatte Nora sich dazugesetzt und mit mir geübt, als sei es das Normalste der Welt. Vermutlich war es das für sie auch gewesen. Wenn man in Hollywood lebte, liefen einem bestimmt tagtäglich namenlose Nachwuchsschauspielerinnen über den Weg, die an einem Casting nach dem anderen teilnahmen in der Hoffnung, irgendwann den großen Durchbruch zu schaffen. Die Rolle hatte ich damals nicht bekommen, dafür war mir Nora geblieben.
Ich besuchte sie so oft wie möglich, da sie das Restaurant nur selten unbeaufsichtigt lassen konnte. Jede freie Minute verbrachte sie in ihrem erfüllten Kindheitstraum, aber wenn sie mir manchmal vom Tagesgeschehen im Hungry Angels erzählte, klang es so, als sei dieser doch eher ein Albtraum.
»Was erzähle ich da? Ich will mich gar nicht rausreden. Es gibt keine Entschuldigung. Es tut mir so leid, Indy!«
»Ganz ruhig. Bitte erst einmal tief durchatmen«, bat ich und fischte den Haustürschlüssel aus meiner Tasche. »Während der Beerdigung hätte ich ohnehin nicht rangehen können.«
»Ja, aber ich hätte dich heute Morgen anrufen sollen oder dir wenigstens schreiben können …«, versuchte sie einen weiteren Grund zu finden, um sich schlecht zu fühlen.
»Jetzt hab ich dich ja am Ohr. Also erzähl mir lieber, wie es mit der geschändeten Kunstblume weiterging.«
Während ich die Treppe zum Apartment hinauflief, berichtete mir Nora in allen Einzelheiten von ihrem Vormittag. Sie fragte nicht, wie die Beerdigung war. Sie kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht darüber sprechen wollte.
Doch es half, ihre Stimme zu hören, während ich die Wohnung betrat. Wie angewurzelt blieb ich in der Tür stehen und sah mich um. Niemand begrüßte mich. Weder das Radio noch der alte Plattenspieler meiner Mom. Um diese Uhrzeit malte sie für gewöhnlich, sodass die gesamte Wohnung nach Ölfarben und Terpentin roch. Dazu mischte sich der Duft von frischem Toast, den ich ihr jeden Tag um drei Uhr brachte, weil sie gerne mal das Essen vergaß. Mein Blick huschte zur Galerie hinauf, die man über eine eiserne Wendeltreppe erreichte. Seit dem Unfall war ich nicht mehr dort oben gewesen.
»Indy?«, fragte Nora. Offenbar hatte ich einige Minuten ihrer Geschichte verpasst. Ich schüttelte mich und machte die Tür hinter mir zu.
»Ja, sorry. War kurz in Gedanken.«
»Wo bist du?«
»Gerade daheim angekommen.«
Am anderen Ende herrschte plötzlich Stille.
»Verstehe«, murmelte Nora schließlich und das tat sie wirklich. Besser als irgendjemand sonst.
Sie war der empathischste Mensch, den ich kannte, und niemand konnte so gut zwischen den Zeilen lesen wie sie.
»Hast du heute schon was gegessen?«, fragte sie mich und wie zur Antwort grummelte mein verräterischer Magen.
»Ja«, log ich und legte meine Tasche auf der Theke ab.
»Lügst du?«
»Ja«, gestand ich und setzte mich auf einen der beiden Barhocker. Links der Wohnungstür grenzte die offene Küche und rechts das Wohnzimmer an, das aus wild zusammengewürfelten Möbeln bestand. Ein rotbrauner Perserteppich, eine dunkelgrüne Ledercouch. Ein bunter Sessel mit mehr Flicken, als man zählen konnte, und drei antike Stehlampen, deren vergilbte Schirme nach Mottenkugeln rochen.
»Soll ich dir was schicken? Ein kleines Carepaket für die nächsten Tage? Wie wäre es mit einer Lasagne? Die kannst du einfrieren.«
Ich musste lächeln und trat an den Kühlschrank, um ihn so geräuschvoll wie möglich zu öffnen, damit Nora es auch hörte. Ihre Lasagne war vorzüglich, aber ich wollte ihr keine Umstände machen.
»Nicht nötig«, versicherte ich und verzog das Gesicht, als ich sah, dass abgesehen von einer geöffneten Packung Streukäse, einem Glas Essiggurken und mehreren angebrochenen Tuben Mayonnaise, kaum noch etwas da war, das nicht bereits zu schimmeln begonnen hatte.
»Ich mache mir einen Wrap mit Essiggurken und Mayo«, versprach ich und hörte Nora würgen.
»Abartig.«
»Bestimmt ist das irgendwo eine Delikatesse.«
»Ja, in der Hölle.«
»Snob«, sagte ich und schloss die Kühlschranktür unverrichteter Dinge.
»Banause«, erwiderte Nora und klimperte mit Gläsern, die sie gerade ein- oder ausräumte.
»Ach herrje«, hörte ich sie plötzlich sagen.
»Was ist?«, fragte ich und schaltete die Kaffeemaschine an, weil mich sonst die Müdigkeit umhauen würde.
»Rate, wer gerade–«, weiter kam Nora nicht. Kurz rauschte es, dann hörte ich Nora aus weiter Ferne protestieren.
»Indy?«, rief mir eine neue Stimme ins Ohr.
»Hey«, grüßte ich Mikayla.
»Wo bist du? Wie geht es dir?«, fragte sie, während sich Nora im Hintergrund lauthals beschwerte.
»Alles gut. Ich bin gerade zurück.«
»Brauchst du irgendetwas? Möchtest du herkommen? Soll ich dir einen Flug raussuchen?«
»Ich zahle!«, rief Nora.
»Bloß nicht!«, lachte ich. Nora war das Herz der Gruppe, und liebte es, uns zu umsorgen. Mikayla hingegen war das Hirn. Sie hatte immer eine Antwort, einen Plan oder eine Lösung parat.
»Ich versuche, euch nächsten Monat zu besuchen. Dann nehme ich das mit dem Flug bestimmt an. Aber nur organisationstechnisch«, betonte ich.
Beide kamen aus sehr wohlhabenden Familien und verdienten noch dazu mehr Geld als ich. Dieses für ihre engsten Freunde zum Fenster hinauszuwerfen, war eine der Leidenschaften, die Nora und Mikayla teilten.
Bisher hatte ich mir nichts von ihnen leihen müssen und ich würde jetzt nicht damit anfangen.
»Fein«, murrte Mikayla. Sie hatte, das konnte ich hören, ein schlechtes Gewissen, weil sie es nicht zur Beerdigung geschafft hatte, genauso wie Nora. Trotzdem nahm ich es keiner von beiden übel, denn ich wusste, wie eng getaktet ihre Leben in L.A. waren. Beide waren, nur einen Tag nach dem Unfall meiner Mom, prompt nach New York geflogen, um für mich da zu sein. Sie hatten zwar nicht lange bleiben können, doch allein ihre Anwesenheit bewies, was für einmalige Freundinnen sie waren.
»Möchtest du uns von heute erzählen, oder soll Nora sich noch ein bisschen länger über den Junggesellinnenabschied aufregen?«
»Woher weißt denn du das schon?«, fragte ich und ging aus der Küche, damit die lärmende Kaffeemaschine unser Gespräch nicht störte.
»Das fragst du noch?«, lachte Mikayla freudlos. »Was glaubst du denn, wen diese Irre während des gesamten Dramas mit Nachrichten bombardiert hat?«
»Als hättest du nicht wissen wollen, wie es ausgeht!«, hörte ich Nora meckern.
Mikayla schnaubte, aber ich wusste ganz genau, dass Nora recht hatte, denn Mikayla liebte solche Storys. Über jeden Promi wusste sie mindestens eine skandalöse Geschichte zu erzählen und wenn es um den Klatsch und Tratsch aus der Filmbranche ging, wurde es mit ihr nie langweilig.
Mikayla war etwas später als Nora in mein Leben getreten. Und zwar als Managerin. Von uns dreien war sie die Älteste. Und, wenn man so wollte, auch die Erfolgreichste. Mit gerade mal Ende zwanzig hatte sie ihre eigene Agentur für Nachwuchstalente in Hollywood gegründet, die zwar nicht besonders viele, dafür aber ziemlich erfolgreiche Klienten vertrat. Und, mehr durch Zufall, war ich vor nicht ganz zwei Jahren in ihre Kartei aufgenommen worden. Nora, die getrost als der geselligste Mensch Amerikas gelten konnte, hatte mich zu einem Casting begleitet und war dort mit der sehr seriös wirkenden Mikayla ins Gespräch gekommen. Eins hatte zum anderen geführt und nach einem Lunch mit viel Wein waren wir irgendwie unzertrennlich geworden.
»Beerdigung war okay … denke ich«, sagte ich und als die Kaffeemaschine endlich aufhörte, apokalyptische Geräusche von sich zu geben und mein Cappuccino fertig war, setzte ich mich an die Bartheke. »Allerdings werdet ihr mir nie glauben, was danach passiert ist.«
Ich öffnete meine Tasche und holte das Päckchen heraus, das mir Julius überreicht hatte. Über die Beerdigung oder meine Gefühle wollte ich bestimmt nicht sprechen, die Begegnung mit den zwei Männern hingegen bot mir die perfekte Ablenkung. Also erzählte ich Nora und Mikayla von ihnen und dem Päckchen, das zu öffnen ich mich aus irgendeinem Grund nicht traute.
»Mach es schon auf!«, war das Erste, mit dem Nora herausplatzte, nachdem ich fertig war.
»Was, wenn da irgendetwas Ekliges drin ist?«, gab ich zu bedenken und roch an dem Päckchen.
»Dieser Julius wirkte deiner Beschreibung nach nicht wie der Typ, der fremden Mädchen eklige Geschenke macht. Ganz im Gegenteil sogar«, sagte Mikayla und ich konnte förmlich sehen, wie sie anzüglich grinste.
»Avian aber schon«, warf ich ein. »Glaubt mir, wenn der sich mit Heath Ledgers Rolle aus 10 Dinge, die ich an dir hasse und Han Solo zusammentun würde, könnten sie die drei Machotiere gründen.«
»Klingt heiß«, sagte Nora.
»Und vielversprechend«, schmunzelte Mikayla.
»Und ungesund«, warf ich ein.
»Egal! Mach’s auf!«
»Fein!«, rief ich und riss das Päckchen mit einem Ruck auf.
Da mir noch immer kein abartiger Gestank entgegenwehte und nichts explodierte, leerte ich den Inhalt vor mir auf der Theke aus.
»Und?«, fragte Nora. Am anderen Ende raschelte es, weil sie und Mikayla vermutlich ihre Ohren an beide Seiten des Handys pressten. »Was ist drinnen?«
»Ein Buch«, sagte ich. »Ein Ring und irgendetwas aus der Zeitung.«
Ich drehte das zerlesene Taschenbuch um und las den Titel vor.
»Alice’s Adventures in Wonderland. Die Ausgabe scheint ziemlich alt zu sein.« Dann nahm ich den Ring genauer unter die Lupe. Goldene Ranken und Schnörkel umfassten einen in perfekter Schönschrift gravierten Satz.
Einen Satz, der mir durch Mark und Bein ging.
»Zurück nach gestern können wir nicht. Unser Morgen wartet«, las ich mit bebender Stimme vor.
»Das … das hat meine Mom stets gesagt.«
»Dann muss der Ring einmal ihr gehört haben!«, rief Nora.
Oder jemandem, der diesen Spruch ebenfalls kannte. Warum sollten in einem Paket ohne Absender für meine Mom ein Ring von meiner Mom stecken?
»Er sieht ziemlich wertvoll aus«, murmelte ich.
»Was ist mit dem Zeitungsausschnitt?«, fragte Mikayla.
Ich brauchte einen Moment, um mich von der Schönheit des Ringes loszureißen und griff nach dem gefalteten Papier. Als ich es auseinanderfaltete, rutschte ich vor Schreck beinahe vom Barhocker.
»Was ist?«, rief Nora. Ich öffnete den Mund, brachte aber kein Wort heraus.
»Indy?« Mikalya klang plötzlich besorgt.
»Es ist eine Todesanzeige«, keuchte ich. »Von meiner Mom.«
»Wie bitte? Hast du eine aufgegeben?«
»Nein! Wer sollte auf so eine Idee kommen? Da ist sogar ein Bild von ihr dabei.«
Zwar war dieses in Schwarz-Weiß und die Frau darauf noch keine zwanzig, dennoch erkannte ich meine Mutter sofort.
Das lockige Haar, die hellen Augen. Ihre scharfgeschnittenen Gesichtszüge und die Eleganz, die sie selbst in einem unbewegten Foto ausstrahlte. Nur ihr Lächeln war ein anderes gewesen. Unschuldiger. Zwangloser.
»Aus welcher Zeitung ist sie?«, riss mich Nora aus meiner Starre.
Ich zuckte mit den Schultern, auch wenn die beiden das nicht sehen konnten.
»Keine Ahnung. Könnte die New York Times sein, muss es aber nicht. Die sehen doch alle gleich aus.«
»Geh zum nächsten Kiosk und kauf dir eine!«
»Nicht nötig, die dürfte unten im Briefkasten stecken.«
»Was soll das bringen?«, fragte Mikayla. »Selbst wenn diese Anzeige aus der Times ist, verrät uns das ja nicht, wer sie aufgegeben hat.«
»Irgendwelche Freunde?«, überlegte Nora laut.
»Mom hatte keine Freunde. Und auch keine Familie.«
»Jeder hatte mal eine Familie. Selbst deine geheimnisvolle Mom«, sagte Mikayla und sprach damit ein Thema an, das meine Mutter über alles gehasst hatte.
Alle Geschichten aus ihrer Vergangenheit hatten immer erst in England begonnen, wo sie mit zwanzig meinen Vater kennengelernt hatte. Einen Literaturstudenten der Oxford University, der nicht geplant hatte, eine Amerikanerin zu schwängern. Irgendwie hatten die beiden es geschafft, auch ohne familiäre Unterstützung, denn die Eltern meiner Mutter waren bereits vor ihrer Auslandsreise verstorben und sie war ein Einzelkind. Nach dem Tod meines Vaters waren wir hierher gezogen, doch selbst damals, als wir wirklich nichts gehabt hatten, hatte meine Mutter keine alten Bekannten, keine Freunde oder entfernten Verwandten erwähnt, geschweige denn um Hilfe gebeten. Konnte jemand wirklich so allein sein?
Ich legte die ausgeschnittene Todesanzeige beiseite und nahm das Buch in die Hand.
»Irgendjemand will dir wohl irgendetwas sagen«, überlegte Nora laut.
»Schön und gut, aber warum auf solch eine dubiose Weise?«
»Weil alles andere zu riskant wäre?«
»Möglicherweise ist das alles hier nur ein dummer Scherz.«
»Das glaubst du doch wohl selbst nicht«, warf Mikayla ein.
Nein, das tat ich wirklich nicht. Mein Bauchgefühl hatte sich noch nie geirrt.
Das hier war kein Streich, kein Missverständnis.
Das hier war ein Rätsel und irgendjemand wollte, dass ich es löste.
Nora, Mikayla und ich hatten noch eine gute Stunde versucht, uns einen Reim auf die Ereignisse zu machen, waren dann aber von einer Horde Mittagsgäste, die das Hungry Angels überfallen hatten, unterbrochen worden.
Mir war das nur recht, denn mein Kopf tat höllisch weh. Nora versprach, sich morgen zu melden, Mikayla schaute bereits nach Flügen und ich ließ mich, kaum hatten wir unser Telefonat beendet, erschöpft auf das Sofa fallen. Ich streifte meine High Heels ab und schwor bei den Schmerzen meiner Zehen, nie wieder hochhackige Schuhe anzuziehen. Dann sprang ich auf, schälte mich aus dem durchgeschwitzten Kleid und hüpfte unter die Dusche. Beerdigungen im Hochsommer sollten verboten werden. Schwarze Kleidung und Sonne vertrugen sich einfach nicht. Meiner Mutter wäre es zwar egal gewesen, ob ich in Schwarz, in Weiß oder völlig nackt vor ihrem Grab getrauert hätte, aber im Interesse der wenigen Gäste hatte ich das klassische Outfit gewählt.
Das Bad lag zwischen den beiden Schlafzimmern, direkt unter der Galerie. Mom und ich hatten es uns geteilt und ich war noch nicht dazu gekommen, ihre Sachen in Kartons zu räumen.
Als ich aus der eiskalten Dusche stieg und mich in ihren Bademantel hüllte, traf mich die Trauer völlig unerwartet. Schlagartig war die Trance, in der ich mich seit Tagen befand, fort, und die Realität schlug mit voller Wucht zu. Mom war tot. Das war kein Albtraum. Das war eine Tatsache, gegen die sich alles in mir wehrte. Egal ob ich sie ignorierte, ob ich wütend oder traurig wurde: Sie war da und war unveränderbar.
Atmen, dachte ich das Simpelste, was mir in diesem Moment einfiel. Einfach atmen. Dreimal ein, dreimal aus. Nicht denken. Einfach. Nur. Atmen.
Es brauchte einige Zeit, bis ich die Kontrolle zurückerlangt hatte, aber als mir dies gelang, half es.
Ich hatte nicht geweint, aber meine Augen brannten. Die Müdigkeit überfiel mich ganz plötzlich und machte es mir zunehmend schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. Benommen sah ich mich um. Links war die Tür zu meinem Zimmer, rechts die Tür zu dem meiner Mutter. Daneben stand ihr unorganisiertes, überfülltes Badezimmerregal.
Das meine war geordnet und leer im Vergleich zu ihrem. Langsam kam ich auf die Beine, kämpfte den Schwindel nieder und strich über die hübschen Parfümflakons. Mom hatte stets eine frische Frühlingsbrise eingehüllt, während sie mir herbere Düfte empfohlen hatte. Ich musste lächeln, als ich ihr Chaos betrachtete und daran dachte, wie sie morgens immer zu spät gewesen war. Egal für was.
Wir hatten uns für dieselben Sachen interessiert, es aber unterschiedlich ausgelebt. Musik, Kunst, Mode und Make-up.
Mom war die Unangepasste, Extrovertierte und Ausgefallene von uns gewesen. Sie hatte kräftige Farben geliebt und sich gerne wilde Outfits zusammengestellt. Ich hingegen trug lieber Naturtöne und -stoffe. Wir hatten uns oft gegenseitig geschminkt und dann darüber gelacht, wie ungewöhnlich das, was wir an uns so gewohnt waren, am jeweils anderen aussah.
Einzig und allein das kupferrote Haar hatten wir gemein, obwohl sie mit üppigen Locken gesegnet gewesen war, während ich mich mit zu dünnen Wellen herumschlagen musste.
Ich verließ das Badezimmer, zog mir einen Jumpsuit aus dünnem Stoff an und ging in die Küche. Leider scheiterte ich daran, mir etwas zu essen zu machen, weil sich allein schon bei dem Gedanken an feste Nahrung mein Magen zusammenzog. Wie meine Mom war eigentlich auch ich groß und schlank. Gerade jetzt erkannte ich mich jedoch kaum wieder. Zu dünn, zu eckig, zu blass. Ich gehörte nicht zu den Menschen, die sich vor dem Spiegel selbst geißelten. Aber ich bemerkte, wie schwach, wie unkonzentriert ich geworden war … wie unwohl ich mich in meinem Körper fühlte. Und das passte einfach nicht zu mir.
In der Hoffnung, dass Mrs Makowskis Cupcakes und Daxtons Pilz-Risotto meinen Appetit anregen würden, verließ ich am Abend die Wohnung, um im Sprinkle Town einen ganz unkonventionellen Leichenschmaus zu zelebrieren.
Dabei hielt ich am Briefkasten an, den ich seit Tagen nicht mehr geöffnet hatte. Leicht verbittert und genervt ging ich die Briefe durch. Rechnungen, Schreiben von der Versicherung, Werbung, irgendetwas vom Bestattungsinstitut und … ich stockte, ließ die Zeitung und den Rest fallen und klammerte mich an dem letzten, cremefarbenen Brief fest. Die Welt drehte sich zu schnell und schien gleichzeitig stehen zu bleiben. Mein Herz raste, als wollte es vor dem, was ich mit diesem Schreiben erfahren würde, davonrennen. Ich las den Absender wieder und wieder, aber es blieb immer derselbe.
Lee Strasberg Theatre and Film Institute!
Lee Strasberg Theatre and Film Institute!!
Lee Strasberg Theatre and Film Institute!!!
Ich stopfte die anderen Briefe zurück in den Kasten, schlug ihn zu und rannte wie ein kopfloses Huhn aus dem Haus, über die Straße und in Mrs Makowskis Laden.
Es roch bereits köstlich nach frischem Gebäck und herzhaftem Risotto.
Wie angewurzelt blieb ich mitten im Raum stehen, als Mrs Makowski gerade aus der Küche kam und beinahe das Tablett mit frischen Cupcakes fallen ließ.
»Lieber Himmel, Kindchen! Seit wann stehst du denn hier?«
»Gerade gekommen«, keuchte ich und hielt den Brief hoch.
»Ich habe eine Antwort.«
»Eine Antwort?«, fragte Dax, der hinter Mrs Makowski aus der Küche kam. »Von wem?«
»Vom Lee Strasberg Theatre and Film Institute.«
Dax machte große Augen und Mrs Makowski stellte das gefährlich schwankende Tablett ab.
»Mach schon auf!«, rief sie anschließend und stürmte, sich die mehlbestäubten Hände an ihrer Schürze abwischend, auf mich zu.
»Das … das kann ich nicht«, murmelte ich und legte den Brief auf einen der Tische. »Nicht heute.« Ich fuhr mir übers Gesicht und fühlte mich noch schlechter als zuvor. »Ich … ich habe heute meine Mutter beerdigt. Und ich habe dabei nicht einmal geweint. Egal, was in diesem Brief stehen wird«, ich biss mir auf die Lippe und ekelte mich vor mir selbst, »es wird mich zum Weinen bringen. Dabei sollte heute nichts wichtiger sein als meine Mom.«
Nicht weinen, Schatz. Ich komme dich holen, dann reden wir.
Erneut spukten diese hässlichen Worte durch meinen Kopf und formten sich zu einem Satz, der mir das Herz zerriss. Nicht daran denken!
Ich war eine furchtbare Tochter, so viel stand fest.
Am Grab hatte ich nicht eine Träne vergossen und die gesamte Prozedur als nervig empfunden. Und dann waren auch noch diese beiden Männer aufgetaucht und hatten das Begräbnis zu einem Rätselspiel verunstaltet.
Dieser Tag hatte sich überhaupt nicht wie ein Trauertag angefühlt. Und ausgerechnet heute bekam ich eine Antwort von der Schauspielschule, die mich dem einzigen Traum, den mir meine gerade eben erst begrabene Mutter stets auszureden versucht hatte, ein Stückchen näherbrachte.
Ging es noch respektloser?
Es fühlte sich an, als sei ich nicht traurig genug.
Als hätte ich meine Mutter zu wenig geliebt.
Denn alles, woran ich jetzt noch denken konnte, war das, was in diesem Brief stand.
»Du weißt, was Mom von meinem Ziel, Schauspielerin zu werden, gehalten hat«, sagte ich an Mrs Makowski gewandt. Immer, wenn wir hier Kaffee getrunken hatten, was mindestens einmal am Tag der Fall gewesen war, und ich mich mit meiner Mom über die Lee Strasberg unterhalten hatte, war das Gespräch in eine hitzige Diskussion ausgeartet. Nicht, weil sie diesen doch recht träumerischen Zukunftsplan für zu riskant gehalten hatte, sondern weil sie die Filmindustrie verachtete.
»Dafür hat sie das Theater geliebt«, warf Mrs Makowski ein.
»Das macht es ja nur noch schlimmer«, sagte ich. »Ich möchte Filmschauspielerin werden. Und genau solche bringt die Lee Strasberg hervor. Barbra Streisand, Laura Dern, Angelina Jolie, Uma Thurman. Außerdem ist die Schule in Hollywood.« Ich hörte meine Mutter förmlich in ihrem Grab zetern.
»Hollywood? Die Traumfabrik hat ihren Namen nicht ohne Grund, Indy. Dort werden aus deinen Träumen Produkte gemacht, für welche sie dich bezahlen lassen – mit allem, was dich ausmacht, bis du nur noch eine angepasste Version von dem Mädchen bist, das glaubte, etwas Besonderes zu sein.«
Das war das Denken einer Künstlerin gewesen, die sich selbst stets treu geblieben war.
Ganz gleich, wen sie damit verletzt hatte.
»Was, wenn ich abgelehnt wurde?«, fragte ich. »Was, wenn ich angenommen wurde?!«
»Ganz ruhig, Kindchen, jetzt atmen wir erst einmal tief durch und setzen uns.« Mrs Makowski nahm an dem Tisch Platz, auf dem der Brief lag. Dax gesellte sich mit einer Flasche Wein und drei Gläsern dazu. Widerwillig ließ ich mich auf einen Stuhl fallen.
Dax schenkte jedem von uns ein und ich nippte am Rotwein, der so samtig schmeckte, dass er mich augenblicklich beruhigte.
»Deine Mutter hat zwar nicht viel von der Schauspielerei gehalten, aber eines kann ich dir versichern«, sagte Mrs Makowski und prostete mir zu, »sie würde nicht wollen, dass du dich ihretwegen schlecht fühlst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand lauter über dieses schlechte Timing gelacht hätte als Lacie O’Malley.« Mrs Makowski schob mir den Brief zu.
»Öffne ihn heute oder morgen oder erst in einer Woche. Aber denk nicht eine Sekunde lang, dass du irgendetwas falsch gemacht hättest. Wir alle trauern auf unsere ganz eigene Art. Was auch immer du empfindest, ob du es willst oder nicht, hat seine Berechtigung.« Sie wurde ernster und hob mahnend den Finger. »Und die Indigo, die ich kenne, respektiert sich selbst genug, um das zu wissen.«
Dafür, dass Mrs Makowski keine eigenen Kinder hatte, wusste sie ganz genau, wie sie das kleine Mädchen in mir beruhigen konnte.
»Mrs Makowski hat gesprochen«, sagte Dax mit dramatischem Unterton, woraufhin sie die Faust spielerisch hob. Ich entspannte mich etwas und griff nach dem Brief.
»Da wir schon einmal hier so zusammensitzen«, murmelte ich. Wenn ich den Brief nicht jetzt öffnete, würde mich die Neugierde umbringen. Außerdem waren Dax und Mrs Makowski, abgesehen von Nora und Mikayla, sowieso die einzigen Personen in meinem Leben, mit denen ich sowohl gute als auch schlechte Nachrichten teilen wollte.
Ich öffnete den Brief, faltete das Papier auseinander und überflog die Zeilen. Mein Herz raste. Schweißperlen rannen mir über die Schläfe.
Ganz unten stand die Antwort. Fett gedruckt.
»Und?!«, fragte Dax, der nervös mit dem Stuhl kippelte.
»Was steht drinnen, Kindchen?«, fragte Mrs Makowski, die sich an ihrem leeren Weinglas festklammerte.
Ich schluckte schwer und sah auf – erleichtert, verängstigt, traurig und froh zugleich.
Ich wollte nicht darüber nachdenken, was wohl meine Mutter gefühlt hätte. Sie und mein altes Leben waren fort – und ich hielt meine Zukunft in der Hand.
»Ich wurde angenommen.«
3. Kapitel
Nicht ganz eine Woche nach der Beerdigung und der Zusage von der Lee Strasberg hatte sich bereits alles für mich verändert. Ich würde New York verlassen und nach L.A. ziehen, um auf meine Traumschule zu gehen. Nicht einmal mein schlechtes Gewissen würde mich davon ablenken können. Eigentlich sollte man in der Trauerphase keine lebensverändernden Entscheidungen treffen, aber die Ablenkung tat mir gut.
Zum Teufel mit den fünf Phasen der Trauer!
Ich war doch schon längst bei der Akzeptanz angekommen und brauchte die anderen Stufen gar nicht mehr. Und wenn doch, würde ich sie so lange aufschieben, wie es ging. Nicht jeder konnte es sich leisten, zu trauern, um zu heilen.
In solchen Momenten dachte ich gerne an Holly Golightly aus Breakfast at Tiffany’s. Schon ihr Nachname signalisierte ihre Lebensweise und ganz gleich, was für Schicksalsschläge sie trafen, sie ging mit Neugierde und Mut weiter. Am Anfang des Films war sie allein.
Genau wie ich.
Niemand würde eine Entscheidung für mich treffen. Niemand würde sich um all die Sachen kümmern, um die sich gekümmert werden musste, nur damit ich genügend Zeit für mich und meinen Kummer hatte.
Es gab genug anderes zu tun.
Kartons packen zum Beispiel.
»Wie viele Tassen habt ihr bitte?«, fragte mich Dax, der die Küche übernommen hatte.
»Das bleibt auf ewig ein Mysterium«, antwortete ich. »Du kannst gerne welche haben, wenn du willst.« Meine Mom hatte Tassen gesammelt und besonders hübsche auch gerne mal aus Coffee-Shops mitgehenlassen, wenn die Getränke so teuer gewesen waren, dass die Tasse – ihrer Meinung nach – im Preis mit inbegriffen war.
Ich ging in die Küche, um Dax zu helfen, Besteck und Gläser in Zeitungspapier einzuwickeln. Dabei fiel mir die New York Times von gestern in die Hand.
Ich überflog die Schlagzeilen und Überschriften, während ich eine Pulp Fiction-Tasse in das Kreuzworträtsel der Woche einwickelte.
Ich stieß auf eine weniger spannende Filmkritik und einen Nachruf auf die kürzlich verstorbene Drehbuchautorin Rosaly Everson, deren Tod mich ernsthaft schockierte; eine Kolumne über das Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die ich geflissentlich ignorierte, und natürlich haufenweise Krieg, Ungerechtigkeit, Rassismus, Homophobie, und was einen sonst noch so an der Menschheit verzweifeln ließ.
»Ich bin im Bad fertig«, unterbrach Mrs Makowski mein sarkastisches Selbstgespräch und kam zu uns in die Küche, um sich einen von ihren mitgebrachten Cupcakes zu nehmen. Neben das Bad hatte sie drei Kisten gestellt. Alle gefüllt mit ausgefallenem Make-up, auf dem Flohmarkt ergattertem Schmuck, unnötig vielen Parfüms, selbst bestickten Handtüchern und einer Sammlung Kakteen – die einzigen Pflanzen, die zu ermorden meine Mutter nicht geschafft hatte.
Der Druck, der sich in meiner Brust aufbaute, wuchs. Er kniff in mein Zwerchfell und wurde von Sekunde zu Sekunde widerlicher. Wir hatten begonnen, vierzehn Jahre Leben einzupacken. Ein Leben, in dem es nur meine Mom und mich gegeben hatte. Und nun verschenkte, verkaufte und verstaute ich alles, was sie ausgemacht hatte. Sollte ich nicht noch warten? Die Sachen ein oder zwei Monaten unberührt lassen? Seit Tagen rang ich mit mir, kam aber zu keinem Ergebnis, das meine Emotionen mit meinem Gewissen vereinbaren konnte. Mom würde sagen, dass alles, was ich fühlte, seine Berechtigung hatte, trotzdem kam es mir falsch vor, zu leben, während sie tot war.
Wie schon so oft wanderte mein Blick nach oben, zur Galerie, die ich noch immer nicht betreten hatte.
»Sag mal, Indy«, riss mich Dax aus meinen Gedanken. Er schob die Zeitungen auf der Theke beiseite und deutete auf die geöffneten Briefe, von denen einer das Wappen des New Yorker Police Departments trug.
»Hat die Polizei schon irgendwelche …«
»Nein«, unterbrach ich ihn schulterzuckend und wandte mich ab, um ins Wohnzimmer zu spazieren. »Nichts.«
Ich hörte Dax hinter mir tief einatmen und stopfte ein paar Decken in Kisten, damit ich das Mitgefühl in seinem Gesicht nicht sehen musste.
Moms Unfall war drei Wochen her und der Mistkerl, der sie überfahren hatte, noch immer nicht gefunden.
Nicht weinen, Schatz. Ich komme dich holen, dann reden wir.
Da war es wieder … mein ganz persönliches Gespenst.
Nicht weinen, Schatz. Ich komme dich holen, dann reden wir.
Nein. Heute ertrug ich das nicht. Geh weg, dachte ich. Komm heute Nacht wieder. Das Gespenst kam, daran konnte ich nichts ändern, nur manchmal ließ es sich auf später vertrösten. Wenn es dunkel und ich allein war.
Allein in Moms Bett, in ihr Schlafshirt mit der Aufschrift »New York« gekuschelt, mein Kuscheltier unterm Arm.
Ein zerschlissener Stoffbär, den mir mein Vater zur Geburt geschenkt hatte.
Dieser saß nun auf dem Sofa, weil er heute Morgen mit mir ferngesehen hatte, und glotzte mich mit seinem einen Auge an. Das andere war bereits vor Jahren abgefallen. Sein Bäuchlein bestand nur noch aus bunten Flicken, wodurch er wie etwas aussah, das aus Frankensteins Labor stammte.
Ich würde ihn trotzdem gegen nichts auf der Welt eintauschen.
»Bist du dir sicher?«, fragte Mrs Makowski und riss mich aus meinem Strudel aus Erinnerungen.
»Hm?«
»Bist du dir sicher, dass du das alles weggeben möchtest?« Sie räumte die Kisten von der Badezimmertür zur Haustür, wo Dax bereits einige aus der Küche gestapelt hatte. Mit Filzstift schrieb sie Badezimmer Lacie darauf.
Vierzehn Jahre aus einem kleinen Badezimmer mit hellblauen Kacheln – einfach eingepackt.
Aber lieber zu früh als zu spät. Wenn ich noch länger wartete, würde mich die Wehmut auf ewig in dieses Museum der Erinnerungen sperren.
Mom war weg und all ihre Dinge waren nur noch Dinge.
»Ganz sicher«, sagte ich und lächelte etwas zu verkrampft. Das Kind in mir wollte nicht weg. Das Kind in mir schrie und weinte, weil es sich vor Veränderungen fürchtete. Aber das Kind in mir hatte nichts mehr zu sagen.
Diese Wohnung, so sehr ich sie auch liebte, konnte ich nicht behalten. Zwei Mieten waren einfach zu teuer und die Schule war zu weit weg, um zwischen New York und L.A. zu pendeln.
Also hatte Nora mir angeboten, bei ihr einzuziehen. Sie hatte noch ein Zimmer frei und wohnte über ihrem Restaurant, das zwischen Venice Beach und dem Santa Monica Pier direkt am Strand lag. Es gab also Schlimmeres. Außerdem brauchte ich von dort aus nur eine knappe Stunde mit der Metro bis zur Schule. Ich freute mich jetzt schon auf unsere Tradition, nachmittags den Ocean Front Walk an der Strandpromenade abzufahren. Natürlich mit Rollschuhen und süßen Sport-Outfits, so wie sich das für echte junge Damen aus Los Angeles gehörte. Es war nicht nur ein ironischer Witz, sondern machte auch noch riesigen Spaß.
Mikayla war nie mit dabei, weil sie das Gleichgewichtsgefühl einer Kartoffel hatte und Sport für überbewertet hielt.
Sie wohnte in West Hollywood, wenige Gehminuten von der Lee Strasberg entfernt, aber ihre Wohnung hatte lediglich ein Schlafzimmer und wenn ich mich zwischen Nähe und Privatsphäre entscheiden musste, würde ich immer Privatsphäre wählen. Außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Designercouch in Mikaylas Penthouse-Wohnung so superbequem war.
Ich machte mich gerade daran, die lächerliche Sammlung von Kuschelkissen auszusortieren und entschied mich für zwei, die ich mitnehmen würde, als mein Handy klingelte.
»Was gibt’s?«, meldete ich mich.
»Stopp alles, was du gerade tust, und unterbrich mich nicht, während ich rede.« Mikaylas Stimme hatte diesen professionellen Boss-Unterton, dem man besser gehorchte.
»Okay.«
»Du hast morgen ein Casting.«
»Hä?«
»Unterbrich mich nicht.«
»Sorry.«
»Du hast morgen ein Casting, hier in L.A. Für einen neuen Spielfilm der Goldfarb Group«.
Ich atmete scharf ein und hielt die Luft an.
»Ja, jetzt darfst du etwas sagen!«, rief Mikalya, die offenbar auf meine Reaktion wartete.
»Vielen Dank. Und … SOLL DAS EIN VERDAMMTER SCHERZ SEIN?«
Die Goldfarb Group war nicht nur eine der größten und erfolgreichsten Filmproduktionsgesellschaften Amerikas, sondern der ganzen Welt. Sie lag nicht weit hinter Walt Disney Company und Universal Pictures. Ihre Filme wurden reihenweise für Oscars nominiert und gewannen jährlich mindestens einen in den Kategorien Bester Film, Beste Regie oder Bestes Originaldrehbuch. Kurzum: Der Name Goldfarb stand in Hollywood für Einfallsreichtum, Ästhetik und Erfolg.
»Wie kommen die denn auf mich?«, fragte ich perplex und begann durch die Wohnung zu wandern, während mich Dax und Mrs Makowski verwirrt ansahen.
»Keine Ahnung«, lachte Mikayla. »Sie werden dich in meiner Kartei oder irgendwann im Fernsehen gesehen haben.«
»Ja klar. Weil die Produzenten der Goldfarb Group ihre Schauspieler aus Werbungen für Shampoos, Chips und Waschmittel aussuchen oder aus schlecht geschriebenen Romcoms, die nicht mal eine zweite Staffel bekommen haben.«
Das war meine gesamte, schauspielerische Karriere, obwohl ich in der Serie About Summer and Snow lediglich in den letzten beiden Folgen mitgespielt hatte.
»Was, wenn das so ein George-Lucas-Dings ist«, überlegte Mikayla.
»Soll heißen?«
»Na ja, George Lucas hat für seine Filme auch extra unbekannte Schauspieler und Schauspielerinnen ausgesucht. Möglicherweise will Goldfarb für diesen Film ein frisches, unverbrauchtes Gesicht.«