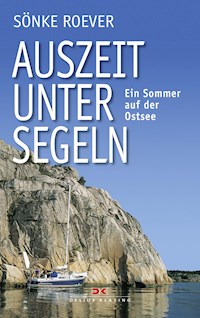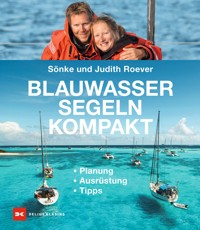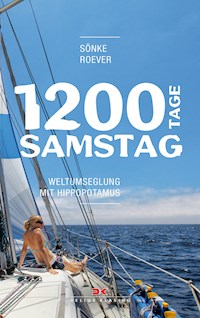Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bewährte Strategien, um die Zeit auf See zu genießen Die Ärztin Dr. Stefanie Kamke und der Weltumsegler Sönke Roever erklären anschaulich und verständlich die Ursachen und Mechanismen der Seekrankheit und wie Stress, Angst oder die menschlichen Sinne deren Entstehung begünstigen. Darüber hinaus liefern die Autoren konkrete Übungen, Methoden und Techniken aus Medizin, Psychologie und Bewegungslehre, die helfen, gewohnte Muster zu durchbrechen, damit Aktivitäten auf See zum Vergnügen werden und die Seekrankheit dauerhaft beseitigt wird. Das Buch basiert zwar auf dem aktuellen Stand der Forschung und unzähligen Rückmeldungen aus der weltweiten Seglergemeinschaft, ist aber bewusst kein wissenschaftliches Fachbuch, sondern ein Buch, das praxisnah Zusammenhänge aufzeigt und konkrete Handlungsstrategien vermittelt. Zum Verstehen, Erkennen, Behandeln und Vermeiden. Beim Segeln, Motorbootfahren, Tauchen und natürlich auch auf Kreuzfahrtschiffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Stefanie KamkeSönke Roever
seefit
statt seekrank
Mit Illustrationenvon Marion Schreiber
Inhalt
Vorwort
1Was ist Seekrankheit?
2Wer ist von Seekrankheit betroffen?
3Wie macht sich Seekrankheit bemerkbar?
4Wie entsteht Seekrankheit?
Medizinische Aspekte
Sinne
Sensorisches Konfliktmodell
Histamin und andere Botenstoffe
Psychologische Aspekte
Gelernte Muster
Stress und Stressreaktion
Angst
Aspekte der Bewegungslehre
5So wird man seefit
Medizinische Aspekte
Medikamente
Akupunktur und Akupressur
Homöopathie
Pflanzliche Therapie
Nahrungsergänzungsmittel
Sonstige Maßnahmen gegen Seekrankheit
Psychologische Aspekte
Gelernte Muster bewusst machen
Drehbücher positiv schreiben
Ziele positiv formulieren
Seefit-Tank auffüllen
Entspannung aktiv herbeiführen
Aspekte der Bewegungslehre
Die Faktoren der Bewegung
Der Gewöhnungseffekt
Das Konzert der Sinne
Augen schließen
Hinlegen
Schlafen
Das Ruder in die Hand nehmen
Am richtigen Horizont ausrichten
Den Horizont spüren
Seefit-Übungen an Land
Seefit-Übungen an Bord
Crewführung beim Segeln
Nachwort
Register
Vorwort
Die See kennt keine Gnade
Seien wir ehrlich – Seekrankheit ist für viele buchstäblich zum Kotzen. Und wenn sie das nicht ist, dann ist sie zumindest ein lästiges Übel, das jeder vermeiden möchte. So oder so ähnlich lässt sich wohl die allgemeine Wahrnehmung beschreiben, wenn jemandem an Bord flau wird.
Seekrankheit ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren. Auch wenn die Vorgänge im menschlichen Körper noch nicht vollständig erforscht sind, ist es möglich, die Seekrankheit mit den richtigen Maßnahmen, Methoden und Techniken nicht nur in Schach zu halten, sondern abzulegen.
„Seefit statt seekrank“ zu sein, lautet das Ziel dieses Buches. Um dies zu erreichen, betrachten wir das Thema aus den Blickwinkeln der Medizin, der Psychologie und der Bewegungslehre. Dabei ist dieses Buch bewusst kein wissenschaftliches Fachbuch, sondern soll dazu dienen, die vielseitigen Erscheinungsformen der Seekrankheit verständlich und nachvollziehbar zu erklären, um sie verstehen, erkennen, behandeln und vermeiden zu können.
Um das Ziel „seefit“ bestmöglich zu erreichen, ist es ratsam, das Buch der Reihe nach zu lesen, da die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauen.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Stefanie Kamke und Sönke Roever
1Was ist Seekrankheit?
Seekrankheit ist medizinisch gesehen eine Bewegungskrankheit, auch Kinetose oder Motion-Sickness genannt. Bei den Betroffenen kommt es dazu, wenn ungewohnte Bewegungsmuster die Sinne irritieren. Diese Irritation löst verschiedene Symptome aus – unter anderem die bei vielen Wassersportlern bekannte und gefürchtete Übelkeit. Relevant sind dabei passive Bewegungen, die auf den Körper einwirken. Aktive, selbst ausgeführte Bewegungen lösen nur sehr selten Symptome aus. Dieser Effekt ist gut im Rahmen der allgemeinen Reisekrankheit zu bemerken. Mitfahrern im Auto oder Bus kann übel werden, dem Fahrer des Fahrzeugs in der Regel nicht. Ähnlich verhält es sich im Flugzeug: Bei Turbulenzen wird normalerweise nur den Passagieren und nicht den Piloten schlecht.
Eine Bewegungskrankheit kann ebenfalls auftreten, wenn sich augenscheinlich der Raum und nicht der Körper bewegt. Diese Form der Bewegungskrankheit kann bei der Nutzung von Virtual-Reality-Brillen oder beim Spielen von Computerspielen auf besonders großen Bildschirmen auftreten und wird dann je nach Anwendung „simulator sickness“ oder „gaming sickness” genannt. Aus der Raumfahrt wiederum ist die „Space Motion Sickness“ oder auch Raumkrankheit bekannt, die durch den Verlust der Schwerkraft als Bezugsgröße hervorgerufen wird.
Yacht, Kreuzfahrtschiff, Motorboot, Flugzeug, Auto und Virtual-Reality-Brille, die Bewegungskrankheit kann in sehr unterschiedlichen Situationen auftreten.
Übelkeit und Erbrechen sind die am häufigsten genannten Symptome bei Seekrankheit.
Die bekannteste Form der Bewegungskrankheit ist die Seekrankheit. Sie entsteht durch ungewohnte Bewegungen und daraus resultierenden widersprüchlichen Sinneseindrücken. Es kommt zu einem Konflikt der Sinne und damit zur Auslösung der Symptome als natürliche Reaktion des Körpers auf den unbekannten Bewegungsreiz. So gesehen ist die Seekrankheit gar keine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Symptomkomplex.
Das wusste 1936 schon John Hill, Bordarzt des Passagierdampfers AQUITANIA, als er feststellte, dass es sich bei Seekrankheit um eine „physiologische Reaktion gesunder Individuen auf einen unphysiologischen Reiz“ handelt – sinngemäß eine normale Körperreaktion gesunder Menschen auf (für den Körper) unnormale Reize/Bewegungen.
Findet die Bewegung, die die Symptome auslöst, ein Ende, klingen diese innerhalb kürzester Zeit wieder ab. Viele Seereisende kennen den Effekt: Hängt man an Bord bei Seegang eben noch lethargisch in einer Ecke oder gar über der Reling, sind alle Beschwerden wie weggeblasen, sobald man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Der Begriff „Bewegungskrankheit“ ist daher gar nicht so gut gewählt. „Bewegungskonflikt“ oder „Bewegungsreaktion“ wäre treffender.
Seekrankheit mal andersherum
Manche Menschen haben nach einer längeren Seereise Schwierigkeiten, an Land aufrecht und geradeaus zu laufen; andere wiederum fallen bei den ersten Schritten einfach um. Hin und wieder treten auch Schwindel, Müdigkeit oder Kopfschmerzen auf. In abgeschwächter Form kennen einige das Gefühl, dass nach einer gewissen Zeit auf See dann an Land der Raum, in dem sie sich befinden, schwankt. Besonders ausgeprägt ist diese Wahrnehmung in kleinen Räumlichkeiten wie der Toilette oder der Dusche. Dann haben sich die Sinne stark an das schwankende Schiff adaptiert, und der Körper ist durch das plötzliche Umschalten von wackeligem zu festem Untergrund irritiert, sodass es quasi zu einer Verkehrung der Seekrankheit kommt. Dieser Effekt kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, verschwindet meistens aber nach kurzer Zeit wieder. Bleiben die Symptome länger als 48 Stunden bestehen, werden sie als Landkrankheit oder „Mal de Debarquement“ bezeichnet.
2Wer ist von Seekrankheit betroffen?
Seekrankheit betrifft nicht nur ein paar wenige Personen. Im Gegenteil, sie ist unter Seefahrern weit verbreitet und trifft keineswegs nur jene, die noch Neulinge auf dem Wasser sind. Auch erfahrene Wassersportler und Seereisende können seekrank werden. Wenn die Bedingungen an Bord schlecht genug sind, erwischt es fast jeden. Das zeigen Versuche mit Personen in Rettungsinseln bei Seegang: Ist die Aufenthaltsdauer sehr lang und/oder die Bewegungen sehr stark, werden nahezu alle Insassen seekrank.
Grob geschätzt sind rund 90 Prozent der Menschen in irgendeiner Form für die Seekrankheit anfällig. 30 Prozent von denen, die zeitweise oder auch öfter ein Boot besteigen, werden regelmäßig seekrank; von diesen 30 Prozent wiederum befinden sich 10 Prozent am oberen Ende der Skala und werden nahezu immer und sehr stark seekrank. Die Symptome sind dabei unterschiedlich ausgeprägt und treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Einigen Menschen reicht schon ein leichtes Schaukeln des Schiffs im Hafen, andere erwischt es erst bei schwerem Seegang.
Die im Folgenden vorgestellten Kriterien – Alter, Geschlecht, Herkunft und Vorerkrankungen – haben einen Einfluss auf die Anfälligkeit für Seekrankheit. Wichtig zu verstehen ist dabei, dass sie lediglich eine Tendenz oder eine Art Basisrisiko aufzeigen, jedoch definitiv nicht die Haupteinflussfaktoren für das Auftreten von Seekrankheit sind.
Alter
Fangen wir vorne im Leben an: Wenn Kinder noch sehr klein sind, und insbesondere, wenn sie noch nicht laufen können, stellt die Seekrankheit kein Problem dar. Das liegt unter anderem daran, dass der Gleichgewichtssinn bei Kleinkindern noch nicht vollständig entwickelt ist. Ab dem zweiten Lebensjahr kann Seekrankheit auftreten. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die meisten kleinen Kinder, die mit an Bord eines Bootes genommen werden, noch nicht mit dem Thema Seekrankheit konfrontiert wurden – sie kennen oder verstehen es (noch) nicht und haben keine Angst davor. Man könnte auch sagen, dass sie unvoreingenommen an die ganze Sache herangehen und sich keine Gedanken über die Seekrankheit machen. Wer also bisher Bedenken hatte, kleine Kinder mit an Bord zu nehmen, dem können wir entgegenhalten: In Bezug auf Seekrankheit stellt das in den wenigsten Fällen ein Problem dar. Es ist sogar sehr sinnvoll, Kinder bereits mit an Bord zu nehmen, wenn sie noch sehr klein sind, weil sie damit von klein auf an das Geschaukel im Boot gewöhnt werden.
Ab dem Erwachsenenalter gilt die einfache Regel: je älter, desto besser. Aus Studien ist bekannt, dass bei Erwachsenen im Alter das Risiko für das Auftreten der Seekrankheit sinkt. Einer der Gründe dafür ist, dass mit zunehmendem Alter die Sensibilität des Gleichgewichtsorgans abnimmt.
Geschlecht
Frauen werden häufiger seekrank als Männer, und die Phase der Gewöhnung an den ungewohnten Bewegungsreiz dauert bei ihnen länger. Außerdem variiert das Auftreten der Seekrankheit während des weiblichen Zyklus – beispielsweise tritt sie während der Regelblutung eher auf als zum Zeitpunkt des Eisprungs. Zudem sind schwangere Frauen anfälliger. Vor diesem Hintergrund werden sowohl die höhere Empfindlichkeit als auch die wechselhafte Anfälligkeit bei der Seekrankheit oft mit dem weiblichen Hormonhaushalt begründet.
Herkunft
Neben Alter und Geschlecht spielt auch die Herkunft eine Rolle bei der Seekrankheit. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Menschen afrikanischer, amerikanischer oder europäischer Herkunft deutlich weniger anfällig sind als Menschen asiatischer Herkunft. Vermutet wird unter anderem eine genetisch bedingte erhöhte Produktion eines bestimmten Botenstoffs im Körper. Für die genetische Komponente sprechen auch Untersuchungen mit Zwillingen, die zeigen, dass unter Bewegungssimulation beide Zwillinge in gleichem Ausmaß reagieren.
Vorerkrankungen
Es gibt Vorerkrankungen, die das Auftreten der Seekrankheit stärker beeinflussen als andere. Wer beispielsweise unter Migräne leidet, wird häufiger seekrank. Auch das Vorliegen einer Histaminintoleranz erhöht das Risiko, seekrank zu werden. Zudem können bestimmte Medikamente das Auftreten von Übelkeit fördern, auch wenn die Grunderkrankung selbst das Risiko nicht verstärkt, beispielsweise einzelne Antibiotika oder Schmerzmittel.
Alter, Geschlecht und Herkunft sind hinsichtlich Seekrankheit Faktoren, die sich nicht beeinflussen lassen.
3Wie macht sich Seekrankheit bemerkbar?
Fragt man Menschen nach den Symptomen der Seekrankheit, werden Übelkeit und Erbrechen am häufigsten genannt. Fast jeder kennt Berichte von Seglern, die „die Fische gefüttert“ haben, oder von Kreuzfahrt-Passagieren, die „über der Reling hingen”. Und wer schon einmal bei stürmischem Wetter in der Elbmündung mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland übergesetzt hat, dem dürfte das Thema Seekrankheit ebenfalls begegnet sein.
Doch Übelkeit und Erbrechen sind bei Weitem nicht die einzigen Symptome der Seekrankheit. Bereits im Vorfeld treten verschiedene Symptome auf, beispielsweise Blässe, Schweißausbrüche und/oder vermehrter Speichelfluss. Die Atmung verändert sich und wird, ähnlich wie in Stresssituationen, mit zunehmender Seekrankheit schneller und stärker. Außerdem können Kopfschmerzen hinzukommen.
Seekrankheit bringt aber auch Beschwerden mit sich, die nicht so offensichtlich zum Symptomkomplex der Seekrankheit gehören und ebenfalls der Übelkeit vorausgehen. Wer schon einmal eine längere Seereise unternommen hat, wird rückblickend vielleicht feststellen, dass die ersten ein bis zwei Tage an Bord nicht die besten waren. Viele Segler hängen zu Beginn eines Törns an Bord „in den Seilen“, sind sehr müde, müssen ständig gähnen und haben wenig Lust auf all die anfallenden Arbeiten, die an Bord so zu tun sind. Dann bleibt das Segel auch mal länger ungetrimmt, Logbucheinträge werden kurzgehalten und Reparaturen werden nur gemacht, wenn es unbedingt sein muss. Es herrscht eine gewisse Lethargie und Antriebslosigkeit an Bord.
Das Frühstadium der Seekrankheit – das Sopite-Syndrom
Müdigkeit
unkontrolliertes Gähnen
Antriebslosigkeit
Desinteresse
Lethargie
Dieser Symptomkomplex aus Müdigkeit, Gähnen, Antriebslosigkeit, Desinteresse und Lethargie wird als Sopite-Syndrom (englisch für einlullen, schläfrig machen) bezeichnet. Es gilt als eine Art Frühstadium der Seekrankheit, auch wenn es inzwischen den Status eines eigenständigen Syndroms innehat.
Bereits während des Sopite-Syndroms kommt es zu einem körperlichen und mentalen Leistungsabfall, meist ohne dass es dem Einzelnen in der Situation wirklich bewusst ist oder Übelkeit und Erbrechen als klassische Symptome auf die Seekrankheit hinweisen.
Diese beiden Crewmitglieder befinden sich im Frühstadium der Seekrankheit (Sopite-Syndrom).
Nicht jedem Sopite-Syndrom folgt Seekrankheit mit Übelkeit und Erbrechen, aber jeder Seekrankheit geht das Sopite-Syndrom voraus.
4Wie entsteht Seekrankheit?
Die Antwort auf die Frage „Warum werde ich seekrank?“ ist für uns eine der wichtigsten Fragen rund um das Thema Seekrankheit. Denn wer versteht, wie es überhaupt zur Seekrankheit kommt, kann Lösungen zur Vorbeugung und Behandlung finden und die Angst vor der Seekrankheit abbauen.
Um die Frage nach dem Warum zu beantworten, hilft es zu verstehen, dass die Seekrankheit nicht auf einem einzelnen Faktor beruht, sondern durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren entsteht. Es gibt sozusagen unterschiedliche Vorgänge im menschlichen Körper, die dazu führen, dass sich die entsprechenden Symptome äußern. Da es unterschiedliche Vorgänge sind, werden sie in diesem Buch einzeln aus den Blickwinkeln der Medizin, der Psychologie und der Bewegungslehre betrachtet. Aus diesen drei Blickwinkeln wird zwar das gleiche Problem betrachtet, aber jeweils von einer anderen Seite beleuchtet. Je nach Blickwinkel treten dann andere Aspekte in den Vordergrund. Zur Verdeutlichung kann man sich einen Elefanten vorstellen, um den herum drei Betrachter auf Stühlen sitzen. Ein Betrachter sitzt hinter dem Elefanten, ein Betrachter schräg links vor ihm und ein Betrachter schräg rechts vor ihm. Die Betrachter stehen sinnbildlich für die genannten Bereiche Medizin, Psychologie und Bewegungslehre. Bei dieser Anordnung sieht jeder Betrachter ein anderes Bild des Elefanten. Beispielsweise sieht der Betrachter hinter dem Elefanten dessen Hinterteil, nicht aber seinen Rüssel. Der Betrachter schräg links vor dem Elefanten wiederum sieht den Rüssel, ein Auge und ein Ohr, nicht aber das Hinterteil. Mit anderen Worten: Die Blickwinkel und die damit zusammenhängenden Ansichten des Elefanten sind unterschiedlich, obwohl alle drei Betrachter denselben Elefanten ansehen.
Je nach Blickwinkel ist die Ansicht des Elefanten eine etwas andere.
Medizinische Aspekte
Die ungewohnten Bewegungen eines Schiffes können körperliche Reaktionen auslösen. Es geht um Sinnesorgane und um Botenstoffe.
Psychologische Aspekte
Die ungewohnten Bewegungen eines Schiffes können psychische Reaktionen auslösen. Es geht um Stress, Angst und Erwartung.
Aspekte der Bewegungslehre
Die ungewohnten Bewegungen eines Schiffes können in Kombination mit den eigenen Bewegungen an Bord ursächlich für die Seekrankheit sein.
Im Folgenden werden wir aus diesen drei Blickwinkeln die Seekrankheit ausführlich betrachten. So entsteht ein umfassendes Gesamtbild der Seekrankheit und es wird ersichtlich, warum Menschen seekrank werden und was dagegen unternommen werden kann.
Medizinische Aspekte
Sinne
Um die Ursachen der Seekrankheit besser zu verstehen, ist es notwendig, sich etwas genauer mit den Sinnesorganen des Menschen zu beschäftigen. Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Mehr noch: Sie nehmen Reize von außen auf und verarbeiten sie.
Es gibt fünf klassische Sinne: den Sehsinn (Auge), den Hörsinn (Ohr), den Geruchssinn (Nase), den Geschmackssinn (Mund) und den Tastsinn (Haut). Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere wichtige Sinne, die nicht so offensichtlich auf der Hand liegen: den Gleichgewichts- sowie den Tiefensinn. Diese beiden Sinne werden zusammen auch als Lagesinn bezeichnet und sind für die Wahrnehmung von Körperhaltung und Bewegung im Raum unerlässlich.
Sinn
System
Sehsinn
Visuelles System
Hörsinn
Auditives System
Geruchssinn
Olfaktorisches System
Geschmackssinn
Gustatorisches System
Tastsinn
Taktiles oder haptisches System
Gleichgewichtssinn
Vestibuläres System
Tiefensinn
Propriozeptives System
Von diesen sieben Sinnen sind drei Sinne hauptsächlich an der Entstehung der Seekrankheit beteiligt: der Sehsinn, der Gleichgewichtssinn und der Tiefensinn.
Die drei Sinne der Seekrankheit:Sehsinn, Gleichgewichtssinn und Tiefensinn.
Sehsinn
Der Sehsinn ist ein sehr präsenter Sinn. Über das Auge als zugehöriges Sinnesorgan ist ersichtlich, wo sich der Körper im Raum befindet und wie die Umgebung aussieht. Es stellt für die meisten Menschen das wichtigste Sinnesorgan dar.
Gleichgewichtssinn
Das körperliche Gleichgewicht wird durch das Gleichgewichtsorgan vermittelt. Es ist ein Teil des Innenohrs und vermittelt über zwei verschiedene Untersysteme, welche Beschleunigung ein Mensch erfährt. Das eine Untersystem besteht aus drei Bogengängen, das andere aus zwei Makulaorganen. Während die drei Bogengänge auf Drehbewegungen des Kopfes reagieren (schütteln, nicken, wackeln), springen die zwei Makulaorgane auf gerade Bewegungen des Kopfes an (vorwärts, rückwärts, seitwärts, auf- und abwärts).
Das Gleichgewichtsorgan sitzt im Innenohr.
Bogengänge
Darstellung der Bogengänge mit ihren Ebenen. Jede Ebene steht für eine andere Bewegungsrichtung.
Ohne Drehbewegung sind die Sinneshärchen gerade ausgerichtet.
Bei Drehbewegungen werden die Sinneshärchen in eine Richtung abgelenkt.
Die drei Bogengänge sind wie drei aneinandergrenzende Seiten eines Würfels angeordnet und mit einer Flüssigkeit gefüllt. Sie haben an einem Ende eine Verdickung, in der sich die eigentlichen Sinneszellen befinden. Die Sinneszellen (rot) sind in einem knöchernen Teil des Innenohrs verankert und haben Härchen (rot), die in eine gallertartige Masse (türkis) ragen. Diese Masse ist von der Flüssigkeit der Bogengänge (dunkelblau) umgeben. Kommt es zu einer Drehbewegung des Kopfes, so bewegt sich das Innenohr und mit ihm der knöcherne Teil (grün), in dem die Sinneszellen verankert sind.