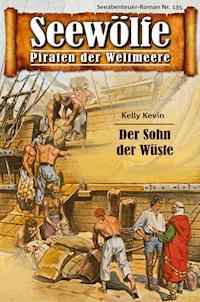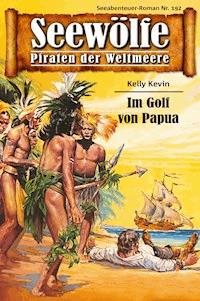Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Zischend lösten sich zwei der Raketen von der "Isabella" und zogen ihre funkensprühende Bahn zum Hafen hinüber. Noch in der Luft zerplatzten sie und verstreuten gleich explodierenden Sonnen ihre Flammen. Erschrockene Schreie gellten. Auf den getroffenen Schiffen brachen an zahllosen verschiedenen Stellen Brände aus. Auf der "Isabella" hatten die Männer bereits die Bronzegestelle nachgeladen. Wieder flogen zwei der Raketen zischend los. Die Ankerwache auf den spanischen Galeonen sprangen ins Wasser, um sich vor dem chinesischen Feuer in Sicherheit zu bringen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
© 1976/2015 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-471-5
Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
Waffen klirrten.
Laut hallten die schweren Stiefeltritte der Soldaten zwischen den weißen Hauswänden. Im Außenhafen von Bilbao waren die engen Gassen wie ausgestorben. Ab und zu zeigte sich eine verstohlene Bewegung an einem der Fenster, und in den ärmlichen Hütten hielten die Menschen den Atem an.
Am Ende der Gasse verstummten die Schritte der Soldaten.
Flackerndes Kerzenlicht erfüllte die einzige Stube im Haus des Fischers Diego Durango. Mamma Durango ließ die Maisfladen sinken, die sie zu Tortillas formte. Am Tisch hob ihre Schwiegertochter Maria den Kopf und lauschte. Ein halbes Dutzend Kinder lugte aus dem Alkoven, der mit einer bunten, gewebten Dekke verhängt war.
Kein Zweifel: die Soldaten verharrten vor diesem Haus.
Jetzt hämmerte eine harte Faust gegen die Tür. Mamma Durango wischte ihre Hände an der Schürze ab und straffte die hageren Schultern.
„Rasch, Maria!“ flüsterte sie. „Nimm die Hintertür! Du weißt, wo du dich verstecken kannst.“
„Aber die Kinder …“
„Sie werden den Kindern nichts tun. Schnell jetzt!“
Die junge Frau sprang auf.
Angst verzerrte ihr hübsches Gesicht. Sie dachte an Diego, ihren Mann, den die spanischen Soldaten verhaftet hatten. Jetzt saß er im Kerker der Festung und wurde vielleicht gefoltert. Aber warum wollte man auch sie holen? Weil sie Diegos Frau war? Weil sie Baskin war? Als ob sie sich je um die Freiheit des Baskenlandes gekümmert hätte! Freiheit – das hieß für sie, genug zu essen zu haben. Das hieß Schuhe und warme Kleider für die Kinder, Geld für den Medico, wenn eins von ihnen krank wurde.
Ihre Gedanken stockten.
Sie hatte die Hintertür erreicht. Ihr Herz hämmerte schmerzhaft, als sie die schweren Stiefeltritte im Torweg hörte. Die Soldaten ahnten, wohin sie floh und wollten ihr den Weg abschneiden. Mit zitternden Fingern stieß Maria Durango die Tür auf, aber da war es bereits zu spät.
Pechfackeln erfüllten den Hof mit ihrem flackernden Licht. Zwei, drei von den Soldaten in ihren Kürbishosen, Brustpanzern und glänzenden Helmen sprangen hinzu und packten Marias Arme. Die junge Frau schrie auf. Verzeifelt versuchte sie, sich zu wehren, doch gegen die kräftigen Männer hatte sie keine Chance.
„Was wollt ihr?“ rief sie. „Ich habe nichts getan! Ich schwöre es!“
„Nichts getan?“ Der Anführer der Soldaten lachte roh. „Du bist mit dem baskischen Rebellenpack im Bunde, du Hexe. Der Comandante will dich sehen.“
„Uvalde?“
Maria hauchte den Namen nur. Sie erwartete keine Antwort. Benito Uvalde – das war der Hafenkommandant von Bilbao. Sein Name verbreitete Furcht und Schrecken. Er haßte die Basken, und die Basken haßten ihn. Ein Haß, den er kannte, der ihn dazu brachte, sich so selten wie möglich in Bilbao oder Portugalete sehen zu lassen, sich fast ständig in seinem Haus im Innern der Feste zu verkriechen, die sich grau und wehrhaft an der Flußmündung erhob und die Häuser des Außenhafens überragte.
Und Uvalde wollte sie, Maria Durango, sehen?
Sie zitterte, als sie zwischen den Soldaten die steile Gasse hinunterging. Deutlich spürte sie die Blicke, die ihr folgten, Blicke voll ohnmächtigen Zorns, voll Erbitterung und Verzweiflung. Hier draußen in Portugalete standen die meisten Basken auf der Seite der Rebellen. Aber was nutzte das? Sie waren einfache Fischer und Bauern, haben kaum Waffen und mußten an ihre vielköpfigen Familien denken. Nur wenige wagten es, sich offen zu El Vasco zu bekennen, dem legendären Rebellenführer, der irgendwo in den kantabrischen Bergen seinen Schlupfwinkel hatte.
Einer dieser wenigen war Diego Durango, Marias Mann.
Er war verhaftet worden, als er am hellichten Tag versuchte, Gewehre in das Rebellennest zu transportieren – zusammen mit Gian Malandrés, El Vascos Bruder. Jeder wußte, daß Benito Uvalde die Gefangenen foltern ließ, um das Wissen über El Vascos Versteck aus ihnen herauszupressen. Aber bei den Basken gab es keinen Verrat. Niemand zweifelte daran, daß die Männer der Tortur widerstanden hatten.
Und jetzt? Holte sich Uvalde jetzt ihre Frauen, um zu erzwingen, was er anders nicht erreichen konnte? Er war niederträchtig, skrupellos und zu jeder Gemeinheit fähig. Deutlich glaubte Maria, das feiste Gesicht vor sich zu sehen, und die Furcht jagte ihr eisige Schauer über den Rücken.
Quer durch Portugalete wurde sie zu der Landzunge geführt, auf der sich die Festung erhob.
Blindlings sperrte sie sich gegen die Griffe der Männer, als das schwere Tor vor ihr aufschwang. Sie wußte, daß es sinnlos war, aber sie kam nicht an gegen die Reaktion der Panik. Mit einem dumpfen, endgültigen Laut fiel das Tor wieder ins Schloß, und Maria Durango wurde weitergestoßen.
Die äußere Befestigungsanlage.
Das Haus des Hafenkommandanten, die Unterkünfte der Soldaten, ein paar holprige Gassen – und die innere, die eigentliche Festung. Die meisten Soldaten blieben zurück. Nur der Anführer der Horde und zwei seiner Männer zerrten Maria Durango weiter, einen kahlen, feuchten Gang entlang, eine Wendeltreppe hinunter, die tief in die Gewölbe der Festung führte.
Ein kaltes, schmutziges Verlies war das Ziel.
Pechfackeln warfen ihr unruhiges Licht über die feucht schimmernden Steinquader. Maria zuckte zurück, als sie das breite, rote Gesicht des Hafenkommandanten sah. Benito Uvalde stand mit verschränkten Armen an der Wand und sah ungerührt zu, wie die zitternde Frau in Ketten gelegt wurde.
„Gut“, sagte er schließlich zufrieden. „Und jetzt holt ihn her!“
Maria schloß die Augen.
Sie wußte, was folgen würde. Die Schritte der Soldaten entfernten sich. Nach ein paar Minuten kehrten sie zurück – und jetzt mischte sich in das harte Klappern der Stiefel das Geräusch schleppender, mühsamer Schritte.
„Maria!“
Der Schrei brach sich zwischen den Wänden. Die junge Frau hob den Kopf und sah in das bärtige, verzerrte Gesicht mit den verzweifelten Augen. Schmerz schnürte ihr die Kehle zu. O Diego, Diego! Er würde nicht ertragen, daß ihr etwas geschah. Er würde reden, alles verraten, und er würde es sich nie verzeihen.
„Sag es nicht“, flüsterte sie. „Sag ihnen nichts, Diego, nichts …“
Ein Schlag traf ihr Gesicht.
Diego stieß einen wilden Schrei aus, und durch den Schleier der Benommenheit sah sie, wie er sich aufbäumte und sich die Soldaten von allen Seiten auf ihn stürzten, um ihn niederzuringen.
Der Kerker der Festung bestand aus einem großen Gewölbe, in dem fauliges Stroh die einzige Bequemlichkeit für die unglücklichen Gefangenen bildete.
Ein stabiles Gitter mit armdicken Eisenstäben trennte den Raum für die Wachen ab. Im Schein einer blakenden Öllampe hockte sie an ihrem roh gezimmerten Holztisch, würfelten oder spielten mit schmierigen Karten – tagaus, tagein. Sie kümmerte es nicht, was mit den Gefangenen geschah. Ob die ausgemergelten, bärtigen Gestalten stundenlang stumpf vor sich hinstarrten, ob sie zu toben begannen oder flüsternd beieinandersaßen — den Wächtern konnte es gleich sein. Sie nahmen nur ihre schweren Musketen zur Hand, wenn jemand geholt oder wieder zurückgebracht wurde, und sorgten dafür, daß dann niemand dem Gitter zu nahe geriet.
Gian Malandrés, der baskische Rebell, kauerte in einer der gewölbten Nischen und drückte die Schultern gegen die Wand.
Drei, vier dunkle, drahtige Basken waren um ihn – und ein halbes Dutzend hochgewachsener, blondhaariger Männer mit hellen Augen. Marius van Helder, der Geusenkapitän, lehnte ebenfalls an der Wand. Seine rechte Hand war mit einem Holzbrett und ein paar Stoffstreifen provisorisch geschient: er hatte sie sich im Kampf um sein Schiff gebrochen, die „Oranje“, die im Golf von Biscaya von einem Verband spanischer Kriegsgaleonen versenkt worden war. Aber die gebrochene Hand war nicht Van Helders einzige Verletzung. Die Spanier hielten ihn für einen wertvollen Gefangenen, von dem sie sich eine Menge Informationen versprachen. Denn Marius van Helder gehörte zu den führenden Köpfen der Wassergeusen, die den Spaniern in den Niederlanden immer noch erbitterten Widerstand leisteten.
Der Kapitän lächelte leicht, als er an die Geschichte dachte, die er – genau wie seine Männer – unter der Folter erzählt hatte.
Benito Uvalde war jetzt überzeugt davon, daß sich die Schiffe der Wassergeusen bei den Azoren sammelten, um durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer einzubrechen und Spaniens Kräfte aufzusplittern. Ein Märchen, aber ein Märchen, das vor allem nach dem Überfall Sir Francis Drakes auf Cadiz nur zu leicht Glauben finden würde. In Wahrheit gab es nur noch ein einziges Geusenschiff vor Spaniens Küsten: die „Hoek van Holland“ unter ihrem Kapitän Jan Joerdans. Mit ihm und der „Anneke Bouts“ hatte sich Van Helder auf einer Insel im Golf von Biscaya treffen wollen. Aber die „Anneke Bouts“ war im Sturm zerschellt, und die „Oranje“ war versenkt worden, noch ehe sie ihr Ziel erreichte.
Marius van Helder wußte nicht, daß seine Freunde inzwischen Verbündete gewonnen hatten.
Er wußte auch nicht, daß die „Hoek van Holland“ und die „Isabella VIII.“ in einer versteckten Bucht in der Nähe von Bilbao lagen und der Seewolf Philip Hasard Killigrew, den die Spanier El Lobo del Mar nannten, zusammen mit Jan Joerdans und den Geusen längst einen Plan geschmiedet hatte, um die Gefangenen aus der Festung zu befreien. Die „Hoek van Holland“ hatte der „Isabella“ geholfen, als sie schwer angeschlagen vom Sturm ins Gefecht gegen eine spanische Übermacht gehen mußte. Und die Seewölfe hatten sich revanchiert. Sie wußten, daß die Geusen ihre Verbündeten waren. Männer, die seit langen Jahren gegen die spanische Terrorherrschaft kämpften, denen alle englischen Häfen offenstanden und die auch nicht tatenlos zusehen würden, wenn Philipp II. eines Tages doch noch seine Armada aussandte, um ein spanisches Heer aus den Niederlanden nach England überzusetzen.
Marius van Helder ahnte nicht, daß die Seewölfe in der Nähe waren.
Für ihn stand fest, daß er diesen Kerker mit seinen Folterkammern nicht mehr lebend verlassen würde. Oder nur noch einmal: um auf den öffentlichen Richtplatz geführt zu werden, wo ihn wie einen gemeinen Verbrecher die Garotte erwartete. Die Hoffnung, daß die baskischen Rebellen sie befreien könnten, teilte er nicht. Sie hatten es noch nie geschafft, einen Gefangenen aus dem Kerker zu holen, und sie würden es wohl auch diesmal nicht schaffen. Auch nicht, wenn der Gefangene Gian Malandrés hieß und der Bruder El Vascos war.
Van Helder hob den Kopf, als er das Gitter klirren hörte.
Ein Gefangener wurde hereingestoßen. Einer der Basken: bärtig, hager, von der Folter gezeichnet, der er genau wie seine Kameraden widerstanden hatte. Aber jetzt hatte sich sein Gesicht verzerrt, und die tiefliegenden Augen wirkten stumpf und wie erloschen.
„Diego!“
Leise und scharf stieß Gian Malandrés den Namen durch die Zähne. Diego Durango taumelte, als er sich gegen die Wand der Nische stürzte. Stumm blieb er dort stehen, ein gebrochener Mann — und Malandrés schien sofort zu wissen, was geschehen war.
„Verräter!“ zischte er.
„Sie hatten Maria.“ Diegos Stimme zitterte. „Sie drohten, Maria zu foltern. Ich konnte es nicht ertragen …“
„Verräter! Wegen einer Frau! Was hast du ihnen gesagt?“
„Alles“, murmelte Diego dumpf. „Alles, was sie wissen wollten …“
„Das Versteck in den Bergen?“
„Ja.“
„Namen?“
„Nein. Sie wollten keine Namen. Nur das Lager …“
Malandrés Nasenflügel vibrierten, als er ausatmete. Langsam stand er auf, beugte sich vor und tastete nach dem Messer in seinem Stiefel. Jenem Messer, mit dem er eines Tages Benito Uvalde umbringen wollte, wenn er nur nahe genug an ihn herankam.
Geschmeidig sprang Marius van Helder auf und legte dem Basken die Linke auf den Arm.
„Nicht, Gian“, sagte er ruhig.
„Er hat uns verraten! Dieser Hund hat …“
„Hast du eine Frau, Gian?“
„Nein, zum Teufel, ich …“
„Aber du hast einen Bruder. Weißt du, was du tun würdest, wenn die Spanier drohten, deinen Bruder vor deinen Augen bestialisch umzubringen? Bist du dir deiner selbst so sicher?“
Melandrés biß die Zähne zusammen.
Sein Blick wanderte zu dem hageren blonden Mann hinüber, der an der Wand lehnte – zu dem anderen Verräter. Er hieß Barend von Gemert, und er war als Kurier nach Spanien geschickt und erwischt worden. Wochenlang hatten Uvalde und seine Henker ihm zugesetzt – bis er verriet, wo die „Oranje“ zu finden war und die Spanier ihre Treibjagd beginnen konnten. Aber die Geusen hatten ihn trotzdem nicht ausgestoßen. Nicht einer von ihnen könne von sich selbst wissen, ob er nicht das gleiche getan hätte – das waren Marius van Helders Worte gewesen.
Nach einem Augenblick des Schweigens ließ Gian Malandrés die Hand mit dem Messer sinken.
„Gut“, sagte er leise. „Vielleicht hast du recht, Holländer. Vielleicht sollte sich wirklich niemand als Richter aufspielen, bevor er nicht seinen eigenen Weg zu Ende gegangen ist.“
Er setzte sich wieder und schob das Messer zurück in den Stiefel.
Nachdenklich starrte er in das faulige Stroh vor seinen Füßen. Er wäre noch nachdenklicher geworden, wenn er gewußt hätte, wie nahe sein eigener Bruder, der legendäre El Vasco, noch vor wenigen Stunden dem niederträchtigsten Verrat gewesen war.
2.
Feuer flackerten auf dem Plateau in den kantabrischen Bergen.
Im Lager der baskischen Rebellen hatten sich mehr als fünfzig Männer versammelt. Ein Hammel wurde am Spieß gedreht, Fett tropfte zischend in die Glut der Kohlengrube. Weinschläuche kreisten, und die leisen Stimmen erfüllten die Senke zwischen den Felsen wie das stete, unruhige Murmeln von Meereswogen.
Philip Hasard Killigrew lehnte an einem Steinblock und betrachtete seine beiden Söhne, die sich wie kleine Katzen im Gras zusammengerollt hatten und den Schlaf der Erschöpfung schliefen.
Sie hatten ihn verdient, diesen Schlaf. Schließlich waren sie die Helden des Tages gewesen und entsprechend gefeiert worden – obwohl Hasard immer noch nicht sicher war, ob ihnen nicht eigentlich der Hintern versohlt gehörte. Verholten sich diese Bengel doch heimlich von der „Isabella“, um ihren Vater, Al Conroy, Sam Roskill und die beiden Geusen Jan Joerdans und Friso Eyck aus der Gefangenschaft bei den baskischen Rebellen zu retten. Die Zwillinge hatten nämlich mitgekriegt, daß das Plateau hier oben uneinnehmbar war. Auf drei Seiten fielen schroffe Felswände ab, die bewacht wurden. Die vierte Seite brauchte nicht bewacht zu werden: ein wilder Gebirgsstrom in einer tiefen, völlig unbesteigbaren Schlucht bildete eine natürliche Barriere. Nicht einmal mit Enterhaken und Seilen ließ sich diese Schlucht überwinden – die Felsen waren nämlich so morsch, daß die Haken ausbrachen, sobald sie das Gewicht eines Mannes tragen mußten.
Arwenack, der Schimpanse, könne es vielleicht so gerade eben schaffen, hatten die Männer auf der „Isabella“ überlegt, nachdem sie von ihrem Erkundungsmarsch zurückgekehrt waren.