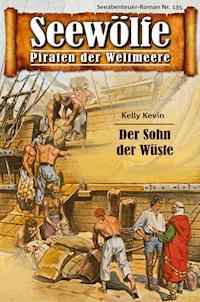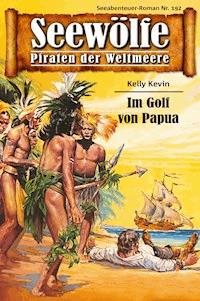Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Mit einem infernalischen Donnern, das die Luft zittern ließ und in den Ohren dröhnte, entluden sich beide Breitseiten gleichzeitig. Die Kugeln des Tiger-Schiffs schlugen knapp neben der Bordwand der "Isabella" ins Wasser. Eine schien sogar noch etwas an der Außenbeplankung zu kratzen, bevor sie versank. Die feindliche Galeone dagegen erbebte wie von einer unsichtbaren Gigantenfaust getroffen. Holz barst und splitterte - und genau in der Wasserlinie des Tiger-Schiffes klafften acht sauber gestanzte Löcher...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-536-1Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
1.
Schüsse peitschten.
Musketenfeuer, das sich an den Klippen brach und als hallendes Echo über das Wasser der Bucht rollte. Aber zwischen den Feuerstellen und halb zerstörten Pfahlhütten am Strand wurde nicht gekämpft. Es waren Signalschüsse, die das Lager weckten und die sechs Schiffe alarmierten, die in der Bucht vor Anker lagen.
Zwei Dutzend braunhäutiger Gestalten, die eben noch zusammengerollt im Sand gelegen hatten, schreckten aus dem Schlaf.
Von den Felsen der Landzunge her stürmte der Steuermann des Flaggschiffs mit fuchtelnden Armen über den Strand. In der Rechten schwang er die schwere Muskete, die er abgefeuert hatte. Seine Stimme überschlug sich.
„Surraj!“ schrie er in seiner Heimatsprache. „Der verdammte Bastard ist geflohen!“
Die Männer – Malaien, Inder und Mischlinge – sahen sich erschrocken an.
Sie hätten keinen Grund gehabt, die Flucht des Gefangenen zu bedauern, sie waren nicht freiwillig monatelang hinter ihm hergejagt. Die Brandmale an ihren Schultern zeichneten sie als Sklaven, und die Peitschennarben auf ihren Rücken verrieten, daß sie unter der Knute ihres Besitzers ein hartes Los hatten. Aber in ihren Gesichtern spiegelte sich blankes Entsetzen. Sie wußten, was ihnen blühte, wenn der Gefangene wirklich entwischt war. Der Mogul von Annampar würde schäumen vor Wut, und er würde seinen Zorn erbarmungslos an jenen auslassen, die sich nicht wehren konnten.
Schon wurde auf dem Flaggschiff der Tiger-Flotte ein Beiboot abgefiert.
Ein Monstrum von Beiboot, das jedem echten Seemann nur galliges Gelächter entlockt hätte. Es war ungewöhnlich flach und breit gebaut, verschnörkelt und mit Zierrat überladen, und trug als Prunkstück einen schattenspendenden Baldachin, unter dem ein reich verziertes Lederkissen den Thron ersetzte.
Im Augenblick wirkte das Fahrzeug zudem noch ausgesprochen hecklastig. Denn Abu Bashri, der selbsternannte „Mogul“ der kleinen Insel Annampar in der Banda-See, wog gut und gern seine zwei Zentner – die Juwelen und das riesige, kostbare Krummschwert nicht mitgerechnet.
Die Schiffe, die in der Bucht dümpelten, standen dem Beiboot-Monstrum nicht nach.
Schwimmende Paläste waren es, reich geschmückt mit springenden Tigern als Galionsfiguren, Tigerköpfen mit aufgerissenen Rachen auf den jetzt geborgenen Segeln, Pagodendächern über den Aufbauten, Baldachinen, roten und goldenen Seiden-Draperien, prächtigem Beiwerk in jeder Form. Der Sturm hatte sie gezaust und die ganze Herrlichkeit ziemlich durcheinandergewirbelt. Aber dieser Sturm, vor dem sie sich in die geschützte Bucht an der australischen Küste verholen wollten, hatte sie auch der „Candia“ in den Weg geblasen, dem Schiff Erland Surrajs, das jetzt als Wrack zwischen den Felsen hing.
Surraj war trotz des Wetters ausgelaufen, um seine Kinder zu suchen: Yabu und Yessa, die es nicht rechtzeitig geschafft hatten, mit ihrem Fischerboot vor dem Sturm in die Bucht zurückzukehren.
Mit dem zehnjährigen Jungen, dem achtjährigen Mädchen und ein paar entflohenen Sklaven hatte sich Surraj hier angesiedelt, weit weg von Annampar, wo die Kinder ein freudloses Dasein im goldenen Käfig erwartet hätte.
Aber Abu Bashri, der größenwahnsinnige Mogul, wollte seine Enkel zurückhaben, seinen einzigen Erben und die kleine „Prinzessin“. Er glaubte Surrajs verzweifelten Beteuerungen nicht, er weigerte sich, draußen auf See nach den Kindern zu suchen. Seiner Meinung nach waren Yabu und Yessa mit Surrajs Sklaven-Freunden zu irgendeinem Schlupfwinkel im Landinneren geflohen. Aber nicht einmal die Peitsche konnte den Kapitän der „Candia“ davon abbringen, immer wieder das gleiche zu sagen – und jetzt war auch er geflohen.
Der fette Abu Bashri knirschte erbittert mit den Zähnen. Die Stricke, mit denen seine Leute den Gefangenen an einen Felsblock auf der Landzunge gefesselt hatten, konnte auch ein Erland Surraj nicht aus eigener Kraft zerreißen. Er mußte befreit worden sein. Und es bedurfte keiner langen Überlegung, um zu wissen, wer ihn befreit hatte.
Die Engländer!
Diese verdammten Seewölfe, die es gewagt hatten, den Herrn der Tiger-Flotte, den Mogul von Annampar, schlicht wie einen Papiertiger zu behandeln. Daß die Männer der „Isabella VIII.“ zudem die beiden Kinder aus der kochenden See gerettet und an Bord genommen hatten, konnte Abu Bashri nicht wissen. Aber seine Wut erreichte auch so jenes Maß, bei dem seine Leute anfingen, um ihr Leben zu zittern.
Schon hatte er drei, vier Männer in die Klippen hinaufgescheucht, um nach einem fremden Schiff Ausschau zu halten. Eine weitere Gruppe schickte er auf das Plateau, wo vielleicht Spuren zurückgeblieben waren. Dem Steuermann war klar, daß sie dort eigentlich Wachtposten hätten aufstellen müssen. Das gehörte zwar nicht zu seinen Aufgaben, doch er wußte aus Erfahrung, wie leicht es möglich war, daß es nachträglich zu seiner Aufgabe gemacht wurde, damit Abu Bashri einen Sündenbock hatte.
Wutschnaubend stampfte der fette Mogul durch den Sand bis zu dem Felsblock, an dem nur die Reste der Stricke und die Blutspuren von Surrajs zerschundenem Rücken verblieben waren.
Zwei, drei Sekunden lang starrte Abu Bashri den leeren Platz an. Seine kleinen, fast zwischen Fettwülsten verborgenen Augen glitzerten wie Kohlenstücke. Die fleischigen Nasenflügel vibrierten, die olivfarbene Haut des Gesichts nahm allmählich die Farbe einer reifen Tomate an. Als er herumfuhr, hatte sich der Steuermann wohlweislich ein Stück zurückgezogen.
Abu Bashri holte Luft, um Bej Kinoshan anzubrüllen, seinen kleinen, hageren Vertrauten mit den schwarzen Knopfaugen und der Habichtsnase. Doch auch an dem zog das Gewitter vorbei, weil im selben Moment zwei von den Männern aus den Klippen abenterten.
Atemlos meldeten sie, daß sie im Nordwesten eine Galeone gesichtet hätten, die Anstalten zeige, das Kap zu runden.
Eine Galeone mit überlangen Masten und auffällig flachen Aufbauten.
„Die Engländer!“ zischte Bej Kinoshan, und damit gelang es ihm, die Wut seines Herrn und Meisters von sich abzulenken.
Abu Bashri atmete tief durch.
„Wir gehen ankerauf!“ fauchte er. „Wir werden sie in Fetzen schießen und dafür sorgen, daß die Fische zu fressen haben. Und Surraj, dieser räudige Hund, wird noch den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde.“
An Bord der „Isabella“ waren die Signalschüsse gehört worden.
Philip Hasard Killigrew, von Freund und Feind respektvoll Seewolf genannt, schickte Luke Morgan in den Ausguck und ließ gefechtsklar machen. Eine Vorsichtsmaßnahme, die der guten alten Gewohnheit entsprach, auch auf Überraschungen vorbereitet zu sein. Niemand glaubte ernstlich, daß es ein Gefecht geben würde. Die „Isabella“ war schneller und wendiger als Abu Bashris schwimmenden Paläste und konnte der „Tiger-Flotte“, wie die Crew den seltsamen Verband nannte, mit Leichtigkeit davonsegeln.
Der Seewolf sah plastisch vor sich, wie der fette, selbstherrliche Mogul mit seinem Turban und den Prachtgewändern jetzt vor Wut tobte.
Schon die erste Begegnung mit diesem größenwahnsinnigen Narren war alles andere als erfreulich verlaufen. Abu Bashri suchte seine Enkelkinder und deren angeblichen Entführer, einen Eurasier namens Erland Surraj. Der Mogul war überzeugt davon, daß die Engländer den Gesuchten irgendwo an der australischen Küste begegnet sein mußten. Die Wahrheit wollte er nicht glauben. Er hatte es mit Bestechungen versucht, dann mit massiven Drohungen, aber da war er bei den Seewölfen gerade an die richtigen geraten.
Sie hatten ihm die Zähne gezeigt, ihn ausmanövriert und ihm klargemacht, daß zumindest sein prachtvolles Flaggschiff als Treibholz enden würde, wenn er einen einzigen Schuß abgeben ließ.
Die Karavelle, die er als Verfolger hinter der englischen Galeone herjagte, mußte sich mit zerfetztem Bugspriet zurückziehen. Damit, so glaubten die Seewölfe, hatte es sich dann, doch das war ein Irrtum gewesen.
Mitten im Sturm fischten sie zwei Kinder aus der kochenden See: Yabu und Yessa, in denen sie unschwer die Enkel des fetten Moguls erkannten.
Von den Kindern erfuhren sie, daß Erland Surraj ihr Vater war, daß er sie durchaus nicht entführt, sondern zu sich genommen hatte, um nach dem Tod ihrer Mutter für sie zu sorgen. In einer kleinen Bucht an der australischen Küste hatten sie zusammen mit einer Gruppe entflohener Sklaven eine Siedlung gegründet. Die Kinder waren dort glücklich gewesen, sie liebten ihren Vater abgöttisch – und für die Seewölfe war klar, daß sie die beiden zu ihm zurückbringen mußten.
Aber in der Bucht ankerte inzwischen die Tiger-Flotte.
Abu Bashri hatte den Eurasier gefangengenommen und schien entschlossen, ihn zollweise umzubringen. Für die Crew der „Isabella“ gab es auch diesmal kein Zögern. Nicht einer der Männer war bereit, tatenlos zuzusehen, wie ein Wehrloser zu Tode gefoltert wurde. Deshalb hatten sie im Schutz der Dunkelheit einen Stoßtrupp auf dem Landweg zu der Bucht geschickt, und inzwischen befand sich Erland Surraj an Bord der „Isabella“.
Yabu und Yessa hatten ihn stürmisch begrüßt.
Jetzt hockten die beiden mit Hasard und Philip zusammen, den zehnjährigen Zwillingssöhnen des Seewolfs. Die Unterhaltung wurde teils auf Türkisch, teils auf Spanisch geführt. Yabu und Yessa wirkten immer noch ein wenig besorgt, denn sie konnten sich denken, daß ihr Vater einiges ausgestanden hatte. Aber sie wußten, daß er nicht schwer verletzt war und noch auf den Beinen stehen konnte, und das genügte ihnen vorerst.
Die „Isabella“ rauschte mit raumem Wind unter Vollzeug nach Nordwesten.
Ed Carberry, der Profos, tobte auf der Kuhl herum, fluchte und trieb die Männer an. Achteraus über der Kimm waren noch nicht einmal Mastspitzen zu sehen, also konnte der Seewolf das Achterdeck getrost für eine Weile verlassen.
In der Kombüse war der Kutscher, Koch und Feldscher an Bord, mit Blackys Hilfe dabei, Erland Surrajs mißhandelten Rücken zu verarzten.
Der Eurasier kauerte auf einer umgedrehten Pütz: ein großer, braunhäutiger Mann, sehnig und muskulös, nur mit einer einfachen Hose aus weichem Ziegenleder bekleidet. Struppiges Haar und ein dichter, schon ergrauender Bart umgaben ein noch junges Gesicht, in dem die dunklen malaiischen Züge mit den wasserhellen Augen einen seltsamen Kontrast bildeten.
Die gleichen hellen Augen und die gleichen kräftig gezeichneten dunklen Gesichter hatten auch Yabu und Yessa. Niemand, der sie zusammen mit dem Eurasier gesehen hatte, konnte daran zweifeln, daß Erland Surraj wirklich ihr Vater war.
Als sich das Schott öffnete, wollte er aufstehen, aber Hasard winkte ab, und der Kutscher hielt seinen Patienten energisch am Arm fest. Surraj lächelte matt. Er mußte heftige Schmerzen haben, aber er beherrschte sich eisern.
„Ich möchte Ihnen noch einmal danken, Kapitän Killigrew“, sagte er in akzentfreiem Spanisch. „Sie haben meinen Kindern das Leben gerettet und mir ebenfalls.“
„Wir haben nur getan, was selbstverständliche Menschenpflicht war, Kapitän Surraj.“
In dem harten Gesicht des Eurasiers zuckte es. Wahrscheinlich dachte er an sein Schiff, an die „Candia“, die als zerschossenes Wrack auf den Klippen lag.
„Sie haben mehr getan“, sagte er ruhig. „Kein anderer hätte es gewagt, Abu Bashris Flotte zu trotzen.“
Der Seewolf zuckte mit den Schultern. „Wir haben etwas gegen großmäulige Halunken, die sich auf Schwächere stürzen und sich einbilden, die ganze Welt müsse nach ihrer Pfeife tanzen“, erklärte er ruhig. „Und dieser Mogul von Annampar ist einer der großmäuligsten Halunken, die mir je begegnet sind.“
„Mogul?“ Erland Surraj verzog verächtlich die Mundwinkel. „Er ist so wenig Mogul, wie ich der Große Chan bin. Abu Bashri ist nichts weiter als ein raffgieriger Pirat, der sich auf einer Insel eingenistet, die Eingeborenen versklavt und sich mit einem Phantasie-Titel geschmückt hat. Jetzt beherrscht er dort wirklich ein kleines Königreich, schon seit vielen Jahren. Seine Halunkenbande hält zu ihm, weil er ihnen reiche Beute und ein Leben in Saus und Braus verschafft. Die Sklaven, die er zusammengeraubt hat, müssen schuften wie Tiere. Und er selbst – er hat wohl irgendwann den Verstand verloren – ist endgültig größenwahnsinnig geworden. Er hält sich inzwischen wirklich für den Mogul von Annampar. Und wehe dem, der es wagt, ihm etwa nicht die nötige Ehrerbietung zu zeigen.“
Erland Surraj hatte sich in Hitze geredet.
Seine Kiefermuskeln spielten, die hellen Augen funkelten vor Zorn. Hasard war überzeugt davon, daß der Mann die Wahrheit sagte. Jedes Wort paßte genau zu dem Bild, das auch er selbst von dem fetten Abu Bashri gewonnen hatte.
„Und dieser Bursche ist tatsächlich der Großvater der beiden Kinder?“ fragte der Seewolf gedehnt.
Das Funkeln in Erland Surrajs Augen erlosch. Sekundenlang ging sein Blick ins Leere, als hänge er düsteren Erinnerungen nach.
„Ja“, sagte er leise. „Abu Bashri ist Yabus und Yessas Großvater …“
Und dann, langsam und stockend zuerst, begann er zu erzählen.
Die Geschichte seines Lebens. Die Geschichte eines abenteuerlichen Schicksals, wie es nur ein Mann erleben konnte, der auf den sieben Meeren zu Hause war.
Seefahrer und Abenteurer waren Erland Surrajs Vorfahren: Chinesen und Malaien, Spanier und Skandinavier, denen er den nordischen Vornamen und die hellen Augen verdankte. Seinen Vater hatte es aus dem fernen Osten über die alte Seidenstraße in die Levante verschlagen. Seine Mutter, Tochter eines Norwegers und einer Spanierin, war auf dem Schiff ihres Vaters barbareskischen Seeräubern in die Hände gefallen und als Sklavin verkauft worden. Das gleiche Schicksal, das auch Shamal Surraj erlitt, das sie einander begegnen ließ – und das sie zusammenschmiedete.
Sie konnten fliehen.
Gemeinsam schlugen sie sich quer durch das Maghreb und die Levante. Irgendwie überlebten sie, und am Ende besaß Surraj sogar ein eigenes Schiff – eine lange, abenteuerliche Geschichte, die er seinem Sohn später oft erzählte. Erland Surraj wurde auf hoher See im Sturm geboren. Das Schiff war seine Wiege, und auf See wuchs er auf, nachdem seine Mutter vor der afrikanischen Küste am Fieber gestorben war.
Schwimmen lernte er, noch ehe er laufen konnte. In den ersten Jahren seines Lebens sah er die halbe Welt, und als er zehn war und das Schiff seines Vaters im Sturm kenterte, segelte er ganz allein zehn Tage lang in einem winzigen Boot bis zur Küste.
Gefangenschaft, Sklaverei, neue Gefangenschaft – es gab wenig, was das Schicksal ihm erspart hatte.
Von der Pressgang einer chinesischen Dschunke geschanghait, gelangte er bis in das Reich des Großen Chan.
Vierzehn war er, als er seinen zweiten Schiffbruch erlebte. Diesmal wurde er von einer spanischen Galeone aufgefischt. Erland Surraj sah das Mittelmeer wieder, an das er sich nicht mehr bewußt erinnerte. Er lernte die Neue Welt kennen – und er lernte den Haß gegen jene selbstherrlichen Eroberer, die fremde Völker wie Tiere behandelten und rücksichtslos ausplünderten.
Fünf Jahre lang lebte er unter Araukanern an der Westküste des neuen Kontinents.
Mit zweiundzwanzig Jahren geriet er unter einen wilden Piratenhaufen, der die südamerikanische Küste heimsuchte. Ein paar Jahre später hatte er wieder ein eigenes Schiff, eine Karavelle, die er „Candia“ nannte – nach jener Insel im Mittelmeer, von der sein Vater ihm soviel erzählt hatte.