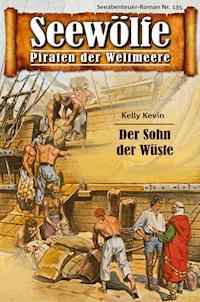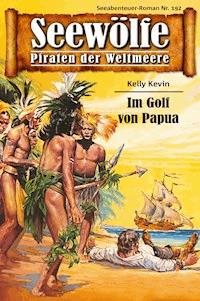
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Capitan de Carrilho tat genau das, was der Seewolf vorausgesehen hatte: er luvte an, um an der Backbordseite der "Isabella" vorbeizusegeln und die Luvposition zu gewinnen. Aber die ranke Galeone mit den überlangen Masten war schneller, obwohl die "Dona Felipa" raumschots heranrauschte. In einem blitzartigen Manöver ging die "Isabella" über Stag. Längst waren die Stückpforten geöffnet - und in der nächsten Sekunde krachte bereits die Breitseite...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-528-6Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
Palmen bogen sich im Wind.
Eine dicke braune Kokosnuß löste sich aus den Federwipfeln, verfehlte den Kopf des Mannes um Fingerbreite und klatschte unmittelbar hinter ihm auf den Boden.
Smoky, der Decksälteste der „Isabella“, fuhr herum wie von einer Natter gebissen.
„Rumms!“ sagte der kleine Hasard.
„Krach!“ fügte sein Bruder hinzu.
Die achtjährigen Zwillinge, Söhne Philip Hasard Killigrews, den Freund und Feind respektvoll Seewolf nannten, fanden den Zwischenfall sehr komisch. Smoky nicht. Er fluchte das Blaue vom Himmel. Batuti, der hünenhafte Gambia-Neger, schüttelte sein Haupt.
„Immer Vorsicht mit Kopf unter Kokospalme“, sagte er trocken. „Weiter!“
Smoky grummelte erbittert.
Ein Blick zurück zeigte ihm, daß die „Isabella“ in der Bucht auf der Südseite der winzigen Insel friedlich um die Ankertrosse schwoite. Sie hatten die Insel angelaufen, um Frischwasser zu übernehmen. In den Fässern an Bord schwappte zur Zeit eine trübe, mit grünlichen Fäden durchzogene Brühe. Der Kutscher, Koch und Feldscher auf der „Isabella“, kümmerte sich darum, daß die Fässer gereinigt wurden. Die Hälfte der Crew schwärmte unterdessen über die Insel, um die Quelle zu finden, ohne die eine so üppige Vegetation nicht denkbar war.
Der Decksälteste warf Batuti und den Zwillingen einen vernichtenden Blick zu und schlug sich seitwärts in die Büsche.
Er hatte keine Lust, sich das Gestichel anzuhören. Diese Kanalratten, dachte er bei sich, hatten sowieso nichts anderes im Sinn, als ihn mit seinem besonderen Talent aufzuziehen, harte Gegenstände an den Kopf zu kriegen. Grimmig stapfte Smoky durch das niedrige Gestrüpp, orientierte sich an der Steigung des Geländes und steuerte auf eine Stelle zu, wo rote Felsen eine schmale, ansteigende Schlucht flankierten.
Zwischen den Steinen schien die Luft zu kochen. Schweiß lief über Smokys Gesicht, das braune Haar klebte ihm in Strähnen an der Stirn. Fluchend schwang er sich über einen armdicken Schlingpflanzen-Strang, blieb stehen und lauschte.
Er hörte das Brausen der Brandung: ein vertrautes Geräusch, das er kaum bewußt wahrnahm.
Vögel kreischten, im Unterholz knackte und raschelte es. Und noch etwas hörte er: das leise, unruhige Murmeln und Rieseln von Wasser.
Die Quelle!
Smoky grinste triumphierend und stieg weiter aufwärts. Wildes Gras wucherte zu seinen Füßen. Blitzende silbrige Lichtreflexe verrieten ihm den Verlauf des Rinnsals, und wenig später entdeckte er die Stelle, wo das Wasser aus einem Loch unter einer vorspringenden Steinplatte sprudelte.
Smoky bückte sich, um etwas von dem kühlen Naß mit der hohlen Hand zu schöpfen.
Gleichzeitig hörte er das Geräusch hinter sich in den Büschen. Im ersten Moment glaubte er, Batuti oder die Zwillinge seien ihm gefolgt. Aber die hätten ihn angerufen. Smoky runzelte die Stirn und wollte sich hastig umdrehen, doch da hatte er die entscheidende Sekunde bereits verpaßt.
Zweige knackten, als jemand mit einem langen Sprung aus den Büschen brach.
Etwas rammte sich in Smokys Kreuz. Etwas Hartes, Rundes, das seiner Meinung nach fatale Ähnlichkeit mit einer Pistolenmündung hatte. Eine Stimme zischte in sein Ohr. Er verstand die Worte nicht. Aber er war ziemlich sicher, daß es sich um die Aufforderung handelte, die Hände zu heben und die Ruhe zu bewahren – andernfalls er gleich ein großes Loch in seiner kostbaren Haut haben würde.
„Scheiße“, sagte Smoky.
„Du Engländer?“ tönte es nach einer kurzen Pause erstaunt zurück.
„Nee, Chinese! Und du bist Hackfleisch, du weißt es nur noch nicht.“
Das Kichern des Fremden klang etwas hysterisch.
„Umdrehen!“ fauchte er. „Aber schön langsam, sonst bist du Chinese gewesen.“
Bei den letzten Worten trat der Bursche einen Schritt zurück, und Smoky drehte sich gelassen um.
Aus zusammengekniffenen Augen betrachtete er den Mann, der ihn mit einem Monstrum von Steinschloß-Pistole bedrohte.
Ein Weißer, stellte er fest. Portugiese vermutlich – Spanisch hätte Smoky verstanden. Der Kerl war mager und drahtig, nicht besonders groß, hatte eine braungebrannte Lederhaut, struppiges schwarzes Haar, ebenso struppige Bartstoppeln und Augen, in denen die Wachsamkeit eines hungrigen Einsiedler-Wolfs lag.
Jetzt betrachteten diese Augen den bulligen Decksältesten – etwa mit jenem Respekt, den jeder salzgewässerte Seelord einem knüppelharten Sturm entgegenbringt.
„Was willst du Stint?“ knurrte Smoky tief in der Kehle. „Dir werde ich …“
„Die Fragen stelle ich“, erklärte der Kerl. „Du wirst mir jetzt haarklein erzählen, wer ihr seid und was ihr hier sucht. Und wenn du nicht spurst, wirst du Hilo Palmeiros Lochstickerei kennenlernen!“
Dumpf rollte Kanonendonner über das Wasser.
Acht schwere Siebzehnpfünder-Culverinen spuckten Tod und Verderben. Pulverdampf wölkte über das Geschützdeck der „Dona Felipa“, lange Flammenzungen leckten aus den Stückpforten. An der Schmuckbalustrade des Achterkastells stand hoch aufgerichtet der portugiesische Kapitän mit dem schönen Namen Gilberto Henrique Rosario da Carrilho und sah zu, wie die Kanoniere wieder und wieder die glimmenden Lunten in die Zündpfanne drückten, um neue stählerne Grüße zur querab liegenden Küste hinüberzuschicken.
Jaulend und orgelnd rasten die schweren siebzehnpfündigen Kugeln durch die Luft, zerfetzten Palmenschößlinge und Buschwerk und ließen die leichtgebauten Eingeborenen-Hütten wie Kartenhäuser zusammenstürzen. Menschen schrien und flohen in panischem Entsetzen vor dem Verhängnis. Trümmer wirbelten durch die Luft, trafen Köpfe und Leiber und überschütteten die wenigen braunhäutigen Männer, die in ohnmächtiger Wut ihre Speere gegen das unerreichbare Schiff schleuderten, mit einem Splitterregen. In dem Papua-Dorf am Rande der Bucht herrschte das Chaos.
Immer noch donnerten die Geschütze, als wollten sie den Ort buchstäblich vom Erdboden tilgen.
„Halt!“ brüllte der Capitan in seiner Heimatsprache. „Wenn wir alles in Fetzen schießen, gibt es keine Beute mehr. Klar bei Bugdrehbasse! Heißt Fock und Besan! Herum mit dem Schiff!“
Nackte Fußsohlen klatschten auf den Decksplanken.
Knatternd entfaltete sich das Segeltuch, die „Dona Felipa“ fiel ab und lief vor dem Wind mit langsamer Fahrt in die Bucht. Jetzt war es die Bugdrehbasse, die sich brüllend entlud. Ihre Ladung aus gehacktem Blei prasselte zwischen die Eingeborenen, fegte den Strand leer, und auch die letzten Männer, die noch zur Verteidigung ihres Dorfs entschlossen gewesen waren, mußten einsehen, daß ihr einziges Heil in der Flucht lag.
„Backbrassen!“ peitschte da Carrilhos Stimme. „Fallen Anker!“
Die Galeone verlor an Fahrt. Die Fock wurde eingeholt, ein Mann warf das Besanfall los, während der schwere Stockanker ins Wasser klatschte. Minuten später lag die „Dona Felipa“ sicher in der Bucht. An Land wurde das Angst- und Wutgeheul der Papuas mit der Entfernung immer leiser.
„Beiboote klarmachen!“ brüllte der Capitan. „Stürmt die Festung, Männer! Sie ist unser!“
Die „Festung“ bestand aus einem Trümmerhaufen, und zu stürmen gab es nichts mehr.
Capitan Gilberto Henrique Rosario da Carrilho war dermaleinst ein ehrlicher portugiesischer Seefahrer gewesen, ein kühner Entdecker und vorbildlicher Sohn seines Vaterlandes. In seinem Fall hatten die kühnen Entdeckungsfahrten allerdings fatale Folgen gezeitigt: je weiter sie ihn von der Zivilisation entfernten, desto klarer wurde ihm, daß es viel ungefährlicher und bequemer war, wehrlose Opfer auszuplündern, statt Festungen zu stürmen. Tropenhitze, Kokosnuß-Schnaps und lasches Leben hatten seine Mannschaft in einen verlotterten Haufen verwandelt. Und ihn selbst in einen verlotterten Kapitän, der sich nur noch zu Taten aufraffte, wenn leichte Beute winkte.
Die Vorräte eines Eingeborenen-Dorfes, mittels schwerer Schiffsgeschütze erobert, waren leichte Beute.
Da Carrilho sah zu, wie die Beiboote ins Wasser klatschten und seine Leute an Land pullten. Der Strand war leer, im undurchdringlichen Dickicht rührte sich nichts mehr. Das Papua-Dorf lag an einer der wenigen menschlicher Besiedlung günstigen Stellen, einer trockenen Erhebung, die sich keilförmig aus dem Landinneren durch die Sümpfe bis zum Meer hinzog. Die Eingeborenen ernährten sich von Fischfang und Jagd, sie brauchten die Nähe der See. Jahrhundertelang hatten sie hier friedlich gelebt. Erst in jüngster Zeit zeigte der Standort ihres Dorfes Nachteile: es war schutzlos jedem Piratengesindel ausgeliefert. Nur ihre Boote hatten die Papuas sicher versteckt, außerhalb des Schußfeldes der „Dona Felipa“. Aber primitive Eingeborenen-Boote waren ohnehin nicht die Art von Beute, auf die es da Carrilhos Schnapphähne und Halsabschneider abgesehen hatten.
Wie eine Horde Vandalen fielen sie in dem zerstörten Dorf ein.
Sechs Mann richteten ihre Musketen auf den Waldrand und hielten Wache. Die anderen durchstöberten die Trümmer, zerstörten vollends, was noch heilgeblieben war, und rafften alles zusammen, was sie irgend gebrauchen konnten. Achtlos stiegen sie über Tote und Sterbende hinweg. Der Überfall hatte Dutzende von Opfern gekostet. Für diejenigen, die nicht von ihren Stammesgenossen mitgenommen worden waren, gab es keinen Pardon. Die Plünderer wußten zu genau, daß der Haß auch einen Schwerverwundeten befähigen konnte, seinem Todfeind noch mit letzter Kraft einen Speer in den Leib zu jagen.
Lästerliche Flüche ertönten, als die magere Ausbeute in die Boote verfrachtet wurde.
„Hol der Teufel diese armseligen Schlucker!“ schimpfte der knebelbärtige Steuermann der „Dona Felipa“ – ungerührt von der Tatsache, daß die Papuas bestimmt nicht in Armut lebten, um räubernde Piraten zu ärgern. „Drecksgegend! Los, anzünden den ganzen Plunder!“
Unter Gejohle setzten die Kerle auch noch die Trümmer in Brand.
Flammen züngelten, Rauchfahnen stiegen in den blauen Himmel. Binnen Minuten verwandelte sich der Platz am Strand in eine lodernde Hölle. Die Piraten in ihren Booten grinsten wild und schrien triumphierend durcheinander, als hätten sie tatsächlich eine Festung gestürmt und Heldentaten vollbracht.
Tief im Schatten des Mangroven-Dickichts kauerten nackte braunhäutige Gestalten und starrten mit haßglühenden Augen aufs Meer hinaus.
„Scheiße!“ krähte jemand laut und deutlich. „Scheiße! Chinese, du Hackfleisch!“
„Hihi!“ kicherte der kleine Philip und blickte dem roten Ara-Papagei Sir John entgegen, der im Gleitflug aus der schmalen Schlucht segelte, in der vorhin Smoky verschwunden war.
„Du schlecht erzogen, Sir John!“ erklärte der kleine Hasard ernsthaft.
Der Vogel ließ sich auf einem Zweig nieder, an dem blaue Blütendolden hingen.
„Was willst du Stint?“ kreischte er.
Und dann, in einem völlig anderen, leicht singenden Tonfall: „Umdrehen! Engländer! Hilo Palmeiro! Hilo Palmeiro …“
Die Zwillinge wechselten einen Blick.
„Vogel verrückt“, meinte Hasard junior.
„Hmm“, äußerte sich Philip junior und legte den Zeigefinger an die Nase. „Klingt aber nach einer fremden Stimme, eh? Und woher kennt der Vogel den Namen Hilo Pal-Paldingsda?“
„Palmeiro!“ krähte Sir John. „Hilo Palmeiro Lochstickerei!“
Hasard runzelte die Stirn. „Was ist denn das – Lochstickerei?“
„Weiß ich nicht. Aber Loch ist nie gut. Und Palmeiro klingt spanisch.“
„Da hast du recht, beim Scheitan“, sagte Hasard.
Die Zwillinge, bis zu ihrem siebenten Lebensjahr im Orient aufgewachsen, verwendeten zwar auch untereinander die englische Sprache, aber der Scheitan blieb nun mal der Scheitan und war dem Teufel, Satan, Beelzebub und Konsorten natürlich haushoch überlegen.
„Schauen wir mal nach?“ fragte Philip.
„Ja. Aber leise“, stimmte Hasard zu.
Auf Zehenspitzen setzten sie sich in Bewegung.
Für zwei schlanke, biegsame Bürschchen, die zudem noch eine akrobatische Ausbildung hinter sich hatten, war es nicht schwer, sich lautlos durch das Dickicht zu schlängeln. Minuten später erreichten sie steiniges Gelände, das nur noch dem wilden Gras Nahrung bot. Genau wie vorher Smoky hörten sie das Plätschern und Murmeln der Quelle. Als sie sich vorsichtig hinter einem Felsblock aufrichteten, begannen sie zu begreifen, wieso von „Scheiße“, „Hackfleisch“ und einem gewissen Hilo Palmeiro die Rede gewesen war.
Der Träger dieses Namens fuchtelte dem Decksältesten der „Isabella“ mit einer schweren Steinschloß-Pistole vor der Nase herum.
Smoky hatte die Stirn gefurcht, das Kinn vorgereckt, die Hände geballt und die Augen zu schmalen, gefährlich funkelnden Schlitzen zusammengekniffen. Die Zwillinge fanden, daß er furchterregend genug aussah, um ein halbes Dutzend Männer vom Kaliber Hilo Palmeiros in die Flucht zu jagen. Der wirkte denn auch ziemlich fahl – etwa wie ein Kurzsichtiger, der eine Hauskatze treten wollte und versehentlich einen Tiger erwischte.
„Schön ruhig, du Chinese!“ fauchte er. „Wen ich mit Lochstickerei verziere, der steht nämlich bestimmt nicht wieder auf.“
„Versuch’s doch, du Kanalratte“, knirschte Smoky. „Ein Schuß, und du hast die ganze Crew auf dem Hals. Die werden dich kielholen, kalfatern, vierteilen und an die Rahnock knüpfen – in dieser Reihenfolge.“
Der Unbekannte lachte böse.
Philip und Hasard wechselten einen weiteren Blick. Die Sache mit dem Chinesen und der Lochstickerei kapierten sie zwar immer noch nicht, aber sonst war die Situation so klar wie der Himmel nach einem handfesten Sturm.
„Hauen wir ihm was auf die Nase, oder schmeißen wir ihm was an die Rübe?“ fragte Hasard flüsternd.
„An die Rübe“, entschied Philip. „Sonst macht er doch noch Lochstikkerei.“
Dabei tastete er bereits nach einem handlichen Stein, nahm kurz und konzentriert Maß und schleuderte das Geschoß.
Ein perfekter Wurf.
Locker aus dem Handgelenk, nicht zu lasch, nicht zu wuchtig, genau mit dem Schwung, bei dem das Bewußtsein, aber nicht der Schädelknochen zum Teufel geht.
Hilo Palmeiro wurde seitlich am Kopf getroffen. Reflexhaft feuerte er die Steinschloßpistole ab. Doch da ihn der Treffer mit wohlerwogener Absicht aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, schlug die Kugel lediglich ein paar Funken aus dem Felsen.
Smoky blickte fassungslos auf seinen gefällten Gegner, aber das konnte Hilo Palmeiro schon nicht mehr sehen.
2.
Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, sah der Pinasse mit den leeren Wasserfässern entgegen, als der Schuß fiel.
Luke Morgan, Sam Roscill und Matt Davies, der Mann mit der Haken-Hand, hatten eine weitere Quelle an der Westseite der Insel entdeckt. Eine Quelle, die passenderweise in Kaskaden über Felsvorsprünge floß, so daß man die Fässer nur unter das fallende Wasser stellen brauchte, um sie zu füllen. Am Strand waren der rothaarige Schiffszimmermann Ferris Tucker, der blonde Stenmark, Dan O’Flynn und der Moses Bill damit beschäftigt, aus jungen Palmenstämmchen und Lianen Tragegestelle zu fertigen. Arwenack, der Schimpanse, hüpfte um sie herum, keckerte aufgeregt und trommelte sich auf die behaarte Brust, als wolle er Besitzansprüche auf die Insel anmelden.
Der Schuß ließ nicht nur die Männer, sondern auch den Affen erstarren.