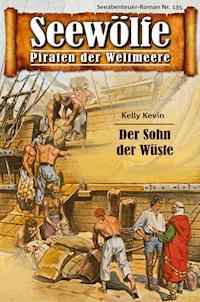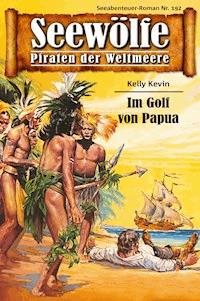Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Dan O´Flynn meinte, vor sich einen riesigen Damm zu sehen, einen Damm, auf dem man Bohnen gepflanzt hatte - wegen der Bohnenstangen, die aus dem Damm aufragten. Und Philip Hasard Killigrew neigte zu der Ansicht, Dan O´Flynn sei wohl etwas durcheinander. Als er dann aber das Spektiv nahm und hindurchschaute, erinnerte das, was er sah, tatsächlich an einen Wald von Bohnenstangen. Es waren aber Mastspitzen, dicht an dicht über die gesamte Breite des Fahrwassers zwischen Swona und Stroma. Die Riffpiraten der Orkney-Inseln hatten dort eine riesige Sperre gebildet, mit Schaluppen, Pinassen, Fischerbooten - und jedes Fahrzeug knüppelvoll besetzt. Da würden mal wieder die Fetzen fliegen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
© 1976/2015 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-484-5
Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
Gischtkämme krönten die grauen Wogen der Nordsee.
Von Süden herauf orgelte der Wind, pfiff in den Luvwanten und ließ die drei zerrauften Zweimaster wie betrunkene Enten torkeln. Die Schiffe lagen beigedreht auf der Höhe von Kinnaird-Head im Nordosten von Schottland. Spanische Schiffe. Zu dem stolzen Geschwader des Don Antonio Hurtado de Mendoza hatten sie gehört. Genau genommen gehörten sie immer noch dazu – nur daß das Geschwader allenfalls noch in Don Antonios Phantasie existierte.
An Bord der „Gaviota“ mühten sich fluchende, frierende und ausgehungerte Männer, eine Jolle abzufieren.
Die Rudergasten von der „Viktoria“ legten sich bereits in die Riemen. Capitan Juan Lopes Spitzbart flatterte im Wind. Grimmig reckte er das Kinn und starrte dem Führerschiff der Dreiergruppe entgegen, als wolle er der „Candia“ mit den Blikken ein Loch in die Bordwand brennen.
Deren Capitan trug allerdings keine Schuld an der Misere.
Basil da Conta hieß er. Und wütend war er ebenfalls. Wütend, ratlos, entnervt – genau in der Stimmung, jemandem eigenhändig den Hals umzudrehen.
Capitan Nummer drei ging es nicht anders.
Alonso de Madre-Castillo war der letzte, der über die Jakobsleiter der „Candia“ aufenterte und seine lange, hagere Gestalt reckte. Mit einem Blick maßloser Erbitterung betrachtete er das, was einmal ein ganz passables, ordentliches Rigg gewesen war. Sein Gesicht verzog sich schmerzlich beim Geräusch der Pumpe, deren monotones Quietschen bewies, daß die „Candia“ Wasser nahm. Dafür hatte es der „Gaviota“ die Blinde wegrasiert. Und was der Zweimaster als Notbesegelung führte, sah so aus, daß man genausogut auch gleich Bettsäcke hätte setzen können.
Capitan Alonso de Madre-Castillo sagte ein wenig vornehmes Wort.
Aber er war auch kein besonders vornehmer Mann, obschon er altem Adel entstammte. Sehr altem, aber leider sehr verarmten Adel! Alonso de Madre-Castillo hatte früh erkannt, daß er sich für die vornehme Abstammung nichts kaufen konnte.
Unvornehm, ruppig und raffgierig ging es wesentlich besser. Auf die feine Art kriegte man nicht so leicht ein Schiff wie die „Gaviota“. Alonso de Madre-Castillo war damit zufrieden gewesen, ein unfeiner, aber wohlhabender Sklavenhändler und Handelsfahrer zu sein, und er hatte nicht den geringsten Ehrgeiz gehabt, ein patriotischer Held zu werden.
Was die vornehmen Herren, die seine „Gaviota“ genau wie die „Viktoria“ und die „Candia“ für den Kriegszug der Armada requirierten, leider überhaupt nicht interessierte.
Die beiden anderen Kapitäne waren auch nicht gerade zu Helden geboren. Sie verpflichtete nicht einmal alter Adel, und auf welche Weise Engländer oder Holländer zu ihrem Herrgott beteten, interessierte sie schon gar nicht. Aber die spanische Krone war nun einmal anderer Meinung: also blieb den drei unvornehmen Herren nichts anderes übrig, als mit der Armada zu segeln und zu versuchen, das Schlamassel so gut wie möglich zu überstehen.
Im Geschwader des Don Antonio Hurtado de Mendoza waren sie für Kurierund Depeschen-Dienste eingesetzt worden.
Ehrenvolle Aufgaben! Mit allen Aussichten, zu Helden zu werden. Aber leider hatte von Anfang an die Wahrscheinlichkeit dafür gesprochen, daß sie tote Helden wurden – und davon hatten sie jetzt endgültig die Nase voll.
In der Kapitänskammer der „Candia“ fanden sie sich zusammen, um die Lage zu besprechen.
„Die Order lautet, um die Orkney-Inseln herum westwärts in den Atlantik und dann südwärts an Irland vorbei nach Spanien zu segeln“, stellte der breite, ruppige Basil da Conta fest.
„Ja“, sagte Juan Lope gallig. „Mit acht Unzen Zwieback, einem halben Liter Wasser und einem Viertelliter Wein pro Mann und Tag!“
„Hirnrissig“, knurrte Alonso de Madre-Castillo.
Sie waren unter sich. Also brauchten sie nicht so zu tun, als ob sie den sehr ehrenwerten Herzog Medina Sidonia für eine Leuchte der christlichen Seefahrt hielten – was der unglückliche Generalkapitän im übrigen auch nie von sich behauptet hatte.
„Selbstmord!“ bekräftigte Juan Lope. „Ohne Wasser, Proviant und Ausrüstung sind wir im Eimer. Und im dreimal verdammten Rest dieser glorreichen Flotte geht es genauso. Die werden unterwegs jede Bohnenstange requirieren, um sie als Rah zu riggen, jeden Brotkanten, jedes verirrte Schaf …“
„Das heißt, daß wir das Nachsehen haben, solange wir treu und brav hinter dem Flaggschiff hersegeln“, faßte Alonso de Madre-Castillo zusammen.
„Eben“, sagte Basil da Conta.
„Genau“, stimmte Juan Lope zu.
Danach herrschte eine kurze Stille, während der sich die wenig ehrenwerten Herren überlegten, ob man es riskieren könne, sich seitwärts in die Büsche beziehungsweise westwärts in den Pentland Firth zu schlagen, der die Orkney-Inseln von der Nordspitze Schottlands trennt.
Zehn Minuten später hatte man sich darauf geeinigt, die Sache nicht als Fahnenflucht, sondern als kleine Abkürzung zu betrachten.
Alles Weitere würde sich finden. Hauptsache, man setzte sich erst mal von der zerschlagenen Flotte ab. Dann brauchte man nämlich die Beute nicht zu teilen, die da kommen würde, und die Gefahr, zu toten Helden zu werden, verringerte sich auch auf ein erträgliches Maß.
Alonso de Madre-Castillo und Juan Lope betrachteten die Lage wieder etwas optimistischer, als sie sich zu ihren Schiffen zurückpullen ließen.
Eine Viertelstunde später setzten die drei Zweimaster die Fetzen, die ihnen als Besegelung geblieben waren, und gingen auf Nord-Nordwest-Kurs, um den Pentland Firth zu erreichen.
„Schiff ho! Backbord voraus!“ Bills Stimme schmetterte wie ein Trompentensignal über die Decks der „Isabella VIII.“ Der Moses hatte Wache im Großmars und beobachtete aufmerksam die Kimm.
Querab Steuerbord lag Jean Ribaults „Le Vengeur“ vor dem Wind. Ringsum dehnte sich grau die Nordsee, aufgepeitscht und wild, als warte sie nur darauf, sich mit dem nächsten Sturm von neuem in ein brüllendes Untier zu verwandeln und die Menschen auf ihren lächerlichen Schifflein das Fürchten zu lehren.
Die Seewölfe waren es gewohnt, den tobenden Elementen die Zähne zu zeigen.
Und Jean Ribault, Karl von Hutten und ihre verwegenen Kerle hatten dem Teufel auch schon mehr als einmal die Ohren abgesegelt. Aber die zerschossenen, abgetakelten, vom Schicksal geschlagenen Reste, die von der stolzen Armada übriggeblieben waren – von denen würden nur noch wenige einem Sturm standhalten können oder ein Gefecht mit dem räuberischen Gesindel bestehen, das überall lauerte, wo leichte Beute und ein schneller Sieg über fast wehrlose Gegner winkten.
Deshalb segelten die „Isabella“ und die „Le Vengeur“ nach Norden.
Und deshalb wurde Philipp Hasard Killigrews Gesicht steinern, als er jetzt durch das Spektiv blickte. Für ihn hörte der Krieg auf, wenn der Gegner geschlagen war. Die Seewölfe wußten, wo der Kampf endete und der gemeine Mord anfing: genau an dem Punkt, wo sich der Gegner ergab oder nicht mehr wehren konnte. Und Schiffbrüchige waren überhaupt keine Gegner, sondern Menschen, die ein Anrecht auf Hilfe hatten. So dachte die Crew der „Isabella“, und so dachten auch Jean Ribault und seine Mannen.
Aber es gab mehr als genug Leute, die anders dachten.
Sir Francis Drake zum Beispiel. Der sehr ehrenwerte Admiral war wie ein beutehungriger Fuchs hinter der geschlagenen Armada hergestrichen, bis seine „Revenge“ von der „Isabella“ und der „Le Vengeur“ schlichtweg ausmanövriert wurde. Ein Teil der englischen Flotte hatte ähnlich gehandelt, und sich genauso gnadenlos auf die Besiegten gestürzt. Inzwischen war die Verfolgungsjagd abgebrochen worden, aber auf die Trümmer-Armada, die ohne Munition und Proviant durch fremde Gewässer segeln mußte, lauerten immer noch mannigfache Gefahren.
Sturm und Unwetter, Riffe und Untiefen, Hunger und Durst, für viele der Verwundeten das hilflose Warten auf den Tod.
Und Feinde!
Gegner, die auf die Schwachen lauerten, die aus dem Hinterhalt auftauchten. Gegner wie die schnelle Karavelle mit den schwarzen Segeln, die sich da Backbord voraus von Kinnaird-Head her an die schwer angeschlagene spanische Galeone heranpirschte.
„Piraten“, sagte Ben Brighton, der neben dem Seewolf auf dem Achterkastell stand.
Hasard hob die Schultern.
Piraten oder nicht – üble Halunken waren es auf jeden Fall. Man mußte einfach ein übler Halunke sein, wenn man sich auf eine Galeone stürzte, der Bugspriet und Besanmast fehlten, die einen lächerlichen Fetzen als Fock führte und bei jedem Krängen durch die mühsam vernagelten Lecks an der Backbordseite Wasser nahm. Verschossen hatte sie sich auch: die Spanier machten nicht einmal Anstalten, die Kanonen auszurennen. Durch das Spektiv konnte Hasard die Männer an Deck sehen. Sie wirkten aufgescheucht, verzweifelt – denn die Besatzung der Galeone hätte blind sein müssen, um nicht zu erkennen, daß ihr gegen die gut bestückte, wendige Karavelle nicht der Schimmer einer Chance blieb.
„Na also“, brummte Ben Brighton, als wenig später am Flaggenstag die spanische Fahne niederging.
„Die Dons ergeben sich!“ meldete Bill überflüssigerweise aus dem Großmars. „Die Karavelle fällt ab! Scheint so, als wollten sie längsseits gehen und entern!“
Da hatte er recht.
„Feige Kanalratten“, dröhnte Ed Carberrys Stimme von der Kuhl. „Leichenfledderer sind das! Denen sollte man die Haut in Streifen …“
Er verstummte abrupt.
Vor ihnen, einen Viertelstrich nach Backbord versetzt, hatte sich die Karavelle neben die zerschossene, wehrlose Galeone geschoben. Enterhaken flogen, wie Katzen turnten Männer auf das spanische Schiff hinüber – und deutlich und unüberhörbar peitschten die Schüsse von Musketen, Arkebusen und Pistolen.
Für ein paar Sekunden wurde es sehr still auf den Decks der „Isabella.“
Ed Carberry, der eiserne Profos, holte so tief Luft, daß sein mächtiger Brustkorb fast die Hemdknöpfe sprengte. Ben Brighton biß die Zähne zusammen. Hasard starrte immer noch durch das Spektiv, und sein Gesicht schien zu versteinern.
„Diese Dreckskerle!“ schrie Bill im Großmars empört. „Die kümmern sich den Teufel darum, daß der Don die Flagge gestrichen hat, die …“
„Halt die Klappe da oben, du Wanze!“ brüllte Ed Carberry mit Stentorstimme. Und zum Achterkastell: „Willst du dir das mit ansehen, Sir? Oder wollen wir diese Kanalratten vierkant auf ihren verrotteten Kahn zurückschmeißen?“
„Was hast du denn gedacht?“ knurrte Hasard durch die Zähne.
Sein Blick wanderte nach Steuerbord, wo die „Le Vengeur“ auf Rufweite herangedreht war. Jean Ribault stand hoch aufgerichtet an der Schmuckbalustrade des Achterkastells, die Rechte am Griff des Degens. Das kampflustige Funkeln in seinen dunklen Augen verriet deutlich, was er dachte.
„Was ist?“ rief er. „Zeigen wir den Kerlen, wie der Wind in die Hölle weht?“
Aber da auf der „Le Vengeur“ und der „Isabella“ bereits Klarschiff zum Gefecht gemacht wurde, erübrigte sich eine Antwort.
Um dieselbe Zeit ließen auch die drei spanischen Kapitäne gefechtsklar machen, die darauf gepfiffen hatten, dem Generalkapitän um die Orkney-Inseln herum in ein ungewisses Schicksal zu folgen.
Vor ihnen erhob sich die wild zerklüftete Küste der Insel Swona im grauen Dunst. Die Spanier kannten den Namen der Insel natürlich nicht. Sie interessierten sich nur dafür, ob es vielleicht Klippen und gefährliche Untiefen in der Nähe gab. Und noch mehr interessierten sie sich für den Pulk schottischer Fischerboote, den sie an der Nordseite des Eilands gesichtet hatten.
Fischerboote bedeuteten Wasser und Proviant. Wasser und Proviant, das die drei spanischen Zweimaster dringend brauchten. Was die Fischer dazu meinten, kümmerte die wenig vornehmen Herren Kapitäne einen feuchten Kehricht.
Basil da Conta stand auf dem Achterkastell seiner „Candia“, spähte durch das Spektiv westwärts und grinste breit, als er bemerkte, daß die Männer auf den Booten höchstens ein paar Handfeuerwaffen bei sich führten.
„Klar bei Drehbasse!“ schrie er auf spanisch. „Ein anständiges Loch in die nächstbeste Bordwand – das wird den Burschen zeigen, daß sie besser die Köpfe einziehen!“
Der Geschützführer peilte über das lange Rohr in seiner drehbaren Lafette den vordersten Logger an.
Die Fischer hatten in ihrer Arbeit innegehalten und starrten verblüfft herüber. Bis zu den Orkney-Inseln war die Kunde vom Kampf der englischen Flotte gegen die Armada noch nicht gedrungen. Spanische Schiffe in dieser Gegend – damit hätten die Schotten nicht einmal im Traum gerechnet, und deshalb waren sie auch nicht darauf eingerichtet, sich zu verteidigen.
Ehe sie überhaupt begriffen, wie ihnen geschah, krachte auf der „Candia“ bereits die Bugdrehbasse.
Pulverrauch wölkte auf, die schwere Eisenkugel heulte über das Wasser und schlug in die Bordwand des Loggers. Das Boot erzitterte.
„Warschau“, brüllte jemand. Berstend und splitternd neigte sich der Mast, der unter Deck in seinen Verbänden getroffen worden war, und begrub das Vorschiff unter dem großen Segel.
Ein vielstimmiger Schrei brandete auf.
Die Fischer konnten nicht ahnen, daß die „Candia“, ihre vorletzte Kugel verschossen hatte. In hilfloser Wut sahen sie das Verhängnis auf sich zugleiten. Wie Habichte in den Hühnerhof stießen die drei spanischen Schiffe in den Pulk der Fischerboote. Enterhaken flogen, Musketen und Pistolen richteten sich auf die überrumpelten Schotten, und nur wenigen verblieb noch die Zeit, sich Messer oder Spaken zu greifen.
Auf dem Boot mit dem gebrochenen Mast befreite sich ein großer rothaariger Bursche aus einem Gewirr von Segeltuch, Wanten und Pardunen.
Mit einem einzigen Blick erfaßte er das Bild der Verwüstung. Heillose Wut verzerrte seine Züge. Er sah einen seiner Männer mit gebrochenem Genick auf den Planken liegen, er sah die ausgehungerten, halb verdursteten Spanier an Bord springen, und er kümmerte sich nicht darum, daß er es mit einer schwerbewaffneten Übermacht zu tun hatte.
Ein wilder Schrei brach über seine Lippen, als er die Axt hochriß.
Die Spanier prallten zurück, der Hieb ging ins Leere. Eine Radschloß-Pistole peitschte auf. Noch ehe der Rothaarige zum zweitenmal ausholen konnte, schien ihn eine unsichtbare Faust zu treffen und warf ihn zurück. Blut rann von seiner Schulter her über die Brust. Wie vom Blitz gefällt brach er zusammen, und die Spanier brauchten nur noch wenige Minuten, um jeden Widerstand zu brechen.
Ein paar von den Schotten, die sich schon ergeben hatten, stürzten sich beim Anblick des verletzten Rothaarigen in besinnungsloser Wut auf ihre Bezwinger, doch es nutzte nicht viel. Ein paarmal klatschte es, als die Spanier ihre Opfer kurzerhand außenbords beförderten. Jeder weitere Widerstand wäre selbstmörderisch gewesen. Die Fischer wußten es. Sie gaben auf, ließen zähneknirschend geschehen, daß sie wie eine Herde Schafe zusammengetrieben wurden, und mußten hilflos mit ansehen, wie die Spanier darangingen, die Boote auszuplündern.
„Wasser!“
Ein Schrei der Erleichterung ging von Mund zu Mund, als die ersten Fäßchen entdeckt wurden. Hastig stürzten sich die halb verdursteten Männer auf das kühle Naß, drängten und schoben und schienen für eine Weile alles andere zu vergessen. Zwei von den Fischern nutzten die Gelegenheit, ihren rothaarigen Kameraden vorsichtig ans Schanzkleid zu ziehen und nach der Wunde zu sehen.
Von der „Candia“ rief Capitan da Conta ein paar scharfe Befehle. Die Waffen zielten wieder schußbereit auf die Schotten, und die Männer, die den schlimmsten Durst gestillt hatten, begannen systematisch, Fäßchen, ein paar Weinkrüge, Brotbeutel und Werkzeugkisten auf die drei Zweimaster hinüberzumannen.
Die Fischer erstickten fast an ihrer Wut, aber sie konnten sich nicht wehren.
Eine halbe Stunde später besaßen sie keinen rostigen Nagel mehr. Nicht einmal vor Rahen und Spieren machten die Plünderer halt: sie brauchten eine Menge Material, um ihre eigenen schwer angeschlagenen Schiffe zu reparieren. Stumm sahen die Schotten zu, wie ihre Boote regelrecht gerupft wurden. Äxte und Messer ließen die Spanier natürlich auch nicht zurück.
Der verletzte Rotschopf war wieder bei Bewußtsein. Stöhnend vor Schmerz und Haß stemmte er sich hoch, und er wäre trotz der Wunde in der Schulter dem nächstbesten Spanier an die Kehle gefahren, wenn seine Kameraden ihn nicht festgehalten hätten.
Capitan da Contas Stimme klang sehr zufrieden, als er den Rückzug befahl.