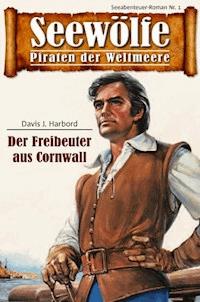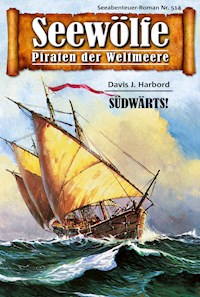Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Im Sturm saufen sie um ein Haar ab, die Männer um den Seewolf Philip Hasard Killigrew. Danach sind sie fix und fertig, todmüde. Aber die spanische Galeone "Santa Barbara", die sie als Beuteschiff nordwärts steuern, ist ein Schiff voller Überraschungen. Auf der Galeone fährt der Tod mit - doch das wissen sie erst, als sie in der Falle sitzen. Es gibt kein Entrinnen mehr: Nach einer Nacht des Schreckens taucht vor ihnen ein Spanier aus dem Morgendunst, der direkt auf sie zuhält. Der Seewolf spuckt Gift und Galle...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1975/2012 Pabel-Moewig Verlag GmbH,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-091-5Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
1.
Sie waren harte Männer, diese sechzehn Kerle, die Anfang November des Jahres 1576 das spanische Beuteschiff, die Galeone „Santa Barbara“, nordwärts steuerten.
Noch standen sie südlich der Azoren. Um sie herum dehnte sich die unermeßliche Weite des Atlantik, von dem sie wußten, daß er weit, weit im Westen an eine neue Welt grenzte, die Geheimnisse – und Schätze barg. Schätze für die spanische Krone, nicht für die englische, es sei denn, man schnappte sie weg, bevor sie Spanien erreichten.
Schnapphähne zur See? Freibeuter? Korsaren? Vielleicht waren sie das. Aber was besagte das schon? Wer meinte, alle Schätze dieser Welt für sich beanspruchen zu können, der mußte sich schon gefallen lassen, daß man ihm da und dort etwas abzwackte.
War jener Mann, der sich als Stellvertreter Christi bezeichnete und in selbstherrlicher Machtvollkommenheit über neu entdecktes Land verfügte, nicht ein viel größerer Schnapphahn? Er hieß Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. mit dem Lineal jenen unseligen Strich auf der Landkarte zog und damit kundtat, daß alles Land westlich des Striches den Spaniern und alles östlich davon gelegene den Portugiesen gehören solle. Dieser Strich verlief hundert Seemeilen westlich der Azoren vom Nordpol bis zum Südpol durch den Atlantik.
Er war sehr gerissen, dieser Papst. Bei Strafe der Exkommunizierung verbot er allen Nichtspaniern und Nichtportugiesen, zu den neuentdeckten Inseln und Ländern zu fahren und dort gar „Handel“ zu treiben.
Was Wunder, daß diese päpstliche Bulle die Habenichtse auf den Plan rief. Sie pfiffen auf die Exkommunizierung, sie pfiffen um so mehr darauf, weil sie das machtpolitische Spiel durchschauten und keineswegs der Ansicht waren, der Stellvertreter Christi könne so mir nicht dir nichts die Erde nach seinem Geschmack aufteilen und jenen zuschanzen, die sowieso den Hals nicht voll genug kriegen konnten.
Die sechzehn Männer auf der „Santa Barbara“ fuhren für den Habenichts England und für ihre königliche Lissy. Und falls ihnen jemand mit dem päpstlichen Bannstrahl gedroht hätte, wäre eins gewiß gewesen: sie hätten sich halb totgelacht. Vielleicht hätten sie auch darauf hingewiesen, daß die See frei sei, daß dort andere Gesetze gälten als im Vatikan – nämlich Gesetze, die von Wind und Wasser und Wetter diktiert wurden, von Gewalten, die mächtiger waren als papierene Erlasse.
Mit ihnen hatten sie sich herumzuschlagen, wenn sie die Beutegaleone nach England bringen wollten.
Vor zwei Tagen hatten sich sich von der „Marygold“ des großen Francis Drake getrennt, mit dem sie den Spanier aufgebracht hatten. Seine Order hatte gelautet: Segelt die „Santa Barbara“ nach Plymouth und übergebt sie dort Kapitän John Thomas.
Und genau das würden sie tun, und kein Don würde sie daran hindern – oder sie waren es nicht wert, zur Mannschaft Francis Drakes zu gehören.
Wer das verbürgte, war der schwarzhaarige, blauäugige Philip Hasard Killigrew, der Mann aus Cornwall, den sie den Seewolf nannten und der dem Teufel bereits mehr als ein Ohr abgesegelt hatte.
Im Oktober, nach einer Sturmnacht, hatte die „Marygold“ Plymouth verlassen – da war Philip Hasard Killigrew, jüngster Sohn von Sir John Killigrew auf Arwenack, noch schlichter Decksmann an Bord der „Marygold“ gewesen. Was dieser junge Riese aber für ein Kaliber hatte, das war den Leuten auf der „Marygold“ bis hinauf zum Kapitän recht schnell klargeworden.
Und dann hatte ihm Francis Drake die Prise „Santa Barbara“ anvertraut und ihm fünfzehn Männer unterstellt, die sich der Seewolf aus der Besatzung der „Marygold“ hatte aussuchen können.
Einer war noch nicht ganz ein Mann, aber er hatte bereits gezeigt, daß er kämpfen konnte: Donegal Daniel O’Flynn, genannt Dan, hieß das Bürschchen, und es stammte wie der Seewolf aus Falmouth in Cornwall und war mit allen Wassern gewaschen. Dan hatte neben anderen Vorzügen die schärfsten Augen, außerdem eine anscheinend unstillbare Freßsucht und dazu eine Schnauze, die selbst die abgebrühtesten Männer zur Weißglut brachte – mit Ausnahme Hasards, der nur sanft lächelte, wenn das Bürschchen mit seinem Stimmbruch loslegte.
Um bei Dans Freßsucht zu bleiben. Als Kombüsenchef hatte der Seewolf den Kutscher eingesetzt. Wie er richtig hieß, wußte keiner, und er sagte es auch nicht. Er war eben der „Kutscher“, denn als solcher hatte er sich vorgestellt, nachdem ihn die Preßgang der „Marygold“ an Bord geschafft hatte. Von der Seefahrt verstand er soviel wie die Kuh vom Spinettspielen, war bereits einmal von der Rah gerutscht und hatte ein Bad im Atlantik genommen. Hasard hatte ihn herausgefischt. Wie gesagt, sie alle wußten nur, daß der Kutscher bei Sir Anthony Abraham Freemont in Plymouth gewesen war, bevor ihn das Preßkommando eingesackt hatte.
Vielleicht hatte er bei Sir Freemont in der Küche einiges abgeguckt, vom Kochen verstand er jedenfalls mehr als vom Herumturnen in den Wanten. Seekrank war er auch nicht mehr, und allmählich schien er auch zu vergessen, daß er einmal die Absicht gehabt hatte, von Bord zu „türmen“.
Das war alles soweit in Ordnung, die See schliff sie alle zurecht – bis auf die Weichen und die Memmen, denn die wurden zerbrochen.
Nur mit dem Bürschchen lebte der Kutscher in erbitterter Fehde, und das hing mit dessen Freßsucht zusammen.
Empört hatte der Kutscher dem Seewolf gemeldet: „Der Bengel klaut wie ein Rabe.“
„Was klaut er denn?“
„Alles Freßbare.“
Hasard hatte gelächelt. „Er wächst noch, da hat man immer besonderen Appetit.“
Aber dann hatte er sich das Bürschchen vorgeknöpft und ihm die Leviten gelesen. Donegal Daniel O’Flynn mochte es gar nicht, daß der von ihm angehimmelte Hasard sauer war. Er schwor Besserung – bis zum nächstenmal.
Gegen Abend des zweiten Tages schlief der Wind ein, und die Dünung wurde bleiern. Die „Santa Barbara“ lag torkelnd in der See, die Takelage knarrte, ächzte und stöhnte, die Segel an den drei Masten schlugen hin und her und sahen aus wie zerknautschte Bettlaken.
Nicht ein Hauch von Wind, verdammt.
Hasard stand auf dem Achterdeck, schnupperte über die See, suchte die Kimm ab, blickte zu den Segeln hoch und spürte, daß da irgend etwas im Anzug war. Noch bevor es dämmerte, ließ er sämtliche Segel bergen – bis auf das dreieckige Lateinersegel am Besanmast und die Fock am Vormast.
Überhaupt der Vormast! Ferris Tucker, der rothaarige, riesige Schiffszimmermann, hatte ihn zwar neu gelascht und aufgeriggt, nachdem er bei dem kurzen Gefecht aufs Deck gekracht war, aber Hasard hielt ihn für den wunden Punkt der „Santa Barbara“. Und auch Ferris Tucker kaute auf dem Problem herum.
Zusammen mit Ben Brighton, dem Bootsmann, umstanden sie ihr Sorgenkind und starrten an ihm hoch.
Ben Brighton, untersetzt und breitschultrig, warf dem rothaarigen Riesen einen schiefen Blick zu.
„Sieht aus wie ’ne schwangere Bohnenstange, wie?“
„Blöder Witz“, sagte Ferris Tucker. „Hast du schon mal ’ne schwangere Bohnenstange gesehen?“
Ben Brighton grinste. „Ja – nämlich diesen mistigen Fockmast.“
„Fock und Vormarssegel hat er jedenfalls die letzten zwei Tage ausgehalten, du Büffel“, sagte Ferris Tucker.
„Gut, das hat er, Ferris“, sagte Hasard, „aber jetzt frag ich mich, was passiert, wenn’s ganz dick kommt? Da braut sich nämlich was zusammen, das spür ich in allen Knochen.“
„Ich auch“, sagte Ben Brighton.
Ferris Tucker kratzte sich am rechten Ohr.
„Mann, ihr macht mich vielleicht schwach. Ich hab das Ding geflickt, so gut es ging. Ob’s einen handfesten Sturm verträgt, kann ich erst sagen, wenn wir ihn überstanden haben. Ich laß mich überraschen.“
„Ha, ha“, sagte Ben Brighton zu Hasard, „er läßt sich überraschen, dieser Gemütsmensch.“ Zu Ferris Tucker sagte er: „Und was ist, wenn der Fockmast während des Sturms baden geht, he?“
„Feierabend“, sagte Ferris Tucker und grinste. „Wenn’s dich beruhigt, kann ich ihm ja noch ein paar Laschings verpassen. In der Segelkammer hab ich übrigens noch eine kleine Fock entdeckt. Schätze, daß die Dons sie als Sturmsegel gefahren haben. Vielleicht sollten wir die statt dieses großen Lappens hier setzen, wie?“
„In Ordnung“, sagte Hasard. „Ben, laß die große Fock bergen und setz die kleinere Fock. Außerdem möchte ich, daß alles seefest gezurrt wird. Und dann laß achtern unter dem Kastell die dicksten Trossen, die hier an Bord zu finden sind, klarlegen.“
Ben Brighton riß die Augen auf. Er war bestimmt zehn Jahre älter als der Seewolf und mit Salzwasser mehr als durchtränkt, aber was die dicksten Trossen achtern unter dem Kastell sollten, das kapierte er nicht. Er verbiß sich eine Frage, als er in die eisblauen Augen blickte und sagte nur: „Aye, aye.“
Hasard sagte: „Du weißt, wozu?“
Ben Brighton schüttelte den Kopf. „Keine Ahnung.“
„Die Trossen werden unter Deck um den Besanmast herum gelegt und durch das Koldergatt achtern im Heck ausgebracht. Wir schleppen sie hinter uns her. Es ist dies eine Möglichkeit, vor dem Sturm herzulaufen und nicht querzuschlagen. Die Trossen wirken als Bremsen, halten das Heck gegen die See und verhindern sogar, daß sich hinter uns eine zu wüste und hohe Dünung aufbaut.“
„Mann“, sagte Ben Brighton verblüfft, „aus welcher Seekiste hast du denn diesen Trick herausgefischt?“
Hasard grinste. „Reiner Zufall. Bei einem Sturm oben in der Irischen See rauschte meinem Alten – ich war an Bord – eine Trosse achtern aus. Wir schleppten sie hinter uns her, wollten sie zuerst einholen, was wir nicht schafften, und merkten plötzlich, daß das Schiff viel ruhiger lag und vor dem Wind und der See ablief. Kein Brecher überrollte uns mehr, wir lagen sicher wie in Abrahams Schoß. Natürlich muß man in einem solchen Fall genügend freien Seeraum um sich herum haben und darf nicht auf eine Leeküste zugetrieben werden. Alles klar, Ben?“
„Aye, aye“, erwiderte der Bootsmann.
„Ferris, sieh zu, daß alle Luken gut abgedichtet sind“, sagte der Seewolf. „Hast du schon mal das Bilgewasser kontrolliert, hat das Schiff irgendwelche Leckstellen?“
„Bis jetzt habe ich noch nichts entdecken können, der Stand des Bilgewassers ist normal. Aber bei diesen verdammten spanischen Kästen weiß man das ja nie. Wenn ich den Vormast noch mehr abgesichert habe, gehe ich unter Deck nochmals das ganze Schiff durch.“
„Gut. Überprüfe auch den Frachtraum mit den Seidenballen und den Gewürzsäcken. Ich will nicht, daß die Ladung irgendwie verrutscht und wir Schlagseite kriegen.“
„Geht klar“, sagte Ferris Tucker und holte sein Werkzeug.
Ben Brighton ließ die Fock bergen und statt dessen das Sturmsegel anschlagen.
Inzwischen brach die Dämmerung herein. Im letzten Tageslicht zeigten sich weit im Südosten hoch am Himmel faserige Wolkengebilde, die wie zerrupfte Federn wirkten. Hasard beobachtete sie mißtrauisch, bis die Dunkelheit keine Sicht mehr zuließ.
Auch die Dünung rollte aus Südosten heran. Der Wind rührte sich noch immer nicht, und die „Santa Barbara“ wälzte sich träge von Backbord nach Steuerbord, wieder zurück, verneigte sich tief, stieg hoch, legte sich über. Es war eine schauerliche Schaukelei, die entnervend wirkte. Dazu ächzte und stöhnte die Galeone in ihren hölzernen Verbänden, das Tauwerk knarrte, an die Bordwände klatschte das Wasser – Geräusche, denen die Männer der „Santa Barbara“ beklommen lauschten, weil sie unter die Haut gingen.
Denn ohne Winddruck auf den Segeln war die „Santa Barbara“ ein totes Schiff, keine Kraft wirkte auf das Ruder, es war ein steuerloses Dümpeln und Torkeln in der Dünung, ein erzwungenes Warten auf etwas Ungewisses, das im und über dem Wasser lauerte, bereit, irgendwann brutal zuzuschlagen.
Hasard ließ die zwölf Kanonen auf dem Mitteldeck – je sechs auf jeder Seite – mit Brooktauen doppelt absichern. Bei dem ständigen Überholen und Arbeiten des Schiffes brauchte sich nur eine aus den Laschungen zu lösen – sie würde wie ein übergroßes Geschoß lossausen, das Schanzkleid zertrümmern oder ins Vor- oder Achterkastell krachen.
Keiner der sechzehn Männer schlief. Eine unerklärliche Spannung lag in der Luft. Sie waren alle hartgesotten, aber als auf den drei Mastspitzen und den Rahnocken plötzlich rötlichviolette Lichtbüschel zu tanzen begannen, bekreuzigten sich einige.
Smoky, der vor dem Seewolf auf der „Marygold“ Decksältester gewesen war, ein eiserner Brocken von Mannskerl, schnaufte entsetzt und deutete die flackernden Lichter als Vorzeichen des Feuerteufels.
Und der Kutscher schnatterte mit den Zähnen und vertrat die stotternde Ansicht, der Weltuntergang stünde bevor.
Es sah auch weiß Gott gespenstisch genug aus. Die Lichter geisterten wie winzige Kobolde auf den Mastspitzen, es knisterte unheimlich, zuckende Funken sprangen hierhin und dorthin, schickten ihre Lichtblitze über das Deck und beleuchteten für Bruchteile von Sekunden die emporgereckten Gesichter der Männer an Deck.
Donegal Daniel O’Flynn indessen nutzte die Gelegenheit und verholte sich hinter dem palavernden Kutscher klammheimlich in die Kombüse. Mit sicherem Spürsinn steuerte er den Sack an, der im hinteren Winkel der Kombüse zwischen zwei Backskisten stand und mit getrockneten Früchten vollgestopft war.
Er löste das Bändsel, das den Sack oben zusammenhielt, langte hinein und begann zu futtern. Höhepunkt der lukullischen Genüsse waren süße Feigen und Datteln, die man daheim in Falmouth allenfalls vom Hörensagen kannte. Das Bürschchen verging vor Wonne, kaute auf beiden Backen, lauschte dem Palaver der Männer draußen vor der Kombüse und segnete die funkelnden Lichter auf den Mastspitzen und an den Rahnokken. Von ihm aus konnten die lustigen Blitze dort bis zum nächsten Morgen herumtanzen, für ihn bedeuteten sie weder Weltuntergang noch Feuerteufel, sondern einen mit süßer Kost gefüllten Magen.
Etwa zu dieser Zeit erschien Ferris Tucker auf dem Deck vor dem Achterkastell und berichtete Hasard von einer Eigentümlichkeit im Vorschiff der Galeone, die ihm Kopfzerbrechen bereitete. Dort befände sich nämlich, so sagte er, unter dem Holz des durchs Deck geführten Bugspriets ein Raum, der entgegen der sonstigen Bauweise total abgeschlossen sei.
„Na und?“ fragte der Seewolf.
„Ich weiß nicht, was dahintersteckt“, erwiderte Ferris Tukker. „Dieser letzte Teil im Vorschiff ist regelrecht abgeschottet, da verlaufen von der Deckshöhe bis anscheinend hinunter zum Kiel sauber verfugte Bohlen so dick wie meine Faust, aber ich begreif nicht, was das soll. Warum lassen die Dons das Unterdeck nicht offen bis zum Bug durchlaufen, damit man überall ran kann, wenn’s mal nötig ist? Ich habe gegen die Bohlen geklopft – es klingt hohl dahinter.“
„Muß es doch auch“, sagte Hasard. „Die können doch nicht das Vorschiff aus Vollholz bauen.“
„Natürlich nicht“, sagte Ferris Tucker, „nur kapier ich gottverdammt nicht, warum die Dons diesen ganzen Raum abschotten. Da könnte man doch alles mögliche verstauen und unterbringen, wie das überall getan wird. Man verschenkt keinen Raum, verstehst du?“
„Ferris“, sagte Hasard sanft, „ich bin kein Spanier und habe diesen Kasten nicht gebaut, Mein Problem ist zur Zeit dieser Sturm, der in zwei, drei Stunden losbrechen wird und überstanden werden muß. Ist die ‚Santa Barbara‘ dicht, oder ist sie es nicht?“
„Dicht ist die alte Tante, da freß ich einen Besen.“
„Gut“, sagte Hasard, „mehr interessiert im Moment nicht. Wenn wir den Sturm hinter uns haben, säg von mir aus ein Loch in die Bohlen, die das Vorschiff abschotten, und studier dann die Schiffbaukunst der Dons. Hast du die Luken verschalkt?“
„Alles klar“, sagte Ferris Tucker. „Meinst du, daß es dick wird?“
„Noch dicker“, erwiderte der Seewolf grimmig. „Schau dir doch mal die niedlichen Feuerchen auf den Toppen und an den Rahnocks an. Von meinem Alten weiß ich, daß diese Erscheinungen vor knüppeldicken Stürmen aufzutreten pflegen.“
„Da hat Sir John recht“, sagte der riesige Schiffszimmermann. Genau zwei Stunden später sprang plötzlich Wind auf, fegte von Süden in die Takelage, daß es nur so pfiff, drehte ebenso urplötzlich auf Südost und knallte mit doppelter Wucht auf das Schiff.
Die „Santa Barbara“ legte sich über, richtete sich stöhnend wieder auf und raste jäh wie ein durchgehender Ackergaul los – trotz der verminderten Segelfläche. Über Backbordbug schob die Galeone schnaubend durch die aufgewühlte See. Die Luvwanten wirkten wie straffgespannte Saiten, über die der Wind geigte. Ein Pfeifen, Tosen und Donnern erfüllte die Luft, dann stoben Regenböen waagerecht über das Schiff, und zuckende Blitze beleuchteten das grandiose Inferno aufgewühlter, schäumender Wassermassen.
Die See war entfesselt und schlug zu.
Vier Männer standen am Kolderstock achtern unter dem Kastell und stemmten sich gegen das schwere Holz, das den Ruderdruck aus der Waagerechten in die Senkrechte übertrug.
Hasard brüllte ihnen zu, nach Steuerbord hochzudrehen, um die Sturmstöße nicht direkt von achtern nehmen zu müssen. Langsam, ganz langsam luvte die „Santa Barbara“ an und drehte ihren Bug schräg gegen den Wind.
So nahmen sie auch die anrollenden Seen. Der Bugspriet der „Santa Barbara“ stieß in endlose Tiefen vor und erkletterte wieder schwindelnde Höhen. Dort oben auf den Kämmen, die ein brodelndes Chaos waren, tanzte das Schiff wie auf einem Seil, verharrte Sekunden und stürzte jäh wieder in die Tiefe.
Hasard ließ sich von Ben Brighton festbinden und brüllte ihm zu, auch die Männer an Deck mit Tampen zu sichern. Ben Brighton nickte ihm zu und verschwand am Niedergang zur Kuhl in einer Gischtwolke.
Dafür hangelte sich Ferris Tucker zum Quarterdeck hoch, rutschte quer über die Planken und wurde gerade noch von Hasard am Kragen gepackt und hochgehievt. Der riesige Mann klammerte sich an den Seewolf und sagte keuchend: „Der Scheißkasten macht Wasser. Wir müssen lenzen, Hasard.“
Die Pumpe befand sich auf der Backbordseite am Großmast, dort, wo ständig Wassermassen über die Kuhl brandeten, so daß die Männer manchmal bis zum Bauch im Wasser standen.
„Mist verdammter“, stieß Hasard heraus. „Wo kommt das Wasser her?“
„Wahrscheinlich von den Plankengängen oberhalb der Wasserlinie. Der Kasten krängt zu weit nach Backbord über. Das Holz oberhalb der Wasserlinie ist zu trocken.“
Als Hasard den Befehl geben wollte, wieder abzufallen, erfolgte ein peitschenartiger Knall, der sie im Tosen der Elemente wie ein Stich durchfuhr.
„Der verdammte Fockmast“, sagte Ferris Tucker erbittert.
Jetzt drückte der Sturm nur noch auf das Lateinersegel am Besan, und die „Santa Barbara“ versuchte anzuluven, aber über die Backbordseite vorn hing der Vormast samt Fock und Takelage und verhinderte, daß die Galeone in den Wind schoß.
Ferris Tucker stöhnte vor Wut, und Hasard brüllte ihn an, den ganzen „Mist“ zu kappen und außenbords gehen zu lassen. Aber dann hielt er ihn zurück. Im grellen Licht der Blitze hatte er gesehen, daß bereits der Bootsmann und drei Männer auf dem Deck des Vorkastells arbeiteten. Sie schwangen Äxte und hieben wie die Irren auf das Durcheinander der Wanten, Fallen und Spieren ein.
„Fahr die Trossen achtern aus, Ferris!“ schrie er dem Schiffszimmermann zu. „Paß aber auf, daß sie gut um den Besanmast gelegt sind und nicht ausrauschen. Bring sie so aus, daß die Trossen im Wasser eine riesige Schlinge bilden. Hast du kapiert?“
„Aye, aye.“ Ferris Tucker verschwand mit zwei Männern unter dem Achterkastell.
„Blacky, Smoky, Dan!“ schrie Hasard. „Seht zu, daß ihr den Lateiner herunterkriegt! Weg mit dem Tuch! Ich muß jetzt das Heck in den Wind bringen! Rudergänger! Abfallen nach Backbord! Seht zu, daß ihr den verdammten Kahn vor den Wind legt!“
„Aye, aye“, tönte es zurück.
Gefährliche Sekunden und Minuten verstrichen. Die „Santa Barbara“ drehte ab und wurde von einem donnernden Brecher an der Steuerbordbreitseite erwischt. Es war ein Schlag wie mit einem riesigen Amboß. Für Sekunden stand eine schäumende Wasserwand über der Kuhl, raste quer über das Deck und fegte über das Schanzkleid auf der Backbordseite. Die Galeone krängte weit nach Lee und brauchte einen Alptraum von Zeit, um sich wieder aufzurichten.
Ein Mann hing an seinem Sicherungstampen zappelnd über dem Schanzkleid der Backbordseite und wurde von zwei anderen mühsam an Deck gehievt.
Das Lateinersegel mit der riesigen Gaffelrah krachte an Deck. Blacky, Smoky und Dan hatten das Fall kurz entschlossen losgeworfen und sich nicht damit aufgehalten, die Gaffel langsam wegzufieren. Sie stürzten sich auf das wildflatternde Segeltuch und bargen es.
Alles das geschah in wenigen Augenblicken, während die „Santa Barbara“ mit schwerer Backbordschlagseite vor den Wind drehte. Der Sturm heulte und pfiff und orgelte, Regenschwaden peitschten über das Deck, Blitze zuckten durch die Dunkelheit, phosphoreszierende Gischtflächen kochten rings um das Schiff.
Die Männer keuchten und spuckten und zitterten. Sie waren fast taub von dem Höllenlärm, und als ein Ruck durch das Schiff lief, glaubten sie, es breche auseinander.
Aber dann merkten sie es.
Die „Santa Barbara“ hatte ihren Sturmlauf gebremst, achteraus hingen die schweren Trossen im brodelnden Kielwasser und hielten das aufragende, breite Heck mit dem Achterkastell vor dem Wind. Fast augenblicklich wurden die Bewegungen der Galeone ruhiger und gedämpfter.
Hasard atmete auf. Wenigstens das war geschafft. Die Trossen wirkten wie ein mächtiger Treibanker. Er spähte achteraus und sah im Lichtschein der Blitze die riesigen Wellenberge, die von Südosten drohend heranrollten, aber ihre Bedrohlichkeit verloren, sobald sie die Zone der Trossen erreichten. Sie glitten kochend und brodelnd unter dem Schiffsleib entlang, rüttelten zwar an ihm, aber ihre brutale, alles zerschlagende Wildheit war gezähmt.
Ferris Tucker erschien auf dem Achterdeck und grinste über das ganze Gesicht.
„Feine Sache!“ schrie er dem Seewolf zu.
Hasard lächelte und schrie zurück: „Kümmere dich um die Pumpe, Ferris! Ich glaube, der Kasten hat sich ganz schön vollgesoffen.“
„Aye, aye.“
Der Sturm wütete die ganze Nacht und die Hälfte des nächsten Tages. Keiner der Männer kam zum Schlafen. Sie pumpten und beseitigten auf dem Vorschiff die Schäden, die der weggesplitterte Fockmast angerichtet hatte.
Sie überstanden den Sturm, aber dann brach ein anderer los – am frühen Nachmittag.
2.
Philip Hasard Killigrew hörte den Lärm, als er gerade im Unterdeck achtern die Trossen überprüfte, die sie noch nachschleppten. Noch ein, zwei Stunden – überlegte er –, dann war das Schlimmste vorüber, und sie konnten eingeholt werden.