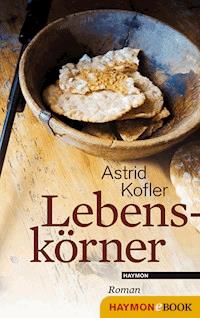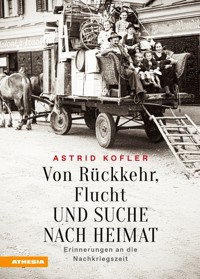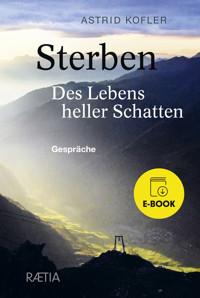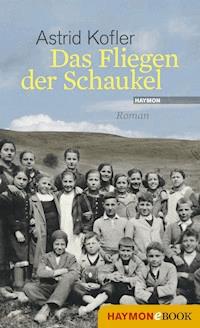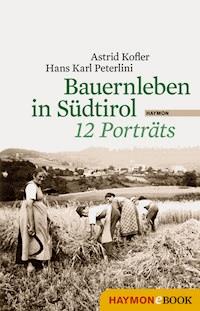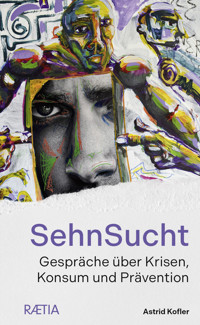
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alkohol, Medikamente, Drogen oder Glückspiel, aber auch Essstörungen, Kauf- oder Sportsucht – Abhängigkeit hat viele Gesichter, die Auswirkungen auf die Betroffenen sowie das Umfeld sind jedoch ähnlich: Was schleichend beginnt, wird zum bestimmenden Lebensinhalt. Die Sucht ist dabei meist ein Sehnen – nach Liebe und Geborgenheit, nach Freiheit und Ausbruch, nach Erfüllung. Astrid Koflers Gespräche mit Fachkräften und Menschen, die Abhängigkeitserfahrungen erlebt haben, machen Mut. Sie zeigen, welche Auswege es geben kann, dass Rückfälle normal sind und wie vielfältig das Therapie- und Präventionsangebot ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Kofler
SehnSucht
Astrid Kofler
SehnSucht
Gespräche über Krisen, Konsum und Prävention
Gedruckt mit Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur, über Hands
Die ganzseitigen Aufnahmen zu den Gesprächen stammen von der Autorin: S. 18 zeigt die Hände von Michaela, S. 58 Interviewsituation mit Hiasl, S. 74 und 95 Äste beim Spaziergang mit Marlene, S. 138 Interviewsituation mit Joséphine, S. 280 Detail bei Anna zuhause, S. 293 der Blick von Annas Balkon in den Abendhimmel, S. 294 Seerosen beim Spaziergang mit Angelina, S. 240 das nun verfallende Haus, in dem Balthasars Mutter als Köchin arbeitete, S. 364 im Auto von Mikael.
Die Bilder der Expertinnen und Experten stammen von diesen privat, von den entsprechenden Organisationen oder von der Autorin.
© Edition Raetia, Bozen 2024
Herausgeber: Hands onlus
Projektleitung: Thomas Kager
Korrektur: Helene Dorner, Gertrud Matzneller
Umschlaggestaltung: Alessandra Stefanut, www.cursiva.it
Umschlagmotiv: Ruben Peterlini/Exit
Satz und Druckvorstufe: Typoplus, Frangart
Druck: Tezzele by Esperia, Lavis
ISBN 978-88-7283-921-8
ISBN E-Book: 978-88-7283-961-4
Unseren Gesamtkatalog finden Sie unter www.raetia.com.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an [email protected].
Inhalt
Sehnsucht. Berührung Die Sucht verstehen
„Als mich meine Mutter rausgeworfen hat, habe ich verstanden, so will ich nicht mehr.“ Michaela
„Sucht ist eine Form der Selbstheilung, die meisten greifen zu Alkohol oder Spiel, um ein tieferes Leid zu überwinden.“ Bruno Marcato und Georg Senoner
„Jetzt sehe ich Sinn. Jetzt will ich leben.“ Hiasl
„Es geht nicht um Schuld. Es geht um Verantwortung.“ Marlene
„Es gibt sehr viele Wege, die zu einer Sucht führen.“ Alberto Degiorgis
„Sucht hat viel mit Angst zu tun und mit Flucht.“ Kurt Cologna
„Ich habe lernen dürfen, besser mit mir umzugehen.“ Joséphine
„Wir müssen akzeptieren, dass es Drogen gibt, und lernen damit umzugehen.“ Patrizia Federer
„Einmal im Jahr fordere ich es heraus, im Karneval suche ich Süchte.“ Hanspeter Mayr
„Für mich bedeutet Sucht, keine Kontrolle zu haben über die eigenen Bedürfnisse.“ Martin Loew-Cadonna
„Das Schwierigste für mich sind die Manipulationen, in die die Klienten mich immer wieder zu verwickeln versuchen.“ Jel Godino
Sehnsucht. Beziehung Die Krankheit überwinden
„Ich muss lernen, dass ich ich selbst sein darf.“ Anna
„Ich spürte eine unglaubliche Leere und Hohlheit.“ Angelina
„Könnten wir unsere Gefühle annehmen, hätten wir viel weniger exzessive Sucht.“ Mathilde Lintner
„So gesehen bin ich jetzt suchtfrei. Aber ein Süchtiger bleibe ich immer.“ Balthasar
„Sucht will beachtet werden, bis zuletzt. Sie ist ein Narzisst.“ Mikael
„Der Mensch ist wichtiger als die Krankheit.“ Walter Tomsu
Sehnsucht. Begegnung Stark werden gegen Süchte
Dank
Kontakte
Die Autorin
„Die Sehnsucht ist das Meer, die Erfüllung die Welle“.
Johann Wolfgang von Goethe
Sehnsucht. BerührungDie Sucht verstehen
Sehnsucht ist ein Ziehen, ein Schmerz, eine Traurigkeit. Ist Wehmut, Melancholie. Sehnsucht ist leise, manchmal lauter, selten definiert.
Sehnsucht ist ein Sehnen. Nach Meer oder Regen, nach Sommer und der Erfüllung eines Traums, nach der Heimat und den Bergen, nach Nähe und den Liebsten. Nach tragfähiger Beziehung zu anderen und zu sich selbst, nach Ermutigung. Um sich etwas zuzumuten, zu leben und sich zu lieben. Nur ein Buchstabe mehr macht aus „leben“ „lieben“. Auch „Suche“ und „Sucht“ unterscheiden sich aufgrund eines Buchstabens, scheinen so ähnlich und sind so verschieden.
Sehnsucht ist das Hoffen auf Glück und Harmonie. Nach Ruhe und Frieden, nach einem Bei-sich-Ankommen und Lebendig-Sein. Nach einem Partner, nach Kindern und Familie.
Sehnsucht ist das Unerreichbare, das heimliche Feuer, das, was fehlt, was heimsucht. Nach einer Fee, die einen Wunsch erfüllt, oder sogar drei, nach Ende, Freiheit und Neubeginn. Nach der Vergangenheit, in der alles heil schien, nach der Zukunft, in der es besser wird. Nach Engeln, die uns begleiten, und einer Göttin oder einem Gott, die uns halten. Nach einer anderen Welt.
Sehnsucht hat viele Synonyme, hat viele Gesichter. Manchmal hat sie auch keine und keinen Namen. Manchmal ist sie einfach nur da, ist ein Gefühl, das fortträgt, ist eine Stimme, wenn wir einsam sind, ist wie der Klang eines Saxofons auf einer ungemähten Bergwiese, und das Echo kehrt wieder. Immer wieder. Wird lauter im Kopf. Tut gar weh.
Sehnsucht wird mit SehnSucht verwechselt.
SehnSucht ist manchmal einfach ein Unbehagen, eine Leere, ein Fragezeichen. SehnSucht verführt, lädt ein, nicht fühlen zu müssen, da es schmerzt. Sie verlockt, noch intensiver zu spüren, herauszufordern, sich zu gefährden. Sie ist nicht ein Suchen, ist ein Siechen. Sie ist ein Licht, das auf uns fällt und bricht, wir verspüren ihre Wärme, wissen von ihrem Dasein, wir leiden, da manche dieser Lichtstrahlen blenden, den Rückweg oder eine Biegung unkenntlich machen. Wir kennen diese SehnSucht alle, geben ihr nach, baden in Wehmut und Selbstmitleid, vertreiben sie, unterdrücken sie.
Sehnsüchte sind verschieden, wie Menschen es sind. SehnSüchte sind es auch. Manchmal bleiben sie ein Bedürfnis, manchmal führen sie zur Abhängigkeit. An Willensstärke oder Willensschwäche liegt das nicht, es ist das Hirn, das uns im zweiten Fall ein Schnippchen schlägt, es sind Gene, Anlagen, Umstände, Lebenserfahrung und ganz einfach Pech.
Leicht ist es mit der Sehnsucht und der SehnSucht nie. Sehnsucht als Bedürfnis ist komplex, und SehnSucht als Krankheit, als Antwort auf eine Lebensfrage, auf ein chronisches Leiden oder einen Infarkt des Moments ist noch viel komplexer.
Warum den seelischen Schmerz aufarbeiten, wenn Alkohol oder Medikamente so wirksam entspannen, betäuben und Wärme schenken, Hemmungen und Ängste vernebeln? Warum den Stress abbauen, wenn Kokain und Speed Lebendigkeit verleihen, Drogen Wohlgefühl schenken und Wachsein, aufputschen und wachträumen lassen? Warum sich mit neuen Facetten des Ich-Seins beschäftigen, wenn täuschende Masken so viel schneller leidvolle Erfahrungen kaschieren helfen, warum Probleme anpacken, wenn Computerspiel und Smartphone so herrlich ablenken und es dabei Abend wird? Konsum führt zur Illusion, dass ich Macht habe, dass ich unangenehme Gefühle beherrschen kann.
Manche haben einen Segen, im richtigen Moment auf Menschen zu treffen, die ihnen guttun, manche das Missgeschick, im falschen Moment mit Menschen zu sein, die im Außen nach Abkürzungen zur neuronalen Belohnung suchten, einfachere Wege fanden. Manche haben die Bürde, dass aus Neugier, Spaß oder Verzweiflung, aus Genuss und Bedürfnis eine Belastung wird. Es geschieht schleichend, es ist nicht so, dass sie es sich wünschen würden.
Abhängigkeit ist eine Krankheit, die jeder Mensch im falschen Moment lernen kann. Wird Sehnsucht zur Abhängigkeit, ist die Befriedigung eine kurze Welle, eine Welle, die sich türmt und verfließt. Manche gehen schlafen und der Morgen danach ist der Beginn eines bewährten Tages. Manche erwachen und sind ernüchtert. Sie machen sich Vorsätze und sagen „heute nicht“, werden dann aber unruhig, schwach, nervös und am Nachmittag heißt es „nur noch heute“ oder „nur noch ein letztes Mal“. Manche haben Gründe, manche haben es nicht lernen dürfen, sich anzunehmen, wie sie sind, haben keine Verbindung zu einem aufrichtigen Ja zu ihrem Leben, eine Blockade zum inneren Ich. Manche haben gelernt, schnelles Dopamin zu finden, eine Belohnung und ein Ersatzpräparat, weil sie wegkommen wollen von dem, was sich nicht gut anfühlt. Weil sie einsam sind. Weil sie die Sorge haben, etwas zu verpassen. Weil sie die Persönlichkeit dafür haben, Mitläufer sind, die tun, was die anderen machen, oder Grenzgänger, die das Risiko lieben, Rebellen, die das Verbotene bevorzugen. Weil sie nicht die Spaßbremse oder spießig sein wollten. Vielleicht wollten sie auch nur probieren oder genießen, weil der Tag so besonders war, der Abend so lau.
Andere hatten eine Kindheit in einem entsprechenden Milieu oder eine Jugend oder auch ein Erwachsensein, in denen sie immer wieder enttäuscht wurden und sich lieber in eine Seifenblase träumten, als ihre Welt zu akzeptieren. Weil vielleicht auch die Erziehungspersonen kein Selbstwertgefühl hatten und sich am Außen orientierten. Weil sie eine Pseudoidentität entwickelten und das sind, was sie glauben, sein zu sollen. Weil sie keine Resilienz erlernten und Angst vor Rührung haben. Weil emotionale, sexuelle, psychische Gewalt anders nicht mehr zu ertragen waren. Weil nur mehr das wahrgenommen werden wollte.
Vielleicht war auch alles perfekt gewesen und nichts war verwickelt in der Familie, aber im eigenen Leben gab es ein Trauma oder akkumulierte Traumatisierungen, einen Auslöser, eine Entscheidung, bei einer Wegkreuzung im Leben abzubiegen, nicht geradeaus zu gehen oder weiterzugehen und nicht umzukehren, weil die Spur zum eigenen Ich verwischt war.
Da die Biografie eines Menschen einzigartig ist, sind auch die Gründe für eine Abhängigkeit individuell. Genauso individuell muss die Behandlung erfolgen. Und diese ist nicht nur der Entzug. Denn hinter jeder SehnSucht liegt viel mehr.
Abhängig sind nicht nur die Fixerin, die in der Wartehalle an der Mauer lehnt, oder der Sandler, der sein Lager im Geschäftseingang aufschlägt, neben sich einen Liter Weißwein im Tetra Pak. Rauschmittel sind nicht nur psychoaktive Stoffe oder Substanzen. Es gibt auch Handydauernutzer und Onlinejunkies, Arbeits- und Sexsüchtige. Menschen leiden an unterschiedlichsten exzessiven Angewohnheiten. Es gibt auch kollektive, politische SehnSüchte, die kippen können, wenn etwa Sehnsucht nach Ferne zu Machthunger und Gier wird und zu Kolonialismus, Unterdrückung und Krieg führt.
Eine Sucht kommt nicht von heute auf morgen. Sie entwickelt sich aus der Belohnung, wird zu Gewohnheit und zum regelmäßigen Seelentröster, zum festgefahrenen Ritual und zur unkontrollierbaren Notwendigkeit. Eine Sucht heißt dann auch nicht mehr Sucht, sie ist eine Abhängigkeit, eine Krankheit, ein Zwang. Auch Konsumstörung wird sie heute genannt. Das neugierige Hirn hat brav gelernt, es hat folgsam gespeichert. Eine Löschtaste kennt es nicht. Die Entscheidung für die Abstinenz muss immer wieder bewusst getroffen werden, auch nach langer Zeit kann es Situationen geben, die das Suchtverhalten reaktivieren. Die erste Zigarette nach Jahren schmeckt genauso gut wie jene damals, als das Rauchen noch keine Kette war, beim Sonnenuntergang auf einem Segelboot, beim Lagerfeuer oder unter den Linden. Das Rauchen war anfangs bei besonderen Momenten ein Ritual, wie der besonders schmackhafte Kaffee zum Samstagsfrühstück am Stadtplatz. Bis es Gewohnheit wurde, wie auch der Kaffee täglich genossen nach Wochen nicht anders schmeckte als in irgendeiner Bar. Dieser Verknüpfung, dieser Gedächtnisspur zu entkommen, ist die größte Hürde beim Ausstieg. Zugleich liegt darin die Chance: Dass das Gehirn lernwillig ist, dass es möglich ist, neue Dinge zu erfahren, die Alt-Gelerntes in den Hintergrund bannen, dass es möglich ist, Verhaltensweisen neu zu ritualisieren, einen Ersatz zu finden, der guttut, geglückte Gefühle und Freude schenkt.
Vielleicht fehlt uns etwas zu unserem Ganzen. Vielleicht sind wir nicht im Gleichgewicht. Vielleicht suchen wir nach Beziehung im Außen, vielleicht im Außen nach Anteilen, die im Inneren verkümmert sind, aufgerieben von anderen Teilen, die stärker sind. Es ist komplex. Auch darin liegen Trost und Hoffnung. Weil wir in uns Dinge finden können, die uns wirklich guttun, die uns das geben können, was wir brauchen. Es ist alles in uns, wir sind ganz, nur ist manches verschüttet. Und außen gibt es nicht nur Verlockung, es gibt auch Hilfe, um die wir bitten können und die uns gegeben wird. Ein Mensch, der alleine aufbricht, um die Welt zu erkunden, mit Rucksack und Wanderschuhen, wird einen Busfahrer treffen, der ihm den Weg weist, und Freunde, die ihm Wasser reichen. Ein Mensch, der alleine loszieht, wird nicht alleine bleiben.
Sucht ist nicht das Randproblem Einzelner, Sucht ist ein gesellschaftliches Thema. Es betrifft uns alle, jeder Mensch ist empfindlich, verletzbar, nicht dagegen gefeit, eine Sucht zu entwickeln. Jeder Mensch kennt die kleine Versuchung, der er schwer widerstehen kann, ob er ein Stückchen Schokolade braucht, sich ohne Handy abgeschnitten fühlt, gerne einen über den Durst trinkt. Süchtig ist er deshalb nicht, betroffen ist er doch: weil der nette Nachbar, der stets das Stiegenhaus kehrt, jeden Abend trinkt, um die Einsamkeit zu vergessen. Weil die Arbeitskollegin, die alles perfekt erledigt und zudem noch drei Kinder erzieht, jeden Abend Medikamente nimmt, um nicht mehr denken zu müssen. Weil der Freund, der für jedes Computerproblem eine Lösung hat, auch nachts am Bildschirm hängt. Weil die Freundin der Tochter, die so schön schlank ist, fast nichts mehr isst. Weil Sucht auch dort ist, wo wir sie nicht vermuten. Frustkäufe, Hypersexualität, Sportfanatismus, Beziehungssucht bis zur totalen Selbstaufgabe. Körperlich abhängig machen sie nicht, körperlich schädlich sind sie manchmal doch, und manchmal bedürfen sie einer psychologischen Behandlung.
Es ist komplex. Genau darin liegt auch der Trost, die Hoffnung. Weil wir alle die Sehnsucht kennen und niemand alleine ist, einsam ja, aber nicht alleine.
Sehnsucht mag Auslöser der Sucht sein. SehnSucht mag Antwort auf Leere sein. Ein Wechsel der eigenen Perspektive, eine Belohnung von Dauer, der Aufbruch zu einem wahren Sein ist nicht einfach. Doch SehnSucht ist das Gegenteil von Freiheit, Perspektive und Lebensmut.
In Therapie zu gehen, ist kein Zeichen von Schwäche. Sich beraten zu lassen und Hilfe zu suchen, ist für Angehörige eine Erleichterung.
Dieses Buch ist der Versuch, Antworten zu geben, wie verwickelt Sehnsucht und SehnSucht sind und wie wenig sie miteinander zu tun haben, wie Sucht sich Wege sucht, wie sich Ausfahrten finden lassen, wie Menschen es geschafft haben, wo sie Zuspruch und Verständnis fanden, wie Resilienz sich trainieren lässt, vielleicht auch wie Eltern ihre Kinder lehren können, sich wert und würdig zu fühlen, ohne Substanzen das Leben zu meistern.
Sehnsucht mag Traurigkeit sein, mag Wehmut sein und Melancholie. Sehnsucht nährt uns auch, ist unser Beginn, unser Antrieb und unsere Inspiration. Sehnsucht treibt Neugeborene, sich aus der mütterlichen Fürsorge und Abhängigkeit zu strampeln. Sehnsucht ist Motivation und Kraft. Ihr zu folgen, sie zu suchen, zu verstehen, woher sie stammt, sie zu pflegen, ist wichtig, um sich selbst kennenzulernen, die verschiedenen Teile dieses Selbst. Ohne Sehnsucht wären wir verwaist und leer. Wir würden weinen, würde sie enden. Sehnsucht will Grenzen, um sich zu spüren, gleichzeitig braucht sie Flügel, will nicht gezügelt werden. Sie will bewusst erfahren sein. Sie mahnt zu Ausdauer und Geduld. Sehnsucht will berühren, will betrachtet werden. Nicht verblasen, weggebeamt und weggespült. Die Erfüllung ist nur ein Moment. Der kurzfristige Ersatz keine Lösung für die vielen Fragen, die innere Leere, im Gegenteil: Zugeschüttet werden die Probleme mehr. SehnSucht hat mit Sehnsucht nichts gemein. Sehnsucht ist das Gegenteil von Sucht. Das ist es, was sie verknüpft.
SehnSucht ist eine Welle, die birst.
Sehnsucht ist unsere Brücke in ein erfülltes Leben.
„Als mich meine Mutter rausgeworfen hat, habe ich verstanden, so will ich nicht mehr.“Michaela
Sie ist zierlich, sehr gepflegt, die Finger hat sie ruhig ineinander verschränkt, das Gesicht ist offen, eine Künstlerpalette, unglaublich vieles lässt sich darauf finden, Traurigkeit und Neugierde auf das Leben, das jetzt kommt. Sie ist noch nicht Mitte 20 und hat Jahre hinter sich, die sie als Sein hinter dem Vorhang in Erinnerung hat und die sie als Flucht vor dem Gitter beschreibt, das immer engmaschiger wurde, je mehr sie zu entfliehen versuchte. Sie war obdachlos, in Therapiegemeinschaften, eingesperrt in der Psychiatrie. Sie hat wieder Zutrauen gewonnen zu sich selbst und gelernt, dass es sich ohne Masken wahrer lebt. Sie hat eine erfüllende Arbeit gefunden und für dieses Interview den Namen Michaela gewählt.
Michael hieß ein Betreuer in der Therapiegemeinschaft, den fand ich richtig gut. Er hat mich nicht mit Samthandschuhen angefasst. Er hat die Sachen so gesagt, wie sie waren, und nicht so, wie ich sie hören wollte oder so wie die anderen es handhabten, um mir nicht Schmerzen zuzufügen. Er war knallhart, das war es auch, was mir am Ende geholfen hat.
Er hat mir gesagt, dass ich mit meinem Verhalten die Menschen manipuliere. Das hat mich schockiert. Mir war das nie bewusst gewesen, und ich habe es auch nie bewusst getan, aber je mehr ich darüber nachdachte, desto stimmiger wurde es. Dass er das so knallhart sagte, war wie ein Rückruf in die Realität, ich hatte nach vielen schwierigen Jahren der Rückfälle endlich den Schlüssel zu reifen, mich zu verstehen. Ich hatte ja nicht mit Absicht manipuliert, es hat nur alles sehr vereinfacht.
Was meinte er mit manipulieren?
Durch mein eher stilles, schüchternes Auftreten hatte ich eine sehr feine Art der Manipulation. Die Leute haben sich das von mir nicht erwartet. Ich habe sie veranlasst, das zu tun, was ich wollte, ohne dass sie es merkten. Ich weiß, das klingt kompliziert. Für mich war es nicht einfach, meine Wünsche zu formulieren, das auszudrücken, was ich eigentlich wollte, ich habe mich mit dem Reden schwergetan. Ich habe meine Mama dazu gebracht, dass sie sagte, was ich eigentlich wollte, und ich musste dann nur mehr ja oder nein sagen, für mich wurde es dadurch einfach. Das war auch mit dem Bruder so, der Oma, mit den Freunden. Es sah immer so aus, als wäre ich mitgerissen worden, aber eigentlich war es mehr das Gegenteil, unbewusst habe ich sie dazu gebracht, das zu tun, was ich wollte.
Menschen manipulieren gemeinhin, damit es ihnen gut geht. Ist es dir damit gut gegangen?
Nein. Ich habe zwar mein Ziel erreicht, aber es war nichts Positives für mich dabei. Sie haben meine Wünsche erfüllt, obwohl es ihnen damit vielleicht nicht gut ging, ich bekam sie erfüllt, obwohl es nicht das war, was ich brauchte. Sie wussten es nicht und ich wusste es auch nicht. So haben wir uns alle unbewusst etwas vorgelogen, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Und dann kamen die Therapieversuche. Und dazwischen immer wieder das Scheitern. Und dann endlich diese Aussage von Michael.
In welchen Therapiegemeinschaften warst du?
Ich war in der Psychiatrie in Bozen, dann von 2019 bis Mitte 2020 in Turin, das hat mir aber nichts gebracht, ich wurde nur dicker und dicker, bis meine Mutter mich holte. Ich war zwei Monate daheim, dann einen Monat in Verona, weil sie da so eine Methode haben, um den Suchtimpuls zu unterdrücken, die hat aber nicht funktioniert, dann war ich zweimal in der Psychiatrie in Bozen. Daraufhin kam ich nach Trient, wo eben Michael einer der Betreuer war. Dort war ich fast ein Jahr. Das war gut, aber ich hatte trotzdem noch einmal einen Rückfall.
Wie hat es begonnen?
Ich bin am Berg aufgewachsen, dort ist der Alkoholkonsum sehr schlimm, mit 13, 14 fängt es an, da habe ich manchmal getrunken, aber nicht exzessiv. Mit 14 habe ich dann mit Cannabis angefangen, dann habe ich mich immer weiter reingesteigert, mit immer härteren Drogen. Mit 17 begann ich Kokain zu nehmen und es drehte sich alles nur mehr darum. Dann kamen die Therapien, eine nach der anderen. Und immer wieder Rückfälle. Auch nach jener Zeit in Trient hatte ich einen Rückfall, aber nicht mit Kokain, sondern mit Heroin. Da war ich dann zwei Monate auf der Straße. Bis ich es geschafft habe, stopp zu sagen. Dass meine Mutter, die mich immer unterstützt hatte, mich nicht mehr daheim wohnen ließ, hat mir die Augen geöffnet. Da habe ich stopp gesagt und das war dann auch ein Stopp. Seither habe ich keine Drogen mehr konsumiert.
Du musstest dir selbst stopp sagen?
Ja. Wenn ich mir eingeredet habe, ich tue es für die Mama, für die Familie, hats nie funktioniert, das hat einen Monat gedauert und dann bin ich wieder rückfällig geworden. Nachdem ich die zwei Monate auf der Straße war, als mich meine Mutter rausgeworfen hat, habe ich verstanden, so will ich nicht mehr. Das war eine traurige Situation, da habe ich in der Nachtstätte für Obdachlose geschlafen. Da habe ich gesagt, das reicht, ich bin am Abgrund angekommen.
Wovon hast du gelebt?
Ich hatte noch Geld übrig von der Arbeit in der Therapiegemeinschaft in Trient, mit dem habe ich mir das Zeug gekauft, am Anfang nur wenig, und als ich dann gesehen habe, dass das Geld langsam knapp wird, habe ich mehr gekauft, um es weiterzuverkaufen. Ich weiß, viele geben ihren Körper her, um an etwas ranzukommen, aber das ist etwas, was ich nie übers Herz gebracht habe, lieber ist es mir schlecht gegangen, jetzt bin ich sehr froh darüber. Das würde mich sehr belasten.
Bekommt man das so einfach in Südtirol?
Am Berg gab es vor allem Kokain. In Bozen findet man alles. Auch von Leuten, von denen man es sich nicht erwartet. Es ist wirklich hinter jeder Ecke zu finden, nicht nur bei den Afrikanern am Zugbahnhof, wie alle glauben. Auch einheimische Jugendliche verkaufen und einheimische Erwachsene.
Die Einheimischen verstecken es halt besser, weil sie den Druck von der Familie haben, weil es eine schöne, heile Familie ist, aus der sie kommen. Dadurch versteckt man es etwas besser als jemand, der keine Familie hat oder mit der Familie nicht zurechtkommt.
In welchem Nachtquartier warst du?
In jenem neben der Rittner Seilbahn, neben dem Busbahnhof. Der untere Stock ist für Frauen vorgesehen, obenauf sind die Familien. Da sind an die sechs Leute in einem Raum untergebracht. Untertags mussten wir wieder gehen. Die meisten waren älter als ich. Dort und auch in der Therapiegemeinschaft in Turin und Trient habe ich einige kaputte Leben gesehen.
Hast du dir einmal überlegt, warum du diese Suchtaffinität in dir hast?
Am Anfang wars ein „Ich möchte schauen, wie das ist“, dann wurde es zu einem Ersatz meines Vaters, der praktisch nicht existent war. Er war, bis ich zwölf war, zu Hause, aber es war so, als hätte es ihn nicht gegeben, er war immer vor dem PC oder dem Fernseher. Dann wurde es zum Ersatz für alles andere, was mir fehlte, zum Ausgleich für alles, was mich verletzte, für jede Abweisung, jedes
„Dass meine Mutter, die mich immer unterstützt hatte, mich nicht mehr daheim wohnen ließ, hat mir die Augen geöffnet. Da habe ich stopp gesagt und das war dann auch ein Stopp.“
Nicht-anerkannt-Werden. Erst kürzlich habe ich herausgefunden, dass mein Vater in seiner Jugend kokainabhängig war. Das war etwas, das auch meine Mutter nicht wusste. Das hat mir die Primarin des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen in Bozen erzählt. Wir sind beide an dieselbe Aufnahmestelle verwiesen worden. Sie hat gedacht, ich weiß es, sonst hätte sie es wohl nicht gesagt.
Hat dich das psychisch getroffen? Trägst du seine Geschichte weiter?
Ja, das hat mich sehr getroffen. Weil es auch die gleiche Substanz war, die uns zum Problem wurde.
Kokain machte mich zum Gegenteil von der, die ich war und auch jetzt wieder bin, sehr ruhig und auch schüchtern. Ich rede nicht gern mit unbekannten Personen, dabei werde ich schnell rot, das ist für mich wirklich eine große Herausforderung. Kokain ist ein Aufputschmittel, das du schnupfen kannst, rauchen oder auch spritzen. Es gibt dir das Gefühl, stark zu sein, unbezwingbar. Es gab mir Selbstsicherheit. Die hatte ich als Kind nicht gelernt, ich war verwirrt, weil mein Vater mich nicht wahrgenommen hat. Mir haben Aufputschmittel immer besser gefallen, beruhigende Substanzen haben mir weniger zugesagt. Aber es kann halt sehr schnell und sehr leicht zu viel werden.
Kokain ist eine Modedroge.
Zuerst freut man sich total, dann kommt die Depression. Da weiß man nicht mehr genau, was real ist, wer du bist und was die Substanz ist. Je mehr man konsumiert, desto verschwommener und verzerrter wird diese Linie. Wenn die Linie reißt, kann man schnell in eine Krise fallen. Das ist fast wie eine Persönlichkeitsspaltung.
Du warst auch lange in der Psychiatrie in Bozen?
Ich war dreimal dort. Das erste Mal haben sie mir dort den physischen Entzug von Kokain gemacht, indem sie es mit Medikamenten ersetzt haben, diese sind mir eben auch in Turin nochmals zum großen Problem geworden.
Inwiefern sind dir die Medikamente zum Problem geworden?
In Turin haben sie mir immer mehr davon gegeben, es waren sehr starke Beruhigungsmittel. Ich war nicht mehr so, wie du mich jetzt siehst. Ich habe durch die wenige Bewegung, die wir dort hatten, und durch diese gleichgültige Stimmung stark zugenommen und war in einem erbärmlichen Zustand, ich wurde depressiv und habe mir selbst Verletzungen zugefügt, ich wollte sterben, es ist völlig eskaliert. Sie haben gedacht, wenn sie mir mehr geben, wird es besser, aber es wurde immer schlechter. Ich war eineinhalb Jahre dort, aber kann mich kaum mehr an etwas erinnern, nur an wirklich einschneidende Begebenheiten, an den Rest nicht. Ich war total zugedröhnt.
Meine Mutter hat mich nach Turin geschickt, aber sie war auch jene, die mich wieder abgeholt hat, weil sie gesehen hat, wie es mir geht, dass es immer schlimmer wird statt besser.
Sie hat dann der Psychiatrie in Bozen geschrieben und nachgefragt, ob sie sich die Therapiegemeinschaften ansehen, bevor sie die Leute dorthin schicken, denn diese Vorgangsweise, die Medikamente immer höher zu dosieren, hat ja auch bei anderen alles andere als eine Besserung bewirkt.
In Bozen haben sie mir auch bei meinem ersten Aufenthalt diese Medikamente verschrieben, aber nur für den Entzug, der Arzt hatte gleich gesagt, ich solle sie bald wieder absetzen, die seien nur für die erste Zeit, weil die Einnahme dieser Ersatzmedizinen sich zur Sucht entwickeln könne. In Turin haben sie das genaue Gegenteil gemacht.
Nach jener Zeit in Turin war ich noch zweimal in Bozen in der Psychiatrie, aber in Covidzeiten waren die komplett überlaufen, es war nicht das Richtige für mich. Anschließend dann, in Trient, war es anders organisiert, wir durften kein Handy haben, im ersten Monat durften wir auch keine Verwandten kontaktieren und dann durften wir einmal in der Woche zehn Minuten lang mit maximal zwei Personen telefonieren, wobei die Betreuenden die Nummern wählten, um sicherzugehen, dass man auch mit den richtigen Personen telefonierte. Üblicherweise wäre einmal im Monat ein Besuch von einer Stunde erlaubt gewesen, dieser war dann aber während der Pandemie nicht möglich. Wir waren komplett isoliert mitten im Nirgendwo, dafür war die ganze Anlage sehr weitläufig, wir waren umgeben von Weinbergen und viel Natur und auch Tiere waren dort. Von der Außenwelt waren wir abgeschnitten, aber unter uns haben wir viel geredet.
Am Anfang war es schwer, auch so ohne Handy zu sein, war eine Umstellung. Doch hat es mir gutgetan. Einmal pro Woche hatten wir ein Vieraugengespräch mit einem Psychiater, und dann gab es auch die Gruppentherapie, die restliche Zeit haben wir gearbeitet. Um 7 hieß es aufstehen, um 7:30 gab es Frühstück, dann bekamen wir unsere Zigaretten, zwölf pro Tag. Von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr haben wir gearbeitet, bis 19 Uhr waren wir frei. Wer nicht pünktlich zur Arbeit oder zum Essen kam, musste den Abwasch für die ganze Therapiegemeinschaft alleine machen. Dieser strukturierte Alltag war für mich sehr positiv, das war etwas, das mir durch den Konsum verloren gegangen war: Da schläft man viel tagsüber, in der Nacht höchstens zwei Stunden, da kommt alles durcheinander. Diese Struktur und auch das Wissen, ich muss heute das und jenes machen, hat meinem Alltag wieder eine Struktur gegeben.
„Am Berg gab es vor allem Kokain. In Bozen findet man alles. Auch von Leuten, von denen man es sich nicht erwartet. Es ist wirklich hinter jeder Ecke zu finden, nicht nur bei den Afrikanern am Zugbahnhof, wie alle glauben. Auch einheimische Jugendliche verkaufen und einheimische Erwachsene.“
Die Sucht bleibt, sagen viele, auch wenn man keine Substanzen mehr nimmt oder sich von einem bestimmten Verhalten löst.
Ja, das stimmt. Ich gehe immer noch alle ein, zwei Wochen für ein Gespräch zum Dienst für Abhängigkeitserkrankungen. Ich bekomme immer noch – nach nun zwei Jahren – eine Substitutionstherapie für das Heroin, auch wenn nur noch in geringen Dosen, das ist auch eine Hilfe, keinen Rückfall zu erleiden. So etwas Ähnliches wie Methadon, etwas leichter. Es ist wie eine Kuscheldecke, der Ersatz gibt Sicherheit. Ich habe mein Leben umgepolt auf Ordnung und Struktur. Die Sucht auf etwas umzupolen, das dir Freude bereitet, dich erfüllt und dir nicht schadet, das ist im Grunde die Therapie.
Die Oberschule hatte ich damals abgebrochen. Jetzt besuche ich eine Privatschule für Erwachsene und schließe dort auch bald ab, nebenher arbeite ich und diese Arbeit gefällt mir sehr.
Konntest du für dein Leben etwas lernen?
Ich habe die Fähigkeit, schnell zu erkennen, ob eine Person gut zu sich selbst ist oder nicht, davon ist auch meine Mutter oft beeindruckt. Die Erfahrungen haben mir bestimmt eine gewisse Tiefe gegeben. Und eine Reife.
Was Freundschaften betrifft, ist da noch eine große Lücke, ich hatte sie fast ausnahmslos in der Drogenszene. Als ich damit aufgehört habe, habe ich mit allen den Kontakt abgebrochen, dies war auch wichtig, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber die andere Seite ist schon so, dass man dann viel allein bleibt, was für mich davor kein Problem gewesen wäre. Aber jetzt, wo ich mehr rausgehen und mir neue Freunde suchen möchte, ist es nicht so einfach, es ist, als ob ich bei null starten würde.
„Die Sucht auf etwas umzupolen, das dir Freude bereitet, dich erfüllt und dir nicht schadet, das ist im Grunde die Therapie.“
Hast du Angst, falsche Freunde kennenzulernen?
Ja und nein. Ich weiß, dass ich immer wieder Personen kennenlernen werde, die mit Sucht zu tun haben, aber ich glaube, ich bin jetzt stark genug geworden, es gleich zu merken und Nein zu sagen, für mein Wohl kann ich das nicht riskieren.
Ich spüre die Stimmungen anderer Menschen sehr. Manchmal lasse ich mich von den Schwierigkeiten anderer zu viel mitreißen, das drückt dann auch meine Stimmung. Da muss ich aufpassen. Wenn es eine Person ist, die mir am Herzen liegt – ich habe zwei, drei gute Freunde – und es dieser schlecht geht, dann bin ich schon für sie da, auch wenn es meine Energie anzapft. Bis zum Punkt, wo ich dann weiß, dass es mich allzu viel runterziehen würde, lasse ich mich auch mitreißen. Einfach ist das nicht.
Nach Trient hattest du einen Rückfall?
Sie haben mir nicht das Okay gegeben zu gehen, es war meine Entscheidung, es war eine bewusste Entscheidung und ich wusste auch, wohin ich gehen wollte. Ich wusste, ich wollte konsumieren. Ich dachte mir nicht, dass es so ein Ausmaß annehmen würde, aber ich wusste genau, wohin ich gehen wollte.
Ich hatte immer so Phasen, es gab gute Zeiten und schlechtere. Und just da war ich in einer Krisenzeit, da wusste ich, ich fahre jetzt nach Bozen, und ich wusste auch schon, wo ich die Sachen abholen gehe. Es gab ein paar Leute, die bei mir Schulden hatten, und da habe ich mir zurückgeholt, was ich in diesem Moment, unter Anführungszeichen, gebraucht habe.
Wie hast du Heroin konsumiert?
Ich habe es geraucht. Ich bin froh, es nicht gespritzt zu haben, ich weiß nicht, was sonst geschehen wäre.
Und deine Mutter hat dich dann auf die Straße gesetzt?
Nach nur wenigen Tagen hat meine Mutter gesagt, wenn ich weiter konsumieren möchte, müsse ich von zu Hause gehen. Heute bin ich ihr dafür dankbar. Ich war dann vier, fünf Tage auf der Straße, dann haben mir das Zentrum Psychische Gesundheit und der Dienst für Abhängigkeitserkrankungen dazu verholfen, dass ich in der Notschlafstelle Dormizil wenigstens einen Platz zum Schlafen hatte.
Können andere verstehen, dass die Sucht einfach stärker ist?
Nein, das ist sehr schwer zu erklären. Sehr wenige verstehen es ansatzweise, andere hingegen stempeln einen ab, sobald man Drogen nimmt oder Drogen genommen hat. Das macht es sehr schwierig, öffentlich darüber zu reden. Ich denke, sehr viele würden dann keine Chance mehr bekommen, Arbeitgeber würden sich schwerer tun, so jemanden anzustellen. Sicher nicht alle, aber wahrscheinlich der Großteil. Hier in Südtirol ist es ein sehr großes Tabu, es nehmen sehr viel mehr Leute Drogen, als man glaubt, auch Leute, bei denen man es sich gar nicht vorstellen würde. Auch Verwandte und Freunde tun sich oft schwer damit, nicht die ehemals Süchtige in dir zu sehen, auch aufgrund der negativen Erfahrungen, die sie früher einmal mit dir gemacht haben: Wenn du abhängig bist oder auf Entzug, existiert du nur mehr für dich selbst und tust Dinge, die du sonst nicht tun würdest.
Wie hat deine Mutter gemerkt, dass du Drogen konsumierst? Und hat sie dich darauf angesprochen?
Meine Mama war Krankenschwester, sie hat es einmal gemerkt nach dem Ausgehen, als ich Ecstasy genommen hatte, das sieht man auch körperlich. Natürlich hat sie mich darauf angesprochen, aber ich hatte daraufhin nur noch mehr Schuldgefühle und fühlte mich noch schlechter. Effektiv geholfen hat es mir zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie ist keine Therapeutin und keine professionelle Figur, sie kann für mich als Mutter da sein, mehr nicht. Darüber haben wir auch oft geredet und ich finde, sie hat es dann richtig gemacht. Sie war da für mich, hat aber die Therapie den Leuten überlassen, die diesen Beruf ausüben, weil das auch eine andere Wirkung hat.
Was können Eltern tun?
Sicher nicht ignorieren, das denke ich, ist noch schlimmer. Das Thema ansprechen: ja. Ich würde auch – so wie meine Mutter es gemacht hat – das Kind zum Dienst für Abhängigkeitserkrankungen zerren, wenn es mit Drogen Probleme hat, oder zu einem anderen Dienst, je nachdem um welche Sucht es sich handelt, zu viel Internet oder Handy oder so. Mit aller Entschlossenheit. Keine Ausnahme machen. Hart durchgreifen, aber nicht böse.
Sehr viele Jugendliche konsumieren regelmäßig Cannabis. Ist das für dich gefährlich?
Das kommt auf die Person an. Es gibt Leute, die sind eher gefährdet, eine Sucht zu entwickeln, und andere, die nur hie und da konsumieren ohne weitere Folgen. Das muss man individuell sehen. Es gibt solche, die Cannabis gut meistern, für die es keine Suchtgefahr gibt, weil es kein Ersatz für etwas ist. Wenn das Cannabis die Oberhand gewinnt, kann das schlimme Folgen haben.
Und nach Trient? Wie bist du da losgekommen? Allein?
Ich habe eingesehen, dass es so nicht mehr geht, ich bin dann alle zwei, drei Tage zum Dienst für Abhängigkeitserkrankungen und habe ihnen gesagt, dass ich versuchen möchte aufzuhören. Ich musste zwei Tage nichts konsumiert haben, um die Therapie anzufangen, da hatten wir zwei, drei Fehlversuche, das heißt, ich bin noch zwei-, dreimal rückfällig geworden. In dem Moment, wo ich dann wirklich aufgehört habe, durfte ich wieder nach Hause ziehen, das wurde so mit meiner Mutter abgesprochen. Das heißt, meinen wirklichen Entzug habe ich daheim gemacht.
Was möchtest du den Jugendlichen mitteilen?
Wenn ich könnte, würde ich ihnen sagen, dass es sich nicht auszahlt. Der Rausch kann die Konsequenzen nicht aufwiegen, die Folgen des Rausches sind gewaltig, es zahlt sich einfach nicht aus. Mit 17, 18 weiß man nicht, was auf einen wartet, auch mit 23, 24 habe ich noch alles vor mir, es ist viel zu früh, sich das Leben kaputtzumachen. Ich möchte das, was vor mir liegt, auch sehen, es wäre schade, wenn es nicht dazu kommt.
„Auch Verwandte und Freunde tun sich oft schwer damit, nicht die ehemals Süchtige in dir zu sehen, auch aufgrund der negativen Erfahrungen, die sie früher einmal mit dir gemacht haben.“
Viele Jugendliche sagen: „Ich schaffe das, ich habe meinen Spaß, ich werde nicht abhängig.“
Man glaubt immer, man schafft es, aber man ist in diesem Alter noch so jung, man weiß gar nichts. Auch von dem, was man zu wissen meint, stimmt nur ein Bruchteil. Man glaubt stark zu sein, aber weiß nicht, ob man es wirklich ist, und schrittweise kommt dann schön langsam immer etwas Neues dazu. Zuerst heißt es, ich rauche nur Cannabis, ich werde nie mit etwas anderem anfangen, dann heißt es, ich schnupfe nur oder rauche nur Heroin, ich werde nie spritzen. Man redet sich dauernd ein, ich habe das unter Kontrolle.
Darfst du Zigaretten rauchen und trinken?
Ja, Zigaretten rauchen darf ich, und das ist auch das Einzige, das mir geblieben ist, ich trinke nicht. Ich dürfte trinken, aber ich glaube, alles, was einen Rausch verursacht, ist nichts mehr für mich, weil das dann auch Erinnerungen weckt, ich vermeide auch immer noch gewisse Stadtgebiete und Personen, die mit meinem Konsum zu tun hatten. Ich lebe nicht mit der Angst, wieder rückfällig zu werden, aber ich bin sehr vorsichtig. Es wird irgendwann möglich sein, dass ich an gewissen Orten vorbeigehen kann, ohne dass es mich nervös macht oder mich aufregt, aber im Moment vermeide ich es noch, das braucht Zeit.
Kann es jeden treffen?
Die Sucht kennt keine Gesellschaftsschichten, gar nichts, sie kann jeden treffen. Es ist schmerzvoll für mich, wenn ich 14- oder 15-Jährige sehe, die berauscht sind, oder zufällig Leuten begegne, mit denen ich früher unterwegs war, und merke, dass sie kein Stück weitergekommen sind. Ich sehe mich dann selbst wieder in gewissen Situationen. Ich finde das traurig, weil ich die Gründe kenne, weshalb es so weit gekommen ist, oder weil ich weiß, was der eine oder andere tut oder zu tun verpflichtet ist, um an den Stoff zu kommen.
Fühltest du dich damals, als du konsumiert hast, ausgegrenzt?
Solange man es verstecken kann, ist man dabei, ist man auch besonders. Wenn es auffällt, wirst du ausgegrenzt, wobei da schon etwas Interessantes zu beobachten ist: Es gibt, zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, jene, die Drogen konsumieren, und jene, die Alkohol konsumieren. Alkohol ist viel länger akzeptiert, in jedem Verein wird getrunken, Alkohol gehört dazu. Jene, die keine Probleme mit Drogen oder Alkohol haben, haben den Drogenkranken gegenüber mehr Verständnis. Effektiv ausgrenzen tun jene, die selbst viel Alkohol konsumieren: Also jene, die selbst ein Alkoholproblem haben, akzeptieren jene mit Drogenproblemen viel weniger. Dabei ist es – im Grunde genommen – dasselbe, es ist genauso schlimm, ob du nun Drogen zu dir nimmst oder zu viel Alkohol. Nur ist Alkoholkonsum halt legal, es ist leichter an Alkohol zu kommen, man macht sich nicht so viele Sorgen, was die rechtlichen Konsequenzen anbelangt. Aber das Suchtpotenzial ist genauso hoch. Dadurch, dass der Alkohol in der Gesellschaft akzeptiert ist, wird er viel, viel länger konsumiert, bis der oder die Betroffene sich einer Therapie unterzieht. Das bedeutet für mich, dass sich die Sucht tiefer im Körper und Charakter einprägt. Die Gemeinschaft in Trient war eine für Drogen- und Alkoholabhängige, und außer einem Jungen, der 20 Jahre alt war, waren alle, die mit Alkohol zu tun hatten, über 50. Bei den Drogen hingegen waren es alle eher Jüngere, also unter 30, außer drei oder vier. Wenn man mit 50 Jahren in die Therapiegemeinschaft gehen muss, ist es ein harter Schlag, zumindest ich hatte das Gefühl, dass es für Ältere, die viel länger mit der Sucht gelebt haben – also mit dem allseits akzeptierten Alkohol –, nochmals schwieriger ist. Es macht einen Unterschied, ob du 30 oder 50 oder noch älter bist.
„Wenn ich könnte, würde ich ihnen sagen, dass es sich nicht auszahlt. Der Rausch kann die Konsequenzen nicht aufwiegen, die Folgen des Rausches sind gewaltig, es zahlt sich einfach nicht aus.“
Du meinst, für Menschen, die jahrzehntelang Alkohol konsumiert haben, ist es viel schwieriger davon loszukommen als für Jüngere, die Drogen nahmen?
Ja. Wenn du um die 50 bist, hat dein Körper das ganz anders gespeichert, dann hast du vielleicht 30 Jahre und auch mehr konsumiert. Wenn jemand mit 20 oder 25 aufhört, dann hat er fünf, maximal zehn Jahre konsumiert und drei Viertel seines Lebens noch vor sich. Es gibt ja auch Menschen, die zuerst arbeiten und dann erst studieren oder bis 30 studieren und sich dann erst ihr Leben aufbauen. Es gibt eine große Chance für jene, die jung aufhören. Es gibt auch eine Chance für den, der spät aufhört, aber der hat es schwerer.
Wer mit 18 mit Drogen erwischt wird, muss immer wieder zur Polizei, muss regelmäßig zur Kontrolle, wenn er beispielsweise den Führerschein haben will, das ist auch eine Hilfe. Beim Alkohol ist das nicht so, wenn du sagst, du trinkst nicht, dann wirst du komisch angeschaut. Es gibt ja auch so viele Witze über das Trinken, ich finde nicht, dass das zum Scherzen ist.
Hast du dich frei, glücklich gefühlt nach dem Konsum?
Man fühlt sich gut, glücklich nicht, frei auch nicht. Im Hinterkopf gibt es immer so etwas wie ein durchsichtiges Gitter. Du weißt genau, dass du nicht wirklich glücklich bist, dass es nur ein Ersatz ist, der dich glücklich macht. Sobald der Rausch weniger wird, werden diese Gitter sichtbar und du wirst dir bewusst, was wirklich los ist. Das ist unangenehm und du wirst das immer weniger aushalten. Je mehr du im Rausch bleibst, desto mehr glaubst du auch, frei zu sein, desto länger bleiben diese Gitter durchsichtig und desto mehr schiebst du das in den Hinterkopf zurück, dass dich der Konsum nicht glücklich macht.
„Es gibt eine große Chance für jene, die jung aufhören. Es gibt auch eine Chance für den, der spät aufhört, aber der hat es schwerer.“
Besser wäre es, die wahren Gitter in diesem Leben zu verschieben …
Das ist es, was es so kompliziert macht. Ich weiß nicht, ob sich jeder dieser unsichtbaren Gitter bewusst ist, und wenn man etwas nicht sieht, dann meint man, es ist nicht hier. Aber nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Das ist auch eine weit verbreitete Überzeugung.
Hast du mit deinem Vater über seine und deine Sucht gesprochen?
Ich habe seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Wenn es anders ausgegangen wäre, als es damals ausgegangen ist, wäre es sicher schön und wichtig, mit ihm darüber zu sprechen. Aber ich möchte ihn am liebsten gar nicht mehr sehen. Er wohnt nicht mehr in Südtirol.
Bis vor zwei, drei Jahren hat mich das sehr belastet. Ich denke auch jetzt noch oft an ihn, meistens sind es dann negative Erinnerungen, die hochkommen, Ereignisse, die mich verletzten. Wie sie kommen, gehen sie auch wieder. Zum Glück. So wie es jetzt ist, ist es für mich geklärt.
„Sucht ist eine Form der Selbstheilung, die meisten greifen zu Alkohol oder Spiel, um ein tieferes Leid zu überwinden.“Bruno Marcato
Psychologe und Psychotherapeut, arbeitet seit 35 Jahren in der Begleitung und Rehabilitation von Menschen in verschiedenen Bereichen, seit 2000 vor allem mit Menschen mit Suchterkrankungen. Er ist seit 2016 Generaldirektor und Leiter von HANDS, arbeitet nach wie vor auch als Psychotherapeut vor allem vor Ort in den Therapiegemeinschaften. Zuvor war er zwölf Jahre Direktor der Sozialdienste Bozen und fünf Jahre Geschäftsführer beim 1977 von Don Giancarlo Bertagnolli und einigen Freiwilligen gegründeten Onlus-Verein La Strada – Der Weg, der sich anfänglich vor allem um die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen und die Wiedereingliederung von Menschen mit Abhängigkeitsproblemen bemühte, aber sein Tätigkeitsfeld in der Zwischenzeit auch auf andere Bereiche ausgedehnt hat. Während La Strada – Der Weg Beratung und Unterstützung für Jugendliche und Erwachsene bietet, die psychoaktive, illegale Suchtmittel konsumieren, hat der Verein HANDS sich auf die Genesung und Wiedereingliederung von Menschen spezialisiert, die von pathologischem Glückspiel und der Internetsucht betroffen oder in Abhängigkeit von legalen Substanzen wie Alkohol und Medikamenten geraten sind. Die Sanitätseinheit hat im Einzugsgebiet des Gesundheitsbezirkes Bozen die ambulante Betreuung und Rehabilitation von alkoholabhängigen Patientinnen und Patienten mittels Vertragsbindung der privaten Vereinigung HANDS anvertraut.
Georg Senoner
Georg Senoner ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender des Vereins HANDS. Er studierte Volks- und Betriebswirtschaft an der Universität Luigi Bocconi in Mailand, führte über 20 Jahre lang das Familienunternehmen Sevi – Spielwaren AG in St. Ulrich, gründete ein Consulting-Unternehmen und arbeitet als Unternehmensberater und Coach mit systemischem Ansatz. Er hat die Methode der Business-Systemaufstellungen weltweit unterrichtet und mehrere Texte in Büchern und Zeitschriften veröffentlicht. Die Begleitung von Veränderungsprozessen, das Suchen von Lösungs- und Entwicklungsoptionen sind seine Leidenschaft. Als Präsident des Vereins HANDS hat er seine Gemahlin Burgi Volgger abgelöst, die sich seit 2017 als Präsidentin von HANDS und zuvor jahrelang auch bei La Strada – Der Weg als Freiwillige engagiert hatte.
Bruno Marcato: Der Verein HANDS ist eine Anlaufstelle für Alkohol-, Medikamenten- und Spielsüchtige und in jüngerer Zeit auch für Personen, die an Computerspielabhängigkeit und anderen neuen Suchtformen leiden. So gesehen kümmern wir uns um Menschen, die mit dem Konsum von legalen, also erlaubten Suchtmitteln in Schwierigkeiten geraten sind. Gegründet wurde HANDS 1982 unter dem Namen „Centro Recupero Alcolisti“, man könnte dies als Zentrum für Alkoholentwöhnung bezeichnen. Damals war Alkoholismus – zumindest in Italien – vor allem ein Thema von Selbsthilfegruppen, die Anonymen Alkoholiker beispielsweise sind als Selbsthilfegruppe 1935 in Ohio gegründet worden und haben auch hierzulande – wie weltweit – Niederlassungen errichtet. In diesen Gruppen trafen sich Betroffene regelmäßig, um über ihre Abhängigkeit zu reden und anderen ehemals Betroffenen zu begegnen, die es geschafft hatten, vom Konsum loszukommen. Mit der Zeit aber wurde es als notwendig erachtet, diesen Menschen auch psychotherapeutische Begleitung anzubieten.
Georg Senoner: Ich kann mich noch erinnern, als ich in Mailand studierte, waren wir an die 50 Südtiroler. Einmal im Monat haben wir uns getroffen und natürlich getrunken. Das wurde von den italienischen Kollegen nicht gern gesehen.
B. M. In meiner Zeit bei La Strada – Der Weg war im deutschen Jugendzentrum der Konsum von Bier erlaubt, im italienischen verboten.
G. S.: Heute hat sich das Trinkverhalten auch in Italien verändert. Hierzulande war es ohnehin immer anders. In jedem Dorf hat es den Bsuff, den Säufer, gegeben, es kannten ihn alle und er war Teil der Dorfgemeinschaft. Heute ist es anonymer, es ist nicht so leicht für Leute mit Abhängigkeitserkrankungen, Kontakt zu halten, sie werden von den Familien ausgegrenzt, verlieren das Zuhause, die Arbeit, da sind viele schlimm dran. Es gibt die unterschiedlichsten Hintergründe für ein exzessives Trinkverhalten, meist stecken tragische Lebensgeschichten dahinter, berührend sind sie immer. Sucht ist eine Form der Selbstheilung, die meisten greifen zu Alkohol oder Spiel, um ein tieferes Leid zu überwinden, und das ist natürlich ein Teufelskreis, aus dem es gar nicht so leicht ist wieder auszubrechen. Sie brauchen eine positive Umgebung.
Deshalb bemüht sich HANDS auch mit verschiedenen Initiativen, sei es in den Therapiegemeinschaften als auch mit den Arbeitseingliederungsprogrammen und auch mit teils von Freiwilligen begleiteten Freizeitangeboten, um die soziale Wiedereingliederung von Abhängigkeitserkrankten.
B. M.: Damals waren die Bedürfnisse in der Stadt andere als am Land oder in Berggebieten. Da war der Konsum von Substanzen noch nicht so vermischt, es gab jene, die tranken, jene die Drogen nahmen, damals war vor allem Heroin das Thema. Die Menschen, die Unterstützung brauchten, kamen aus völlig unterschiedlichen Gegebenheiten, was die Gründer von HANDS – das erst 1997 so benannt wurde, 1999 kam noch das Onlus dazu, für Verein mit gemeinnützigem Zweck – dazu bewog, sich spezifisch mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Anders als in anderen Südtiroler Städten üblich, haben wir unser Augenmerk eben vor allem auf den Konsum legaler Substanzen gerichtet, auch weil die Gesetzeslage unterschiedliche Zugänge zu den Themen legale und illegale Substanzen hat.
„Ich kann mich noch erinnern, als ich in Mailand studierte, waren wir an die 50 Südtiroler. Einmal im Monat haben wir uns getroffen und natürlich getrunken. Das wurde von den italienischen Kollegen nicht gern gesehen.“
Die Geschichten, die die Menschen erzählen, ob sie zu trinken begonnen haben, weil sie von der Familienstruktur her dies als Lösungsmittel bei Problemen kennengelernt hatten, oder aus persönlichen, traumatischen Gründen, beeindrucken mich seit jeher. Die Menschen, die Kultur, die Symptomatologie ändern sich. In meiner Jugend war das Thema Alkohol vor allem ein Männerthema, als ich 13 wurde, hat mein Opa gesagt, ein Glas Wein tut gut, jetzt darfst du zu trinken beginnen. Die mediterrane Kultur unserer Eltern hat uns aber auch gelehrt, Wein tut gut zusammen mit Essen. Also lernte ich, dass man Wein zu bestimmten Anlässen trinkt und das zum Essen, höchstens einmal als Aperitif oder zum Anstoßen bei bestimmten Anlässen. Das unterscheidet die mediterrane Art des Trinkens von der nordeuropäischen, wo immer schon anders getrunken, am Wochenende gefeiert wurde, wo Alkohol auch abseits der Mahlzeiten getrunken wurde. Das ist jetzt auch in Italien anders geworden. Hinzu kommt, dass unter den Jugendlichen die Mädchen inzwischen fast dasselbe Trinkverhalten wie die Jungen haben.
G. S.: Das Problem ist, dass das Suchtmuster bleibt. Das können Menschen gut nachvollziehen, die früher geraucht haben. Früher haben ja viele geraucht, auch wenn das 20 und noch mehr Jahre zurückliegt, so erinnert man sich doch immer wieder, wie schön das war. Sitzt man bei Sonnenuntergang bei einem griechischen Tempel, denkt man sich, jetzt fehlt nur noch eine Zigarette. Das heißt, die positive Erinnerung bleibt, und deswegen ist es eine chronische Pathologie, wenn du dich daran erinnerst, erinnerst du dich automatisch auch an den Genuss, daran, wie sehr es geschmeckt hat. Das ist das Problem. Die meisten können sich beherrschen, denken immer seltener daran, fühlen sich sogar gestört, wenn andere rauchen, aber irgendetwas im Hirn hat sich verändert, sobald man einmal wirklich richtig geraucht hat.
Auch die überwundene Alkoholsucht bleibt eine chronische Erkrankung, die schwer wirklich geheilt werden kann. Das bedeutet, dass die Betroffenen es akzeptieren und annehmen müssen und lernen, damit umzugehen. Sie müssen verstehen, was die Wurzel ihres gestörten Konsumverhaltens ist. HANDS unterstützt sie dabei, die Kraft und den Willen aufzubringen, ihren Lebensstil grundlegend zu verändern
B. M.: In diesem Umfeld ist HANDS entstanden, gegründet wurde der Verein vom Psychologen Cesare Guerreschi, zwei Jahre später wurden die ersten Fachkräfte angestellt, fünf Jahre später begann man, sich auch dem Thema Medikamentenabhängigkeit zu widmen. Seit 2012 werden auch Menschen betreut, die an pathologischem Glücksspielverhalten leiden.
„Damals waren die Bedürfnisse in der Stadt andere als am Land oder in Berggebieten. Da war der Konsum von Substanzen noch nicht so vermischt, es gab jene, die tranken, jene die Drogen nahmen, damals war vor allem Heroin das Thema.“
Die Stimmung war anfänglich sehr familiär. Durch die Anstellung von bezahltem Betreuungspersonal war es notwendig, den Verein auch auf einen ökonomisch sicheren Boden zu stellen. HANDS befand sich immer wieder in Krise, vor allem finanzieller Natur, wenn man mit der Autonomen Provinz und der Sanitätseinheit ein Abkommen hat, muss natürlich alles genau belegt werden, gleichzeitig haben wir dadurch die Sicherheit, arbeiten zu können. Unter dem Landesrat Otto Saurer kam dann ein neuer Präsident, der Neurologe Reinhold Huber. Gemeinsam mit dem Verein La Strada – Der Weg und dem Dienst für Abhängigkeitserkrankungen haben wir 2000 auch das Forum Prävention gegründet, wir waren in den Heilungsprozess involviert und wollten nach nordeuropäischem Vorbild einen eigenen Verein gründen, der sich mit den Bereichen Prävention, Gesundheitsförderung und Stärkung der Jugend beschäftigte.
Als ich dann nach meiner Zeit beim Sozialdienst zu HANDS kam, merkte ich, dass sich die Bedürfnisse der Klienten, wie wir sie nennen, dass sich die ganze Kultur um den Konsum verändert hatte. HANDS hatte nach wie vor eine Therapiegemeinschaft, das Ambulatorium und eine Werkstätte, der Verein La Strada – Der Weg hatte seine Einrichtungen und eine Beratungsstelle. Das war aber zu wenig, das Angebot hatte sich in der Zwischenzeit nicht verändert. Das allgemeine Suchtverhalten aber ändert sich aufgrund kultureller Gegebenheiten und Gewohnheiten. Daher haben wir in den vergangenen Jahren doch sehr viel umgestellt, die Zeit war reif dafür. Wir haben jetzt zwei geschützte Werkstätten, eine in Bozen, in der Teppiche gewebt werden, eine in Meran, in der Tischlerarbeiten gefertigt werden, wir haben vier betreute Wohnungen, in denen Menschen eine Überbrückungsphase durchlaufen können, bis sie wieder eine Wohnung und Arbeit haben.
G. S.: Da wohnen sie zu zweit, große Wohngemeinschaften sind nicht so ideal, denn wenn einer ein Problem und einen Rückfall hat, wird es schwierig für alle. Zu zweit können wir sie besser betreuen. Allein ist nicht so gut, wegen der Einsamkeit.
B. M.: Wir haben mehrere Therapiegemeinschaften, so jene in Rentsch und die Tagesstätte in der Dantestraße, wir haben den ambulanten Dienst in der Italienallee und in der Horazstraße den Sitz von HANDS 4 you, hier werden, hauptsächlich von Freiwilligen, unterschiedlichste Aktivitäten angeboten. Im Ambulatorium, an unserem Hauptsitz, werden 1.500 Menschen jährlich betreut. 300 davon sind neue Klienten. Die meisten kommen freiwillig, ein kleiner Teil kommt wegen des Führerscheinentzugs oder Problemen mit der Justiz oder wird eben vom Dienst für Abhängigkeitserkrankungen an uns verwiesen. Es sind fast alles Einheimische, 70 Prozent davon haben ein Alkoholproblem. Das Konzept Abstinenz ist hier die einzige Lösung, es gibt kein anderes.
„In meiner Jugend war das Thema Alkohol vor allem ein Männerthema, als ich 13 wurde, hat mein Opa gesagt, ein Glas Wein tut gut, jetzt darfst du zu trinken beginnen. Die mediterrane Kultur unserer Eltern hat uns aber auch gelehrt, Wein tut gut zusammen mit Essen.“
Sie kommen freiwillig?
B. M.: Normalerweise kommen zuerst Familienangehörige. Oder sie werden vom Krankenhaus an uns verwiesen. Vor wenigen Tagen bat uns die Psychiatrie des Krankenhauses Bozen, dass wir uns einer Person annehmen, die dreimal im Alkoholrausch und mit Suizidgedanken eingeliefert worden war. Der Mann war uns gänzlich unbekannt, kam aber gerne her und bat uns, ihm zu helfen. Er hat eine Familie, ist ein super Sportler und war sogar in der Nationalmannschaft. Aber manchmal läuft etwas schief. Am selben Tag noch haben wir für ihn einen Platz im Therapiezentrum Rentsch gefunden. Wir können – da wir eine private Einrichtung sind – schnell handeln.
Es gibt – für die Rehabilitation – nur euch?
B. M.: In Südtirol gibt es drei Einrichtungen, die sich mit Rehabilitation und Wiedereingliederung beschäftigen, unsere, La Strada – Der Weg und Bad Bachgart. Wir arbeiten sehr unterschiedlich, von der Arbeitsweise her, aber auch was die Substanzen betrifft, La Strada – Der Weg kümmert sich im Gegensatz zu uns um Patienten, die von illegalen Drogen abhängig sind, und auch um Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen.
Früher mögen Alkohol- oder Drogenabhängigkeit zwei getrennt zu behandelnde Bereiche gewesen sein, heute hat sich vieles vermischt.
B. M.: Das stimmt, deshalb haben wir in den vergangenen Jahren auch Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen gelegt, mit La Strada – Der Weg natürlich, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, der Lebenshilfe, EOS, Caritas, Katholischer Verband der Werktätigen (KVW), Volontarius, Eureca, um nur einige zu nennen, mit dem Dienst für Abhängigkeiten, den Gemeinden, dem Sozialdienst.
„Auch die überwundene Alkoholsucht bleibt eine chronische Erkrankung, die schwer wirklich geheilt werden kann. Das bedeutet, dass die Betroffenen es akzeptieren und annehmen müssen und lernen, damit umzugehen.“
G. S.: Allein sind wir einfach zu klein. Es ist ja auch so, dass die Führung gewisser Dienste, zum Beispiel der Werkstätten, immer wieder ausgeschrieben werden muss, und da ist es oft schwierig, sich gegen andere Genossenschaften durchzusetzen, die beispielsweise ihren Sitz im Süden haben und viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben als wir. Deshalb haben wir nun ein Netzwerk gegründet, in dem wir uns organisatorisch unterstützen.
In Bozen ist die Zusammenarbeit mit dem Dienst für Abhängigkeitserkrankungen eine andere?
B. M.: Der D.f.A. oder SER.D, wie er oft bezeichnet wird, ist südtirolweit die Anlaufstelle für den gesamten Suchtbereich des Sanitätsbetriebes. In Meran, Bruneck und Brixen kümmert er sich um alle Bereiche, die mit Abhängigkeitserkrankungen zu tun haben. In Bozen sind die Bereiche legale und illegale Substanzen anno dazumal getrennt worden, und so sind sie hier immer noch getrennt, doch arbeiten wir auch mit dem Dienst in Bozen eng zusammen. Das ist einzigartig in Italien, es hat sich damals aus der Annahme ergeben, dass sich ein Betroffener mit einem Alkoholproblem nicht an einen Dienst wendet, in dem auch Drogenabhängige Hilfe suchen. Heute nehmen Betroffene oft verschiedenste Substanzen, wenn nun die erste Substanz Alkohol oder Medikamente wie Benzodiazepin sind, kommen sie zu uns, mit Kokain gehen sie zum D.f.A., mit Heroin auch zu La Strada – Der Weg, wobei bei Letzteren der Suchtbereich nur mehr ein Bereich von sehr vielen anderen ist, sie kümmern sich um Minderjährige mit verschiedensten Schwierigkeiten, um Prävention, um schutzbedürftige Menschen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden.
Die Art des Konsums ist eine andere geworden.
B. M.: Fast alle Jugendlichen rauchen Cannabis, das hat sich sehr verändert im Vergleich zu früher, es ist nicht mehr so stigmatisiert wie in den 1980ern, in Deutschland ist es ja inzwischen legal. Cannabis rauchen ist fast normal, Kokain ist inzwischen auch schon fast normal, wenn das so weitergeht, wird man in zehn Jahren darüber diskutieren, dass Kokain gar nicht so schlecht ist. Alkohol ist inzwischen fast noch stigmatisierter als Cannabis. Bei den Heroinabhängigen sah man früher die Einstichstellen, aber bei Cannabis sieht man nichts, am Kleidungsstil merkt man es vielleicht.
Die Abwasserkontrollen ergaben, dass der Kokainkonsum in Bozen und Meran italienweit der höchste ist, also auch höher als in Mailand und auch im Europäischen Vergleich weit oben. Wer konsumiert diese Mengen an Kokain?
B. M.: Jede und jeder hat einen Kollegen, der Kokain nimmt, und wir wissen es gar nicht, das sind auch Manager und andere Leute in hohen Positionen, von denen wir es niemals annehmen würden. Man sieht es nicht mehr. Früher hat man die Heroinabhängigen gekannt, man wusste, wo sie sich aufhielten, wo sie saßen. Man erkannte sie von Weitem, wenn manchmal auch Vorurteile mitspielten, Punks wurden immer mit Heroin in Verbindung gebracht. Heute ist alles viel verborgener. Es hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert und wir müssen darauf reagieren. Aufputschmittel sind ja auch deshalb in Mode, weil von den Menschen viel verlangt wird.
Wann aber suchen sie Hilfe, wenn sich der Konsum so gut verstecken lässt?
G. S.: