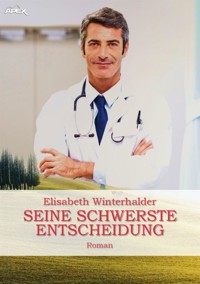
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, in den 1960er Jahren.
Dr. Adrian Römer ist ein junger Arzt, der keine Kompromisse kennt. Selbst jene Menschen, die ihm nahestehen, sind oftmals überrascht von seiner Beharrlichkeit und seinem Eigensinn. Aber Adrian Römer kennt seine Ziele und die Erfordernisse seines Berufs. Erfolg und Karriere bedeuten ihm nichts, wenn er nur den hilflosesten unter seinen Patienten, den Kindern, wirklich helfen kann. Und dieser Anspruch ist es, der ihn eines Tages in einen schweren Konflikt stürzt: Hat er als Arzt das Recht, ein Kind zu operieren, auch, wenn die Einwilligung der Eltern nicht vorliegt? Oder muss er, vor diese Entscheidung gestellt, den kleinen Patienten sterben lassen?
Mit Seine schwerste Entscheidung legt Elisabeth Winterhalder einen ebenso spannenden wie dramatischen Roman vor, der kenntnisreich das Dilemma zwischen ärztlicher Ethik und den Buchstaben des Gesetzes offenlegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ELISABETH WINTERHALDER
SEINE SCHWERSTE ENTSCHEIDUNG
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
SEINE SCHWERSTE ENTSCHEIDUNG
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Das Buch
Frankfurt am Main, in den 1960er Jahren.
Dr. Adrian Römer ist ein junger Arzt, der keine Kompromisse kennt. Selbst jene Menschen, die ihm nahestehen, sind oftmals überrascht von seiner Beharrlichkeit und seinem Eigensinn. Aber Adrian Römer kennt seine Ziele und die Erfordernisse seines Berufs. Erfolg und Karriere bedeuten ihm nichts, wenn er nur den hilflosesten unter seinen Patienten, den Kindern, wirklich helfen kann. Und dieser Anspruch ist es, der ihn eines Tages in einen schweren Konflikt stürzt: Hat er als Arzt das Recht, ein Kind zu operieren, auch, wenn die Einwilligung der Eltern nicht vorliegt? Oder muss er, vor diese Entscheidung gestellt, den kleinen Patienten sterben lassen?
Mit Seine schwerste Entscheidung legt Elisabeth Winterhalder einen ebenso spannenden wie dramatischen Roman vor, der kenntnisreich das Dilemma zwischen ärztlicher Ethik und den Buchstaben des Gesetzes offenlegt.
SEINE SCHWERSTE ENTSCHEIDUNG
Erstes Kapitel
Es war an einem schönen, blauschimmernden Oktoberabend in Frankfurt am Main, und jeder, der seinen Verstand halbwegs beisammen hatte, hätte anderes im Kopfe haben müssen als verengte Arterien und Kreislaufstörungen. Zumindest jeder junge Mann. Einunddreißig war jung. In letzter Zeit schrieben die Zeitungen davon, dass man noch mit fünfundvierzig jung sei. Also musste Adrian Römer mit seinen einunddreißig Jahren tatsächlich sehr jung sein.
Warum schmerzten dann seine Füße und sein Rücken? Warum brannten seine Augen und schweiften seine Gedanken immer wieder ab zu den Sorgen und Nöten seiner ihm Kummer bereitenden Patienten, statt...?
Er drückte auf Biggys Klingelknopf, stieß die Tür behutsam auf und trat ein.
»Ich werde nie heiraten«, erklärte er, wobei es ihm völlig gleich war, ob ihn jemand hörte oder nicht, »weil ich ganz sicher bin, dass ich dann in einem Haus mit einem schönen, großen Garten leben müsste.«
Das dunkelhaarige Mädchen auf der Couch sah ihn fragend an, lächelte, und er neigte sich, um ihre Wange zu küssen.
»Jedes Zimmer müsste mindestens eine Terrasse oder einen Balkon haben«, fügte er hinzu und nahm in dem einzigen Sessel, der im Zimmer stand, Platz. Biggy konnte es sich nicht leisten, allein zu wohnen und auch noch Möbel zu kaufen.
Adrians Augen flogen zu der blondgelockten Frau, die am Boden hockte und die Windeln eines Babys wechselte. Adrian runzelte die Stirn. Warum war Biggy nicht allein?
Biggy lächelte ihm zu.
»Frauen mit Lockenwicklern«, seufzte Adrian und schüttelte den Kopf. »Diese großen, dicken Rollen, die ihre Köpfe einrahmen. Und dazu Caprihosen in den unmöglichsten Farben. Kann man die Dinger wirklich nur in Grün, Rosa und gestreift bekommen? Lieber Himmel, diese Streifen!« Er legte die Hand an die Stirn, und Biggy kicherte.
»Adrian...«, sagte sie dann, sprang geschmeidig von der Couch und trat neben ihn. »Adrian, Liebling, hör einen Augenblick zu reden auf!«
Er blickte zu ihr auf. »Warum?«, fragte er erstaunt.
Sie lachte. »Nun, zuerst einmal möchte ich dich mit Helena bekannt machen.«
Adrians Augen glitten zu dem blonden Mädchen, das am Boden kauerte, und von dort zu dem Baby, das seiner Mutter sehr ähnlich sah.
»Wie alt ist sie?«, fragte er mit ernster Stimme.
»Oh, Adrian!«, rief Biggy lachend.
»Ich meinte das Baby.«
»Nun, das Baby ist zwanzig Monate alt, und Helena – sie heißt jetzt Frau Riemann – ging mit mir in die Schule. In die Handelsschule, meine ich.«
»Wie geht es Ihnen, Helena?«, fragte Adrian, dem das ganz egal war – und er ließ sich das auch anmerken. Er erhob sich, kniete neben dem Kind nieder und nahm eines der dürren Ärmchen zwischen die Finger. »Heißt sie Stefanie?«, fragte er mit einem Blick auf die Mutter.
Die junge Frau lachte. »Woher wissen Sie das?«, kreischte sie auf.
»Wie könnte es anders sein«, sagte Adrian. »Seit etwa zwei Jahren heißen alle Babys entweder... Wieviel wiegt sie?«
Das Baby protestierte jammernd, als Adrian es festhielt und das kleine rosa Kleidchen von der Schulter schob. »Sie ist ziemlich dünn«, murmelte er.
Das Kind sah wirklich krank aus. Es hatte eine blasse Gesichtsfarbe, und die rechte Schulter und der Arm schienen empfindlich zu sein.
»Ist sie einmal gefallen?«, fragte Adrian die Mutter.
»Er ist Arzt«, hörte er Biggy erklären.
»Ach so«, sagte das blonde Mädchen. »Nun – nein, in letzter Zeit nicht. Als sie ganz klein war – einmal ist sie sogar vom Tisch gefallen.«
Adrian knöpfte bereits das kleine Kleidchen auf und streifte es von den Schultern und der Brust.
»Adrian!«, protestierte Biggy.
Er warf ihr einen Blick zu. Dann wandte er sich zu der Mutter: »Die Kleine hat eine Geschwulst an der Brust.«
»Ich weiß, die hat sie schon immer gehabt.«
»Hmmm«, war alles, was Adrian darauf erwiderte. Er bog sich zurück, zog seine Brieftasche heraus und hielt sie dem Kind hin. Stefanie griff mit der linken Hand danach. Adrian versuchte, sie dazu zu bringen, den rechten Arm auszustrecken. Die Kleine konnte den Arm wohl bewegen, zog es aber vor, den linken zu benutzen. Die rechte Schulter war geschwollen, und Stefanie jammerte, als Adrian sie berührte. Eine Rötung war nicht zu sehen.
Der Arzt erhob sich und ging im Zimmer umher.
»Geh ruhig nach Hause, wenn du willst«, murmelte Biggy ihrer Freundin zu. Sie hätte es gern gesehen, wenn diese fortgegangen wäre: Adrian, der Chef-Chirurg im Krankenhaus war, hatte nicht genügend Freizeit, um sie an kümmerliche Babys zu verschwenden.
Jeder konnte sehen, dass Stefanie klein für ihr Alter war, aber schließlich schleppte Helena sie auch überall mit sich herum. Sie fütterte sie mit Naschereien, und bei den Hauptmahlzeiten nahm die Kleine dann wahrscheinlich nichts zu sich... falls es überhaupt richtige Mahlzeiten gab...
Biggy bückte sich, um die Spielsachen und die Windeltasche aufzuheben.
»Bringen Sie die Kleine regelmäßig in die Kinderklinik zur Untersuchung?«, fragte Adrian Helena. Seine Stimme klang unfreundlich, und das passte ihr nicht.
»Nein, das tue ich nicht!«, rief sie. »Es fehlt ihr ja gar nichts!«
»Natürlich fehlt ihr etwas«, grollte Adrian. »Ich sehe schon auf Anhieb mindestens dreierlei, was bei ihr nicht stimmt. Sie müsste mehr wiegen – viel mehr. Sie sieht krank aus, und wahrscheinlich ist sie das auch. Warum bringen Sie sie nicht in die Klinik und beweisen mir, dass ich mich geirrt habe?«
Jetzt war Helena zutiefst beleidigt. Das Baby sei in Ordnung, erklärte sie Biggy. Sie stieße sich leicht und sei wählerisch beim Essen, aber sie sei nicht krank! »Du und deine Freunde, die Ärzte!«, sagte sie, als sie zur Wohnungstür rauschte.
Als sie verschwunden war, wandte sich Biggy um und sah Adrian vorwurfsvoll an. »Du bist wirklich unmöglich!«, versicherte sie ihm und kniete nieder, um Kekskrümel vom Teppich zu kehren.
Adrian zog seine Schuhe aus und streckte sich auf der Couch aus.
»Ich kann dir drei Gründe nennen – nein, vier«, sagte er, »warum dieses Baby zwangsweise in die Klinik gebracht werden müsste.«
Biggy richtete sich auf. »Was meinst du damit – zwangsweise?«, fragte sie.
»Genau das, was ich sagte: zwangsweise! Diese Frau bringt ihr Kind um, und es gibt ein Gesetz gegen Mord.«
Biggy erhob sich und trat neben ihn. Sie berührte seine Wange. »Meinst du das ernst?«, fragte sie. Bei Adrian konnte man das nie wissen. Manchmal verstand er es, jemand gründlich hinters Licht zu führen.
Aber heute Nacht war sie fast überzeugt, dass er ernst war. Und er bestätigte es ihr. »Ich hätte in der Lage sein müssen, dieser dummen Mutter ihr Kind wegnehmen zu dürfen«, rief er aus. »Ich hätte das Kind ins Krankenhaus bringen müssen – denn es braucht unbedingt Pflege.«
»Oh, Adrian!«
»Es ist so, Biggy. Das Kind wird nicht am Leben bleiben, es sei denn...«
»Wenn das aber wahr ist«, rief Biggy, jetzt selbst erschrocken, »konntest du es dann nicht direkt ins Krankenhaus? Du bist schließlich Arzt.«
»Wie würde es dir gefallen, wenn dir im Bus plötzlich ein Arzt erklärte, man müsste dir die Mandeln herausnehmen, und dass er das Recht hätte, dich umgehend ins Krankenhaus mitzunehmen...?«
»Ach, Unsinn! Der Fall läge doch ganz anders!«
Adrian nickte. »Ja«, pflichtete er ihr ernst bei, »er liegt anders.«
»Aber für ein Kind könntest du nichts tun?«
Sie setzte sich auf den Rand der Couch, und Adrian legte den Arm um ihre schlanke Taille. »Ich habe etwas getan«, erklärte er. »Ich habe die Mutter gewarnt. Mehr kann ich nicht tun. Es gibt Gesetze. Schlechte Gesetze, das gebe ich zu, aber...«
Biggy streichelte seine Wange; sie wünschte sich, sein Gesicht lächeln zu sehen. Die Stunden, die Adrian bei ihr verbrachte, waren ihr kostbar. Sie wollte nicht, dass er sie damit verschwendete, sich mit einem weinerlichen, hässlichen kleinen Ding zu beschäftigen, das zufällig in der Wohnung gewesen war, als er ankam.
»Musst du denn immerzu nur Arzt sein?«, fragte sie und verbarg ihm ihre Verstimmung keineswegs.
Jetzt lächelte Adrian ihr endlich zu. »Ja«, sagte er, »natürlich. Warum? Magst du das nicht?«
»Ich werde uns das Abendessen zubereiten«, gab sie statt einer Antwort zurück. Als sie den Raum durchquerte, um zur Küche zu gehen, wusste sie, dass Adrian ihr nachsah. Nach einer angemessenen Frist würde er ihr folgen, und sie würden über andere Dinge sprechen als über seinen Arztberuf.
Es gelang ihr, ihn abzulenken, aber Adrian blieb während des ganzen Essens nachdenklich. Ebenso gut hätte er auch in der Kantine des Krankenhauses essen können, so wenig Aufmerksamkeit schenkte er ihren Kochkünsten. Sie gab sich Mühe, eine leichte Konversation in Gang zu halten. Er antwortete ihr – ja, natürlich liebte er es, wenn die Semmeln knusprig waren. Gewiss, auch er fand, dass man sich mit Robert gut unterhalten konnte. Und nein, er hielt es für bloßen Klatsch, dass der Oberarzt vorhabe, das Krankenhaus zu verlassen, um ein eigenes Sanatorium zu eröffnen. Er war eben im Begriff, sich einen Löffel mit Schokoladeneis in den Mund zu schieben, als er plötzlich hervorstieß: »Ich glaube, dass dieses Kind misshandelt wird!«
Biggy blickte mit gerunzelter Stirn auf.
»Vielleicht sogar geschlagen!«, setzte er hinzu.
»Du sprichst von Stefanie?«, fragte Biggy erschüttert.
»In der Tat, ja. Alles deutet auf ein Trauma hin. Natürlich könnte es sich auch um ein körperliches Leiden handeln – da ist die Geschwulst am Brustkorb – Leukämie – vielleicht sogar Störungen des Stoffwechsels –, aber aufs Geratewohl würde ich eher auf häufige Schläge tippen.«
»Aber Adrian!«, rief Biggy entsetzt aus. »Dann musst du doch etwas dagegen unternehmen! Du tust es doch, nicht wahr?« Ihre Augen sahen ihn groß, dunkel und flehend an.
Aber Adrian schüttelte den Kopf. »Auf ihrer Brust befindet sich eine Geschwulst«, sagte er nachdenklich. »Am vorderen Ende der neunten Rippe würde ich sagen. Die rechte Schulter und der Arm... ich vermute, dass die Knochenhaut gezerrt und eingerissen wurde. Selbst auf den Beinen sind Spuren einer verheilten Verletzung.«
Er sprach mehr zu sich selbst. Biggy arbeitete zwar im Archiv des Krankenhauses, aber Adrian wusste, dass diese Ausdrücke kaum mehr als Worte für sie waren. Dennoch war ihr klar, dass Adrian einen Grund haben musste, wenn er sich so mit einer Sache befasste und sich derart darüber aufregte. Er war nicht umsonst leitender Chirurg der Neurologischen Station. Dafür brauchte er enorme medizinische Kenntnisse. Im ganzen Krankenhaus war bekannt, dass Römer auf seinem Gebiet eine Koryphäe war.
»Du musst einen Weg finden«, rief sie ihm zu und griff über den Tisch nach seinem Arm, um ihn zu schütteln.
Er warf ihr einen Blick zu. »Es gibt nur eine Möglichkeit«, sagte er dann, »man müsste deine Freundin dazu überreden, das Kind in die Klinik zu bringen.«
Biggy schüttelte den Kopf. »So gut sind wir nun auch wieder nicht befreundet«, antwortete sie. »Helena lebt nur zufällig in meiner Nachbarschaft. Ich treffe sie ab und zu – auf der Straße oder im Supermarkt. Sie ist ein oberflächliches Ding. Ihren Mann habe ich nur einmal gesehen. Wir sind nicht befreundet, Adrian!«
»Aber du könntest sie besuchen. Sie weiß, dass du am Krankenhaus arbeitest. Du könntest ihr sagen...«
»Was du heute Nachmittag hättest tun müssen«, unterbrach Biggy ihn, »war, das Kind einfach in die Kinderklinik zu bringen. Dort könnte festgestellt werden, was ihm wirklich fehlt – und dann könntest du die Eltern nötigenfalls bei der Polizei anzeigen!« Biggy lehnte sich im Stuhl zurück und lächelte Adrian triumphierend zu.
Er grinste. »So einfach wäre es also gewesen, nicht wahr?«, fragte er mit leicht ironischem Unterton.
»Nun ja – hättest du nicht genau das tun können?«, gab sie zurück.
Er zündete sich eine Zigarette an und schüttelte den Kopf. »Unmöglich. An so etwas war überhaupt nicht zu denken.«
»Aber ich verstehe nicht... hör mal genau zu!« Sie schob die Teller beiseite, stützte die Ellbogen auf und neigte sich dem Mann zu. »Angenommen, du hättest das Kind, Stefanie, verletzt irgendwo am Straßenrand gefunden, neben einem Autowrack vielleicht – hättest du dann nichts für sie getan?«
Adrian schob die Lippen vor und sah zur Decke auf. »Ja«, gab er zu. »Wäre ich zufällig vorbeigekommen – nach einem Unfall –, dann hätte ich das verletzte Kind ins Krankenhaus bringen können.«
»Und in diesem konkreten Fall fandest du es rein zufällig in meiner Wohnung.«
»Hm. Und ich entdeckte, dass das Kind Spuren von früheren Misshandlungen zeigt. Aber nein, Biggy, Stefanie kann mit dem Kind am Straßenrand nicht verglichen werden – nicht mit einem dringenden Notfall. Ich tat alles, was in meiner Macht lag, als ich Stefanies Mutter sagte, sie müsse das Kind zur Untersuchung in eine Klinik bringen.«
»Ich meine, du hättest – um Stefanies willen – mehr tun können!«
»Du könntest vielleicht mehr tun. Aber ich nicht. Ich bin Arzt, und Ärzte müssen besonders vorsichtig sein.«
»Aber das ist doch nicht richtig!«
»Doch, wahrscheinlich ist es das. Außerdem handelt es sich dabei eher um einen juristischen als um einen moralischen Standpunkt. Denn es gibt Gesetze, die vorschreiben, was ein Arzt tun darf und was nicht, und wenn er diese Gesetze nicht befolgt, sollte er davon ausgehen, dass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wird.«
»Wenn aber diese Gesetze vorschreiben, du dürftest ein Kind nicht schützen, das misshandelt wird, dann sind sie falsch, Adrian! Ganz und gar falsch!«
Sie beobachtete Adrians Gesicht, während er seine Zigarette rauchte. Seine Züge waren unregelmäßig, das Gesicht eckig, die Haut verwittert; sein Haar wäre vielleicht blond gewesen, da er es aber sehr kurz trug, nahm es den Ton seiner braunen Haut an. Seine Augen waren blau und tiefliegend. Die Wangen zeigten tiefe Einschnitte, wenn er lachte – heute waren sie gespannt, und die Muskeln spielten darin. Adrian Römer war nicht unbedingt ein gutaussehender Mann, aber die Frauen drehten sich nach ihm um, und die Männer bewunderten ihn. Er hatte breite, kraftvolle Schultern, kräftige Arme und Hände, er war hochgewachsen und schmal.
Biggy Holzheim liebte Adrian Römer und hegte die Hoffnung – gegen alle Vernunft –, dass auch er sie eines Tages lieben würde.
Heute jedoch waren seine Gedanken mit allem Möglichen, nur nicht mit dem dunkelhaarigen Mädchen beschäftigt, das ihm sein Abendessen vorgesetzt hatte und über Dinge mit ihm sprechen wollte, die mit seinem Beruf nichts zu tun hatten. Wenn er aber nur an ein misshandeltes Kind dachte und darüber sprechen wollte, dann war Biggy bereit, auch über dieses Thema zu debattieren. Es blieb ihr dennoch vorbehalten, darauf zu warten, dass sich seine Stimmung besserte oder dass er – was selten vorkam – zu Zärtlichkeiten neigen würde.
Jetzt drückte er seine Zigarette aus und sah Biggy stirnrunzelnd an, ohne sie überhaupt zu sehen. »Die Gesetze sind falsch«, sagte er langsam. »Im Falle deiner Stefanie ganz bestimmt.«
»Nenne sie nicht meine Stefanie!«, protestierte Biggy. »Und können wir wirklich nichts tun?«
Adrians Blick ruhte auf ihr. »Du und ich, Biggy?«, fragte er. »Nein. Nicht wie die Dinge liegen. Du könntest deiner Freundin gegenüber die Klinik erwähnen, sagen, dass alle Kinder regelmäßige Untersuchungen nötig haben, Kräftigungsmittel... Dann, falls es dir gelingt, sie dazu zu überreden, ist es vielleicht möglich, die Eltern wegen Vernachlässigung anzuklagen und das Kind dem Vormundschaftsgericht zu unterstellen.« Er runzelte wieder die Stirn. »Eines Tages wird es unter Umständen neue Gesetze geben, die sich mit solchen Fällen beschäftigen«, sagte er nachdenklich.
Dieser Gedanke und Stefanie gingen ihm den ganzen Abend – der nicht ganz so angenehm verlief, wie Biggy gehofft hatte – im Kopf herum. Adrian hatte so selten Zeit, sich zu entspannen, abseits der Arbeit und des Krankenhauses. Es tat ihr leid, dass diese kurzen Stunden verschwendet waren.
Wenn er dienstfrei war, brauchte er Erholung und Abwechslung. Es gelang Biggy manchmal, ihm diese Erholung zu geben – und immer wünschte sie sich nur das eine: das zu tun, was gut für ihn war und ihm Freude machte.
Darum war sie jetzt auch traurig.
Er schien ihre Traurigkeit zu ahnen, und als es für ihn Zeit wurde, sie zu verlassen, küsste er sie.
Den Weg zum Krankenhaus legte er ohne Hast zurück. Er wusste ganz genau, wieviel Zeit er dazu brauchte, von Biggys Wohnung zum Krankenhaus zu gelangen, sich dort zu melden, auf sein Zimmer zu gehen und pünktlich um zehn Uhr seinen Dienst anzutreten.
Er ging also langsam und dachte nach. An der Ecke bog er ein, um am Parkplatz vorbeizugehen. Der Haupteingang des Krankenhauses war hell erleuchtet. Er meldete sich, unterhielt sich mit der Schwester, die Dienst hatte. Während er auf den Lift wartete, sprach er mit allen, die das Wort an ihn richteten, ohne recht zu wissen, was er ihnen antwortete.
Oben lag der Gang still und halbdunkel vor ihm. Im Operationssaal brannte kein Licht. Er ging weiter zu seinem Büro und dachte etwas verspätet, wie schön es gewesen wäre, an diesem milden Herbstabend im Park spazieren zu gehen. Es tat ihm leid, dass er nicht einmal den kurzen Weg von Biggys Wohnung bis hierher richtig ausgenutzt hatte. Armes Mädchen, er hatte ihr den Abend verdorben, weil er sich mit einem Kind beschäftigte, das nur eines von Tausenden in dieser Stadt war. Kein Mensch, kein Arzt konnte sich um alle von ihnen kümmern. Es war besser, wenn ein Arzt seine Kraft für jene aufsparte, denen er tatsächlich helfen konnte.
Er knipste das Licht auf seinem Schreibtisch an und schloss die Tür hinter sich. Mit einiger Mühe war es gelungen, das Zimmer etwas zu verschönern. Die Wände zeigten ein sanftes Grün, die Bettdecke und die Vorhänge waren rosa-beige, die Stahlmöbel silbergrau.
Adrian zog seine dunkelblaue Jacke aus und hängte einen frischen, weißen Kittel über eine Stuhllehne, wo er ihn schnellstens erreichen konnte. Auf seinem Schreibtisch lag ein Brief. Es handelte sich sogar um einen Eilbrief. Er lächelte ein wenig. Er würde von Mutter sein, die ihm oft Eilbriefe schickte. Im Krankenhaus hatte man inzwischen gelernt, dass sie keineswegs so dringend waren, wie sie erscheinen mochten.
Adrian nahm Platz und suchte etwas, um den Umschlag aufzuschlitzen. Wenn er den Brief gelesen hatte, würde er sich hinlegen, bis man ihn brauchte.
Er las und grinste leise vor sich hin; der Brief enthielt die üblichen Dinge. Seine Mutter war eine reizende Frau, großzügig, von dem Leben ausgefüllt, das sie in Berlin führte. Sein Vater war gestorben, als Adrian noch Medizin studierte; seine Mutter heiratete wieder, einen reichen Mann, der gern reiste, Partys veranstaltete und sich mit anderen reichen Männern umgab.
Adrian legte den Brief in eine Mappe, die hinten in seinem Schreibtisch lag. Irgendwann dieser Tage würde er ihn beantworten, und wenn er es nicht tat, dann würde seine Mutter ihn zweifellos anrufen.
Er drehte das Licht aus und legte sich aufs Bett. Jetzt, da er Bereitschaftsdienst hatte, würde bestimmt irgendeine Arbeit auf ihn zukommen.
Tatsächlich öffnete wenige Minuten später die Schwester die Tür und rief seinen Namen, »Dr. Römer?« und dann noch einmal, »Dr. Römer!« Wenn das alles nichts nützte, würde sie hereinkommen und nach seiner Schulter greifen, um ihn nachdrücklich zu schütteln. Er würde stöhnen, sich umdrehen und sie vorwurfsvoll ansehen, dann aufstehen, seinen weißen Kittel anziehen – und hinausgehen...
Er war so trainiert, dass er einschlief, sobald er auf einem Bett lag. Heute aber vermochte er nur zu dösen, dann weckten ihn seine Gedanken wieder.
Die Gedanken an ein kleines Mädchen mit einem Katzenköpfchen, Stefanie. Biggy hatte sich einverstanden erklärt, alles zu tun, um die Mutter dazu zu bringen, mit dem Kind ins Krankenhaus zu kommen.
Adrian ahnte, dass er das Baby nie wieder zu Gesicht bekommen würde.
Aber es gab noch andere, die hilflos, vernachlässigt und misshandelt waren. In diesem großen Krankenhaus kamen sie alle zusammen.
Und für einige von ihnen konnte vielleicht etwas getan werden.
Zweites Kapitel
»Vor Allerheiligen schneit es einfach nicht! Das ist nicht üblich«, erklärte Dr. Römer und sah dem letzten Patienten nach, der aus dem Operationssaal gebracht wurde. Er schob seine Gesichtsmaske herunter und seine Kappe aus der Stirn.
»Sie sollten einmal aus dem Fenster sehen, Doktor«, sagte Pauline Bloch, die sich bereitmachte, dem Patienten zu folgen.
»Das will ich gern tun, wenn ich die Kraft habe, ein Fenster zu finden.«
»Sie sind müde«, sagte die Schwester, die näher trat, um ihm den Kittel aufzubinden.
»Sie etwa nicht?«
»Natürlich.« Ihre Stimme klang heiter, ebenso wie ihre Schritte, als sie von ihm wegging.
Adrian bürstete sich die Hände und begab sich dann in den kleinen Raum, wo er seinen Bericht schreiben und eine Tasse Kaffee trinken konnte. Meistens unterhielt er sich auch noch mit Mitgliedern des OP-Teams, die zufällig vorbeikamen. Der ganze Raum schien voller Instrumente und Ausrüstungen zu sein, aber den Ärzten gefiel es so.
Robert Moorhof hatte vor Adrian das Zimmer betreten. Er griff in den Schrank, um die Tasse herauszuholen, die Dr. Römers Monogramm trug. Dr. Degenhardt folgte ihm fast auf dem Fuße, das graue Haar zerstrubbelt und sich die Hände reibend. Die jüngeren Männer begrüßten den Chef mit freundschaftlichem Respekt, und ihre Augen strahlten auf, als Pauline ihm folgte. Sie alle hatten sie gern und freuten sich, dass sie wieder bei ihnen arbeitete.
Endlich legte Adrian den Federhalten aus der Hand, steckte den Kopf durch die Tür und winkte einem Pfleger zu, der seinen Bericht abliefern sollte. Jetzt würde er seinen Kaffee trinken, sich zurücklehnen und reden...
Aber...
Er fluchte leise vor sich hin.
»Aber, Doktor!«, protestierte Pauline.
Adrian grinste ihr zu und trat beiseite, um Isermann eintreten zu lassen. Was der hier wollte, wusste keiner. Isermann war Arzt in der Inneren Station, aber er besaß die Gabe, gleichzeitig überall zu sein. Im Augenblick kam er, um dem Chef einige Fragen zu stellen. Er musste zu dem hochgewachsenen Mann aufblicken. Dr. Degenhardt antwortete ihm ruhig, und eigentlich wäre es nun für den kleinen Doktor an der Zeit gewesen, zu verschwinden.
Aber nicht Walter Isermann. In dem großen Krankenhaus wurde er Doc genannt. Er liebte seinen Beruf, er klammerte sich daran. Niemals unterschrieb er etwas – aber auch gar nichts –, ohne darauf hinzuweisen, dass er Doktor war. Dies war im Krankenhaus ein alter Witz, ohne, dass ihn das im Geringsten störte. Aber niemals würde er es zum Oberarzt bringen, als praktischer Arzt... wäre er ein Versager.
»Hausarzt in einem Altersheim.« Das war die Laufbahn, die seine Mitarbeiter ihm prophezeiten.
Mittlerweile ertrugen sie ihn mit Geduld. Heute allerdings weniger geduldig, jene vier Ärzte, die ihre Pflicht im OP getan hatten und sich jetzt entspannen wollten. Dr. Degenhardt, der Chefarzt, Dr. Pauline Bloch, Narkoseärztin, Dr. Moorhof und Dr. Römer. Sie hatten keine Lust, dem Geschwätz Dr. Isermanns zuzuhören...
»Ich muss einmal nach Manuel sehen«, sagte Dr. Römer laut und setzte seine Tasse mit einem Klappern hin.
Nach weniger als zehn Minuten kam er zurück. Dr. Isermann war verschwunden. »Wo habt ihr seine Leiche versteckt?«, fragte Adrian und füllte seine Tasse.
»Dr. Degenhardt meinte, er würde vielleicht auf seiner Station gebraucht.«
»Und dagegen konnte Isermann nichts sagen. Ja, das gehört wohl dazu, um Chefarzt zu werden. Verstand!«
Dr. Degenhardt lachte mit den anderen. Er war mit seinem Team zufrieden.
»Ich bin froh, dass ich meine Arbeit wieder aufgenommen habe«, sagte Pauline. Sie meinte damit, dass sie diese Plauderstündchen vermisst hatte, diese berufliche Loyalität, die Unabhängigkeit, den Respekt.
»Wir sind auch froh«, versicherte Adrian ihr herzlich. »Sie sind auf dem Gebiet der Narkose sehr gut.«
»Das muss wohl so sein, bei der Ausbildung, die ich genossen habe«, gab sie zurück. »Natürlich sehne ich mich oft nach den Kindern, den Hunden, meinen gemütlichen Sesseln. Hätte ich die Wahl, wäre ich eher dort als hier.«
Adrian sah überrascht auf. »Warum sind Sie dann zurückgekommen?«
Zu spät sah er Degenhardts gerunzelte Stirn.
Aber Pauline lachte nur. »Ich musste es tun«, sagte sie offen. »Meine Kinder sollen auf die Universität gehen, und mein Mann... ist ein hoffnungsloser Fall.«
Sogar Adrian schämte sich jetzt. »Es tut mir leid, dass ich gefragt habe«, murmelte er.
Pauline grinste ihn an. »Sie hätten es doch früher oder später sowieso erfahren. Ich bin froh, dass ich einen Beruf habe, auf den ich zurückgreifen konnte. Als ich heiratete... es handelte sich um eine jener Romanzen. Verstehen Sie?«
Adrian schüttelte den Kopf. »Ich hoffe, es eines Tages zu verstehen.«
»Oh, besser nicht!«, sagte Pauline. »Die rosarote Brille zerbricht, aus Sonnenstrahlen werden Hagel und Regen, die Blumen um die Haustür ersticken in Unkraut... Seien Sie vorsichtig, ehe Sie sich zum Heiraten entschließen, Adrian – zumindest denken Sie scharf nach! Und«, fügte sie hinzu, »ziehen Sie einen weißen Kittel über, ehe Sie wieder auf Station gehen!«
Adrian lachte verlegen. »Ja – danke«, sagte er. »Das werde ich tun.«
Auch die anderen lächelten. Sie sahen schon jetzt, dass Pauline ihnen auf mancherlei Weise helfen würde. Wenn sie ab und zu ein wenig auf Römer einwirkte, würde das Leben recht interessant werden.
Später begab Adrian sich zu einem seiner genesenden Patienten, um nach ihm zu sehen, und blieb nachdenklich vor der Tür stehen. Er sollte sich wirklich umziehen, Pauline hatte recht. Man musste auch wie ein Doktor aussehen.
Noch ehe er jedoch sein Zimmer erreichte, wurde er aufgehalten. Eine seiner Patientinnen durfte nach Hause gehen und wollte sich nun bei ihm bedanken. Sie nannte ihn ihre Stütze und meinte, dass nur er dafür verantwortlich war, dass sie gesundete und das Haus als geheilter Mensch verlassen durfte. Überhaupt hätten alle Patienten der Neurologischen Station jeden Grund, ihm dankbar zu sein. »Es muss wundervoll sein, in Ihrem jugendlichen Alter, so große Fähigkeiten zu besitzen und so viel Verantwortung tragen zu dürfen.«
Adrian lachte und schüttelte ihre Hand. »Ich wünschte, Sie würden meiner Freundin all diese netten Sachen über mich erzählen«, sagte er zu der Frau.
»Ich möchte das glückliche Mädchen einmal kennenlernen«, versicherte sie ihm herzlich. »Leben Sie wohl, Herr Doktor, und nochmals vielen Dank!«
Adrian lächelte und wandte sich zum Gehen. Die Zeit flog dahin, und noch gab es viel zu tun.
Für den Abend vor Allerheiligen war eine Party geplant. Alle zusammen wollten in ein Restaurant gehen, um Pizza zu essen und Wein oder Bier zu trinken. Es sollte getanzt und geplaudert werden. Adrian hatte Biggy eingeladen. Vielleicht schaffte er es, gegen acht bei ihr zu sein. Er musste es schaffen...
Er machte seine Runde, ein freundlicher, beliebter Arzt. Er schätzte seine Arbeit, seine Patienten. Halb sechs wurde ein Junge eingeliefert. Er und sein Bruder hatten mit einer Schusswaffe gespielt...
Es war eine langwierige Arbeit, die Schrotkugeln aus den Wunden herauszuholen. Die größte Gefahr bestand für die Augen. Morgen würde er daran weiterarbeiten müssen.
Dann wurde ihm gemeldet, dass es einem seiner Patienten sehr schlecht ginge. Die Familie war eingetroffen und wurde von ihm unterrichtet. Er atmete erleichtert auf, als das Telefonlicht auf seinem Schreibtisch zu flackern begann. Er nahm den Hörer ab.
Dr. Degenhardt hatte für zwanzig Uhr eine Besprechung aller Ärzte der Neurologischen Station angesetzt.
Aus seiner Verabredung wurde nichts. Es blieb ihm nicht einmal Zeit, Biggy anzurufen.
Verschiedene Fragen wurden besprochen, dann kam Dr. Degenhardt auf das Hauptthema.
»Es handelt sich darum, dass weder einem Patienten noch seinen Angehörigen voreilige Diagnosen weitergegeben werden dürfen.«
Im Verlauf der vergangenen Woche hatte jemand zu viel geredet. Dr. Degenhardt war für seine Ärzte verantwortlich. Adrian hörte genau zu und merkte sich alles, was gesagt wurde.
Es gab Unterbrechungen, Akten wurden angefordert.
Erst um neun Uhr war es Adrian möglich, Biggy anzurufen.
»Erzähl' mir nicht, dass du später kommst«, sagte sie mit klarer, kühler Stimme.
Adrian lachte. »Es sieht fast so aus. Aber Degenhardt...«
»Dein Boss«, sagte Biggy mit bestimmtem Nachdruck.
Adrian spürte, wie seine Ohren heiß wurden. »Er ist mein Boss, Biggy!«, gab er fest zurück.
»Ja. Ich weiß!«
Sie schwiegen beide. Schließlich gab Adrian nach. Es war seine Schuld, er hatte Biggy warten lassen.
Er hüstelte. »Es tut mir leid«, murmelte er. »Sind wir noch immer verabredet?«
»Natürlich«, sagte Biggy. »Auch ich verfüge nur über wenig Willenskraft.«
»In zehn Minuten«, erwiderte Adrian und legte den Hörer auf. Er war sehr müde. Aber er hatte zehn Minuten gesagt. Er zog sich hastig um.
Letztlich wurde es beinahe zehn Uhr, ehe er Biggys Haus erreichte. Er erwartete Vorwürfe. Aber sie kamen nicht. Nicht sofort.
Sie trug einen roten Mantel über einem weißen Wollkleid. Sie sah ausgesprochen hübsch aus, aber Adrian hatte keine Gelegenheit, es ihr zu sagen. »Schade, dass wir so spät dran sind«, sagte sie und nahm im Wagen Platz. »Alles nette Leute, aber du hast Bereitschaftsdienst, nicht wahr?«
»Man wird mich nur rufen, wenn es unumgänglich nötig ist.«
»Und Degenhardt ist wohl auch im Dienst?«
»Ja. Er bleibt immer in der Nähe.«
»Damit du stets in seinem Schatten stehst«, sagte Biggy anklagend.
»Unsinn. Ich bin froh, dass er da ist. Die Sonne könnte verdammt heiß sein, wollte ich allein in ihren Strahlen stehen.«
»Ich möchte aber, dass du es wenigstens einmal versuchst.«
Adrian dachte über ihre Worte nach. »Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich komme gut vorwärts, ich lerne dazu. Ich brauche Rat und Instruktionen.«
»Genügt es nicht, dass du Chef-Chirurg geworden bist?«
»Der Posten gibt mir Verantwortung, Autorität und sorgt für regelmäßige Kopfschmerzen. In diesen Fällen ist es gut, Degenhardt bei der Hand zu haben, der mich gut berät und mich anleitet.« Adrian lächelte. Er wusste besser als Biggy, wie unerlässlich es war, einen guten Chef zu haben. Adrian hatte ihn.
Er fuhr vorsichtig und dankte es seiner Mutter wieder, dass sie ihm diesen Wagen geschenkt hatte. Die Lichter sprühten auf dem wenigen Schnee, der gefallen war.





























