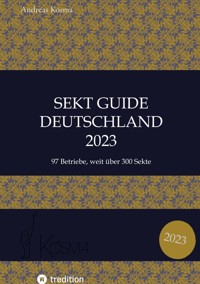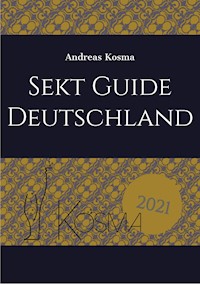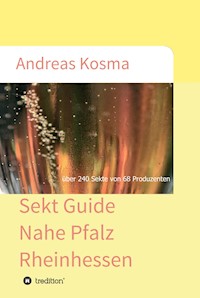
3,49 €
Mehr erfahren.
Erweiterte Neuauflage des ultimativen Ratgebers zur boomenden Sektszene der drei Anbaugebiete im Süden von Rheinland-Pfalz. Portraits von 68 der führenden Schaumweinproduzenten, Vorstellung der Sektkollektionen, reich illustriert. Alle Sekte wurden blind verkostet und neutral bewertet. Mit ausführlichem Infoteil zu Terroir, Herstellungsmethode, Genuss und Food-Pairing.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zur Person:
Im zarten Alter von 5 Jahren hatte Andreas Kosma praktisch schon alles erreicht was in seinem Leben eine tragende Rolle spielen sollte. Fast alles? Nun ja, sagen wir zumindest die grundlegende Voraussetzung war geschaffen. Mit 5 Jahren nämlich war es ihm gelungen seine Eltern dazu zu motivieren aus dem Rheinland in die Pfalz zu ziehen. Und vor allem sie weiterhin in dem Glauben zu lassen, dass es ihre Idee war.
Es folgte der übliche Weg ins Erwachsenwerden: Hoffnungsvolles Talent beim Völkerball in der Grundschule, Romanautor, Messdiener, Zinnsoldatengießer, Asterixleser, Beatles- später Queen-noch später Heavy Metal Fan, Abitur.
Die Kulinarik spielt eine große Rolle in seinem Leben und ist Schwerpunkt seines journalistischen Wirkens. Andreas Kosma hat einen Abschluss als Bachelor of Arts. Seit 1999 hält er Weinseminare, begleitet Start-ups in der Weinbranche, berät Webshops und schreibt für verschiedene Magazine.
Andreas Kosma
Sekt Guide Nahe
Pfalz Rheinhessen
Über 240 Sekte von 68 Produzenten
© 2020 Andreas Kosma
Umschlag, Illustration: Andreas Kosma
Lektorat, Korrektorat: Andreas Kosma
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Was ist Sekt?
Die Böden
Die Rebsorten
Der Grundwein
Zweite Gärung und Hefelager
Rütteln und Degorgement
Die Dosage
Klassische Schaumweinstile
Winzersekt geniessen
Was schäumt in den Regionen?
Wie dieser Guide funktioniert
Die Betriebe
Glossar
Weingüter nach Orten
Vorwort
Schaumwein war in Deutschland schon immer beliebt. Deshalb ist es verwunderlich, dass die deutschen Winzer erst in den 1980er Jahren in größerem Stil damit begannen ihren eigenen Sekt herzustellen. Inspiriert waren die meisten entweder vom Blick über die Grenze nach Frankreich und/oder ihrem Studium in Geisenheim. Dennoch stagnierte die neue Mode zugunsten der Geiz-ist-geil-Mentalität in den 90ern. Mit dem Generationswechsel in vielen Betrieben springen diese aber seit einigen Jahren wieder auf den Zug auf. Wer was auf sich hält, stellt seinem Riesling brut nun auch Sekte aus Burgundersorten zur Seite, mit langem Hefelager und bevorzugt bio. Nie gab es bei uns so viele und so hochwertige Schaumweine wie heute. Und wenn nun in unseren Köpfen auch noch ankommt, dass es unabhängig von Silvester genauso ploppen darf, ja dann wäre die Sektwelt eigentlich ganz in Ordnung.
Bis zum März 2020. Die Gastronomie war tot, der Fachhandel brach ein und die Winzer suchten händeringend nach neuen Vertriebsmöglichkeiten. Der Konsum verlagerte sich stark in den häuslichen Bereich, aber er fand statt. Ich schreibe diese Zeilen im darauffolgenden Herbst und stelle die Frage, ob es nicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Der richtige Zeitpunkt sich etwas zu gönnen und dabei die Branche zu unterstützen? Zuhause mit der Familie oder im Lokal? Die Einsatzmöglichkeiten von Sekt auch über das Begrüßungsglas hinaus kennenzulernen? Mit dem Nimbus des Elitären aufzuräumen? Ich denke ja, und das völlig frei von Ironie, Hohn oder geheucheltem Mitleid. Denn all das haben weder der rührige Weinhandel, noch unsere Lieblingsrestaurants, Lieblingswinzer und am allerwenigsten ihre hochklassigen Produkte verdient oder nötig. In diesem Sinne darf ich Sie nun einladen die hochspannende Schaumweinszene an der Nahe, in der Pfalz und in Rheinhessen zu ergründen.
Mit schäumenden Grüßen,
Andreas Kosma
Was ist Sekt?
Um diese Frage zu klären, muss man sich zunächst mit dem Phänomen auseinandersetzen wie die Bläschen überhaupt in den Wein gelangen. Dazu gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten: Sie wurden zugesetzt, sie stammen aus der ersten oder einer zweiten Gärung des Weines. Das erste Verfahren ist selbsterklärend und es passiert eigentlich nichts anderes als das, was Sie zuhause bei der eigenen Herstellung von Sprudel mittels der CO2 Patrone machen. Hierbei handelt es sich um Perlwein mit geringerem Kohlensäuredruck der deshalb auch günstiger versteuert wird.
Bei der Méthode Rurale (= ländlich) findet die erste Gärung in der Flasche statt. Dabei wird noch nicht vollständig vergorener Most in Flaschen gefüllt, wo er sich mit der Kohlensäure welche bei der weiteren Gärung entsteht anreichert.
Dagegen muss bereits vollständig vergorener Wein durch Hefezusatz eine zweite Gärung durchlaufen um zu sprudeln. Findet diese in einem Drucktank statt, spricht man vom Charmat-Verfahren. Das Hefedepot wird nach Abschluss über Filtration entfernt.
Genau hier liegt auch der Unterschied zwischen der Flaschengärung und der… Achtung: Klassischen Flaschengärung. Nach der zweiten Vergärung in der Flasche muss deren Inhalt vom Hefedepot befreit werden um einen klaren Schaumwein zu erhalten. Verlässt dieser nun die Flasche, wird umgepumpt, abfiltriert und in neue Flaschen gefüllt handelt es sich um das günstigere Transvasier-Verfahren. Verbleibt er in derselben Flasche, wird degorgiert und ggf. dosiert (s. Kapitel Rütteln und Degorgement) sind wir bei der längsten und aufwendigsten Herstellungsmethode, der klassischen Flaschengärung angekommen. Dieses Verfahren wurde in der Champagne perfektioniert und findet heute in allen führenden Schaumweingebieten Anwendung. Es liefert eine besonders feine und intensive Perlage. Stammen die Trauben aus einem einzelnen Weingut, darf das Produkt Winzersekt heißen.
Grundsätzlich handelt es sich in Deutschland ab einem Druck von 3 bar um Schaumwein, über 3,5 bar um Sekt (= Qualitässchaumwein). Ab da und bei mehr als 6 % vol Alkohol wird bei uns eine Schaumwein- bzw. Sektsteuer von 1,02 € erhoben.
Den Begriff Sekt soll im Übrigen der Schauspieler Ludwig Devrient 1825 geprägt haben. In seinem Stammlokal war seine Leidenschaft für moussierenden Wein offensichtlich bekannt. Angeblich brachte man ihm, nachdem er noch ganz in der Rolle des Falstaff von Shakespeare einen „sack“* orderte eine weitere Flasche deutschen Schaumweins. Die Bezeichnung Sekt war geboren.
*(ursprünglich eine Bezeichnung für Sherry)
Die Böden
Ein Hauptbestandteil des gewichtigen Begriffs Terroir ist die Bodenart des jeweiligen Weinbergs. Und sicher prägt diese einen Wein deutlicher und nachvollziehbarer als einen Sekt. Dennoch entscheiden die führenden Schaumweinproduzenten bereits im Weinberg über ihre Sektgrundweine und nicht erst im Keller. Zumal die Geologie in den drei Anbaugebieten vielseitig, und ihre Geschichte bewegt ist.
Diese beginnt im Devon vor 400 Millionen Jahren mit der Bildung des Schiefers. Die Perm-Zeit ca. 100 Millionen Jahre danach war eine unruhige Epoche. Durch das Auseinanderbrechen Pangaeas gab es ausgeprägten Vulkanismus. Zeitgleich entstand- wieder deutlich friedlicher durch Ablagerung- das Rotliegend. Gleichfalls Sedimente sind die drei beherrschenden Gesteinsarten der nachfolgenden Trias von 250 – 200 Millionen Jahren vor unserer Zeit: Zuerst Buntsandstein, später Muschelkalk und schließlich Keuper. Interessanter und für das Landschaftsbild bis heute bestimmend war aber das Paläogen, der erste Abschnitt der Erdneuzeit. Sie startet vor 65 Millionen Jahren, also nach dem Aussterben der Dinosaurier. Die Ausrichtung der Kontinente entsprach schon weitgehend dem heutigen Bild. Allerdings entstand durch tektonische Absenkung der Oberrheingraben und somit eine Verbindung zwischen der Ur-Nordsee und der Paratethys im Bereich unseres heutigen Mittelmeeres. Das Mainzer Becken war also ein Meer und die Küste lag in der Nähe von Bad Kreuznach. Nach dessen Rückzug füllten sich sowohl Graben als auch Becken mit Feinboden. Nach absteigender Korngröße sind dies Sand, Schluff und schließlich Ton. Kam der Sand angeflogen, nennt man ihn Löss, sind die drei Anteile vermischt, handelt es sich um Lehm.
Kein anderes Anbaugebiet vereint dermaßen viele Bodenarten auf so engem Raum wie die Nahe. Die kleinste der drei Regionen reicht auch in drei unterschiedliche Naturräume: Im Norden ist es das Oberrheintiefland, im Nordosten geht es in den Hunsrückausläufer Soonwald über und der Süden gehört zum Saar-Nahe-Bergland. Dabei liegt ein Großteil der Weinberge überhaupt nicht direkt an der Nahe, sondern an ihren Nebenflüssen Glan, Alsenz, Guldenbach und Gräfenbach. Und jedes dieser Stromgebiete bringt sein anderes Stück der Erdgeschichte mit. Devon im Norden, Rotliegend im Osten und Süden, schließlich angeschwemmte oder angewehte Böden am Hauptfluss bis zur Mündung bei Bingen. Die Faustregel an der Nahe: Enorm facettenreich, aber stets von alt nach jung analog der Flussrichtung(en).
Das Anbaugebiet Pfalz liegt am westlichen Rand des Oberrheingrabens. Diese bis zu 40 km breite Senke reicht von Basel im Süden bis in den Frankfurter Raum. An ihren Seiten bauen sich mit dem Schwarzwald, den Vogesen, dem Odenwald und natürlich auch dem Haardtrand Gebirge auf, welche die Rheinebene häufig um mehr als 1000 m überragen. Durch diesen Versatz gelangten nun die weitaus älteren Gesteinsschichten wie Kalk und Buntsandstein wieder an die Oberfläche. Auch der vulkanische Basalt spielt eine kleine aber interessante Rolle. Die Kraterseen oberhalb von Forst zeugen von dieser Vergangenheit. Dass der Oberrheingraben heute aber nicht dem Grand Canyon ähnelt haben wir der Erosion zu verdanken. Wind und Wetter trugen die Seitenränder ab und transportierten das Material stetig in die Ebene. Insofern wurde die Senke sukzessive mit Sedimenten aufgefüllt. Für den bodenaffinen Weinfreund ergibt sich für die Pfalz demnach folgende Faustregel: Je weiter sich die Reben in die Ebene wagen, umso größer ist der Feinbodenanteil auf dem sie stehen.
Rheinhessen erstreckt sich im Süden und Westen des Mainzer Beckens. Es ist die nördliche Fortsetzung des Oberrheingrabens, welches sich aber weniger stark abgesenkt hat. Umrahmt und vor Wetterunbilden geschützt wird es durch das Nordpfälzer Bergland, den Hunsrück, Taunus und Odenwald. Sein Relief ist geprägt durch hügelige Erhebungen aus härterem Kalkstein, der weichere Mergel wurde ausgewaschen. Eine Ausnahme bietet der Rote Hang in Nierstein, der vom Gestein aus dem Rotliegend geprägt ist. Im äußersten Westen, wo die Region an das Anbaugebiet Nahe grenzt, stößt man bereits auf vulkanische Böden. Insgesamt aber ist die Faustregel in Rheinhessen fast noch einfacher: Um Löss kommt man im Mainzer Becken einfach nicht herum.
Der Grundwein
Hauptvoraussetzung für die Vielfalt der Schaumweine ist die Verschiedenartigkeit ihrer Grundweine. Bereits in diesem Stadium steht fest, welche Karriere der fertige Sekt einmal einschlagen wird. Deshalb stehen die Kellermeister schon beim Ausbau der „Vins clairs“, wie sie in Frankreich heißen vor einer ganzen Reihe von Wegkreuzungen…quo vadis?
Allen gemeinsam ist der rigoros schonende Umgang mit dem Lesegut. Für die meisten Winzer ist selektive Handlese, schonender Transport in kleinen Kisten und Ganztraubenpressung bei geringem Pressdruck eine Selbstverständlichkeit. All diese Maßnahmen dienen der Minimierung von Verletzungen der Beerenschalen. Vor allem hier befinden sich die Phenole, eine riesige Stoffgruppe zu welcher auch die Farbstoffe (Anthocyane) und Gerbstoffe (Tannine) gehören. Die einen würden weißen Most verfärben, die anderen ihn bitter oder aggressiv schmecken lassen. Was beispielsweise gerade bei Rotwein erwünscht ist, sollte beim Keltern von (weißem) Sektgrundwein tunlichst vermieden werden.
Einzellage oder Lagencuvée
Wie beim Qualitätswein gilt natürlich auch beim Schaumwein die Regel: Je genauer die Herkunftsbezeichnung, umso individueller der Lagencharakter. Man kann insofern davon ausgehen, dass ein Sekt mit genauer Nennung der Einzellage eben ihren typischen Charakter spiegeln soll. Inwiefern aber ein außergewöhnlich langer Ausbau auf der Hefe dieser Prägung zuträglich ist, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Zudem kann die Vermählung sehr unterschiedlicher Herkünfte in einer Cuvée durchaus auch bereichernd für die Komplexität sein.
Reinsortig oder Verschnitt
Schöner klingt natürlich Monocépage oder Cuvée. Ganz ähnlich wie bei dem obigen Entscheidungsprozess gilt es auch hier- und das ebenfalls ohne Wertung- zu überlegen auf welcher Eigenschaft der Fokus liegen soll. Ein Sekt aus einer einzelnen Rebsorte rückt deren Typizität in den Vordergrund. Er zeigt ihre charakteristische Aromatik auf und spielt ihre Stärken aus. Beim Riesling sind das häufig die Komponenten Frucht plus Säure. In der Cuvée ergänzen sich die einzelnen Vorzüge. Hier kann beispielsweise die verspielte Komplexität eines Pinot Noir einem druckvollen Chardonnay eine wunderbare Lebendigkeit verleihen. Dabei tritt der einzelne Sortencharakter in den Hintergrund.
Lesezeitpunkt
Nicht alles, was früh gelesen wird ist dünn und sauer. Und nicht alles, was physiologisch reif ist ergibt plumpe, langweilige Sekte. Hier liegt der Königsweg in der Mitte. Natürlich legt der Grundwein während der zweiten Gärung nochmals etwa 1,5 % vol an Alkohol zu, was ihm mehr Fülle verleiht. Diese Tatsache muss der Winzer vor der Versektung auf dem Schirm haben. Deshalb handelt es sich hierbei in der Regel um schlanke, säurebetonte Weine, die durchaus ein paar Tage früher gelesen wurden. Wie schlank tatsächlich hängt von dem gewünschten Resultat ab. Aber niemand wird wohl ernsthaft einen Grauburgunder mit bereits 14 % vol zu einem Sekt weiterverarbeiten.
Malolaktische Gärung
Je nach Stil durchlaufen viele Weine die „Malo“. Dabei handelt es sich um die Umwandlung der zupackenden Äpfelsäure in die mildere Milchsäure. Dieser Vorgang wird auch biologischer Säureabbau (BSA) genannt, weil er von Milchsäurebakterien durchgeführt wird. Bei Rotweinen findet er in aller Regel, bei den weißen Burgundersorten häufig statt. Für Rieslinge ist er eher selten, weil hier die belebende Säure durchaus erwünscht ist. Ein fertiger Sekt, dessen Grundwein keine Malo durchlaufen hat, wirkt zumeist frischer und fruchtbetonter. Ein Schaumwein mit BSA kommt weniger rassig daher, schmeckt aber komplex und gereift oft interessanter.
Holz oder nicht Holz
Und wenn, was für ein Holz? „Großes Gebrauchtes oder kleines Neues“ um im Fachjargon zu bleiben. Aber fangen wir doch einfach mal ganz ohne an. Fortgeschrittene Weintrinker kennen bereits den Unterschied zwischen den auf Primärfrucht getrimmten, zumeist im Edelstahl ausgebauten Vertretern und den Barriqueweinen mit ihrer typischen Röstaromatik. Alles zu seiner Zeit. Und dazwischen gibt es natürlich jede Menge weiterer Abstufungen. Grob gilt: Je größer und älter das Fass, umso weniger macht sich die Holznote bemerkbar. Trotzdem findet auch hier eine Oxidation, also weitere Reifung statt, die dem Wein eine zusätzliche Dimension verleiht. Beim späteren Sekt ist das nicht anders. Es kann also entweder die frische Fruchtigkeit oder eben ein Tick Würze erwünscht sein.
Zweite Gärung und Hefelager
Egal ob erste oder zweite Gärung: Hefen verstoffwechseln Zucker zu Alkohol und es entsteht Kohlendioxid. Da es nicht entweichen kann, verbindet es sich mit der Flüssigkeit zu Kohlensäure. Dabei spielen sowohl der Druck als auch die Temperatur gewichtige Rollen.
Und diese zweite Gärung in der Verkaufsflasche ist es, die das Herstellungsverfahren als „klassische“ Methode definiert. Dazu braucht es im Wesentlichen drei Dinge: Hefe, Zucker und bruchsichere Flaschen. 12-14 bar halten heutige Sektflaschen aus, gut 6 bar werden während des Herstellungsprozesses erreicht. Damit sind auch die Fragen nach den dicken Flaschenwänden und dem nach innen gewölbten Böden hinreichend beantwortet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie auch kein zweites Mal benutzt werden, außer als Trophäen auf dem Bücherregal oder Kerzenständer. Um diesen enormen Druck zunächst aber erst einmal aufzubauen brauchen die Hefen Futter in Form von Saccharose. Der durchgegorene Grundwein wird also mit Fülldosage, dem Liqueur de tirage versetzt. Dieser besteht natürlich aus den Hefen, etwa 20- 24 g Zucker für den gewünschten Druck und zumeist einer sogenannten Rüttelhilfe. Häufig handelt es sich hierbei um Bentonit, welches bewirkt, dass sich das Depot später besser von der Flaschenwand löst.
Nachdem nun die Flaschen, pardon, Gärbehältnisse mit Kronkorken verschlossen wurden geht es zur Lagerung erneut in den Keller. Dabei fackeln die Hefen nicht lange, sondern beginnen sofort mit ihrem Stoffwechsel. Bereits nach drei bis vier Wochen sind die 6 bar erreicht und ab da heißt es warten. Insgesamt mindestens 9 Monate Lagerzeit sind verpflichtend für einen Winzersekt, 15 Monate sind es bei Champagner. Bei beiden Produkten ruhen die Spitzenqualitäten um ein Vielfaches länger. Ein Vorstoß in diese Richtung ist das VDP.SEKT.STATUT vom Sommer 2018. Hierbei haben die Mitgliedsbetriebe eine Mindestlagerzeit von 15 Monaten für die sogenannten Guts- und Ortssekte, sowie 36 Monate für Lagensekte beschlossen.
Während dieser Zeit ruhen die Flaschen zumeist in Gitterboxen bzw. früher akkurat geschichtet und teilweise mit dünnen Holzleisten justiert. Davon kommt der französische Ausdruck „sur lattes“. Durch die längere Lagerzeit verbindet sich die Kohlensäure besser mit der Flüssigkeit und es entsteht eine feinere Perlage. Nachdem die Hefen den gesamten zur Verfügung stehenden Zucker verstoffwechselt haben sterben sie ab und werden enzymatisch aufgelöst. Dieser Prozess nennt sich auch Autolyse und sorgt im Sekt für die typischen Noten nach Buttergebäck bzw. Brioche. Echte Alterungsvorgänge sind während des Hefelagers übrigens zu vernachlässigen. Kronkorken und die Hefen selbst wirken der Oxidation entgegen.
Rütteln und Degorgement
Nach der monate- oft sogar jahrelangen Auszeit in Seitenlage haben sich die abgestorbenen Hefezellen an den Unterseiten der Flaschen abgelagert. Der Begriff Depot erklärt die diffuse Konsistenz, welche bis auf die Farbe an den Bodensatz in einer Teekanne erinnert. Ein in dieser Form getrübter Schaumwein ließ sich natürlich nicht gut verkaufen, deshalb musste ein Weg gefunden werden das Hefedepot in Gänze zu entfernen.
Zeitweise wurden dazu die Flaschen kopfüber in den Sand gesteckt, was den Trub zunächst in Richtung Flaschenhals absinken ließ. Für die Abkehr von diesem mühseligen Verfahren sorgte zu Beginn des 19. Jahrhunderts offensichtlich die Witwe Clicquot-Ponsardin. Angeblich durchlöcherte sie gemeinsam mit ihrem Kellermeister den Küchentisch und erfand damit das Rüttelpult. Heute lehnen die Bretter mit den trichterförmigen Aussparungen häufig auch im Eingangsbereich zahlloser Lieblingsitaliener.
Gleichfalls sind sehr viele von ihnen aber auch noch im praktischen Gebrauch. Dabei macht der „Rüttler“ oder auch „Remueur“ gleich drei Dinge auf einmal: Mit einem Ruck löst er das Depot von der Innenwand, dreht dabei die Flasche um ein paar Grad und richtet sie zudem etwas steiler auf. Beidhändig schafft so ein geübter Spezialist gut 8 000 Flaschen pro Stunde. Dennoch dauert es auf diese Art etwa vier Wochen, bis – bei täglichem Rütteln – der Trub am Kronkorken im Flaschenkopf angekommen ist. Seit den 1970er Jahren wird der Job zumeist maschinell ausgeführt. Binnen weniger Tage stellen die sogenannten Gyropaletten Körbe mit 504 Flaschen auf den Kopf. Romantik war früher.
Für das darauffolgende Degorgement gibt es kein deutschsprachiges Äquivalent und Sie wollen die wörtliche Übersetzung auch nicht wirklich wissen. In den allermeisten Fällen wird es „kalt“ und maschinell ausgeführt. Dazu werden die Flaschenköpfe einige Minuten in einem Kältebad eingefroren um das Depot zu binden. Danach können die Flaschen gefahrlos aufgerichtet werden, eine Klinge schlägt den Kronkorken ab und der gefrorene, kompakte Hefepfropf schießt durch den Überdruck hinaus.