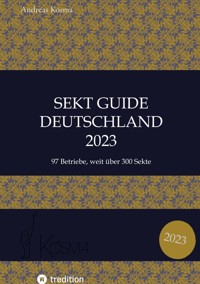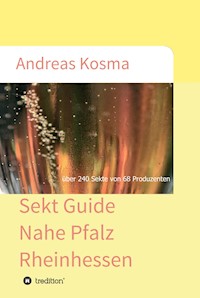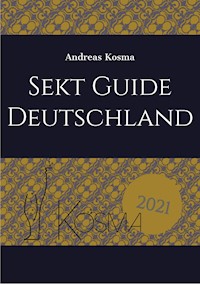
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Sekt Guide
- Sprache: Deutsch
Es schäumt von der Ahr bis nach Südbaden, zwischen Saar und Elbe. Über 100 der besten deutschen Sekterzeugerinnen und Sekterzeuger im Portrait.
Das E-Book Sekt Guide Deutschland wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Deutsch, Deutschland, Sekt, Schaumwein, bester, beste, Winzer, Erzeuger, Betriebe, Guide, Ratgeber
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zur Person:
Im zarten Alter von 5 Jahren hatte Andreas Kosma praktisch schon alles erreicht was in seinem Leben eine tragende Rolle spielen sollte. Fast alles? Nun ja, sagen wir zumindest die grundlegende Voraussetzung war geschaffen. Mit 5 Jahren nämlich war es ihm gelungen seine Eltern dazu zu motivieren aus dem Rheinland in die Pfalz zu ziehen. Und vor allem sie weiterhin in dem Glauben zu lassen, dass es ihre Idee war.
Es folgte der übliche Weg ins Erwachsenwerden: Hoffnungsvolles Talent beim Völkerball in der Grundschule, Romanautor, Messdiener, Zinnsoldatengießer, Asterixleser, Beatles- später Queen- noch später Heavy Metal Fan, Abitur. Heute läuft Mozart beim Sonntagsfrühstück.
Die Kulinarik spielt eine große Rolle in seinem Leben und ist Schwerpunkt seines journalistischen Wirkens. Andreas Kosma hat einen Abschluss als Bachelor of Arts. Seit 1999 hält er Weinseminare, begleitet Start-ups in der Weinbranche, berät Webshops und schreibt für verschiedene Magazine.
Andreas Kosma
Sekt Guide Deutschland 2021
114 Betriebe, nahezu 400 Sekte
© 2022 Andreas Kosma
ISBN Softcover: 978-3-347-55645-4
ISBN Hardcover: 978-3-347-55646-1
ISBN E-Book: 978-3-347-55647-8
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Was ist Sekt?
Die Böden
Die Rebsorten
Der Grundwein
Zweite Gärung und Hefelager
Rütteln und Degorgement
Die Dosage
Klassische Schaumweinstile
Winzersekt geniessen
Was schäumt in den Deutschland?
Wie dieser Guide funktioniert
Die Betriebe
Glossar
Weingüter nach Orten
Vorwort
Schaumwein war in Deutschland schon immer beliebt. Da die Sektherstellung jedoch bis in die 1980er Jahre den Kellereien vorbehalten war, begannen die deutschen Winzerinnen und Winzer erst verhältnismäßig spät mit der Erzeugung eigener Produkte. Inspiriert waren die meisten entweder vom Blick über die Grenze nach Frankreich und/oder ihrem Studium in Geisenheim. Dennoch stagnierte die neue Mode zugunsten der Geiz-ist-geil-Mentalität zum Ende des Jahrtausends. Mit dem Generationswechsel in vielen Betrieben springt der Qualitätsgedanke aber seit einigen Jahren wieder neu an. Wer was auf sich hält, stellt seinem Riesling brut nun auch Sekte aus Burgunder-sorten zur Seite, mit langem Hefelager, geringer Dosage und bevorzugt bio. Nie gab es bei uns so viele und so hochwertige Schaumweine wie heute. Und wenn nun in unseren Köpfen auch noch ankommt, dass es unabhängig von Silvester genauso ploppen darf, ja dann wäre die Sektwelt eigentlich ganz in Ordnung.
Allerdings veränderte die Pandemie das Kauf- und Trinkverhalten auch der Sektfans grundlegend. Der Konsum verlagerte sich stark in den häuslichen Bereich, aber er fand statt. Viele tranken weniger, dafür aber hochwertiger. Und genau darin steckt eine große Chance für unser Lieblingsgetränk. Nämlich die Einsatzmöglichkeiten von Sekt auch über das Begrüßungsglas hinaus kennenzulernen. Ihn als Speisenbegleiter zu entdecken, ganz gleich ob zu zweit oder im vernunftvollen Rahmen einer Einladung. In diesem Sinne darf auch ich Sie nun einladen, und zwar dazu die hochspannende Schaumweinszene in Deutschland zu ergründen.
Mit schäumenden Grüßen,
Andreas Kosma
Was ist Sekt?
Um diese Frage zu klären, muss man sich zunächst mit dem Phänomen auseinandersetzen wie die Bläschen überhaupt in den Wein gelangen. Dazu gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten: Sie wurden zugesetzt, sie stammen aus der ersten oder einer zweiten Gärung des Weines. Das erste Verfahren ist selbsterklärend und es passiert eigentlich nichts anderes als das, was Sie zuhause bei der eigenen Herstellung von Sprudel mittels der CO2 Patrone machen. Hierbei handelt es sich um Perlwein, mit geringerem Kohlensäuredruck, der deshalb auch günstiger versteuert wird.
Grundsätzlich sprechen wir in Deutschland ab einem Druck von 3 bar von Schaumwein, über 3,5 bar von Sekt (= Qualitätsschaumwein). Ab da und bei mehr als 6 % vol Alkohol wird bei uns eine Schaumwein- bzw. Sektsteuer von 1,02 € erhoben. Den Begriff Sekt soll im Übrigen der Schauspieler Ludwig Devrient 1825 geprägt haben. In seinem Stammlokal war seine Leidenschaft für moussierenden Wein offensichtlich bekannt. Angeblich brachte man ihm, nachdem er noch ganz in der Rolle des Falstaff von Shakespeare einen „sack“ * orderte eine weitere Flasche deutschen Schaumweins. Die Bezeichnung Sekt war geboren. *(ursprünglich eine Bezeichnung für Sherry)
Bei der Méthode Rurale (= ländlich) findet bereits die erste Gärung in der Versandflasche statt. Dabei wird noch nicht vollständig vergorener Most in Flaschen gefüllt. Im Verlauf der weiteren Gärung entsteht nun Kohlensäure, die den entsprechenden Druck aufbaut.
Dagegen muss bereits vollständig vergorener Wein durch Hefezusatz eine zweite Gärung durchlaufen um zu sprudeln. Findet diese in einem Drucktank statt, spricht man vom Charmat-Verfahren. Das Hefedepot wird nach 90 Tagen entfernt, der Sekt nach 6 Monaten vermarktet. Die meisten Qualitätsschaumweine unter der Bezeichnung „Sekt hergestellt in Deutschland“ werden auf diese Weise erzeugt. Dabei stammen die Grundweine selbst häufig gar nicht aus deutschen Anbaugebieten.
Schließlich gibt es noch den Unterschied zwischen der Flaschengärung und der… Achtung: Klassischen Flaschengärung. In beiden Fällen gilt eine Mindestherstellungsdauer von neun Monaten. Und natürlich muss auch hier der Flascheninhalt nach der zweiten Vergärung vom Hefedepot befreit werden um ein klares Produkt zu erhalten. Verlässt dieser nun die Flasche, wird umgepumpt, abfiltriert und in neue Flaschen gefüllt, handelt es sich um das kostengünstigere Transvasier-Verfahren. Verbleibt er dagegen in der Versandflasche, wird degorgiert und ggf. dosiert (s. Kapitel Rütteln und Degorgement), sind wir bei der aufwendigsten Herstellungsmethode, der klassischen Flaschengärung angekommen. Dieses Verfahren wurde in der Champagne perfektioniert und findet heute in allen führenden Schaumweingebieten Anwendung. Es liefert eine besonders feine und intensive Perlage. Stammen die Trauben ausschließlich aus Deutschland, heißt das Produkt „Deutscher Sekt“. Bei Eingrenzung auf ein bestimmtes Anbaugebiet für Qualitätswein darf der Zusatz „b.A.“ verwendet werden. Kommt jeder Tropfen, einschließlich der Füll- und Versanddosage vom selben Weingut, sprechen wir vom Winzersekt, der Erzeugerabfüllung sozusagen.
Die Böden
Ein Hauptbestandteil des gewichtigen Begriffs Terroir ist die Bodenart des jeweiligen Weinbergs. Und sicher prägt diese einen Wein deutlicher und nachvollziehbarer als einen Sekt. Dennoch entscheiden viele der führenden Betriebe bereits im Weinberg über ihre Sektgrundweine und nicht erst im Keller.
Zur groben geologischen Orientierung kann zunächst einmal zwischen Skelett- und Feinboden unterschieden werden. Dabei gelten alle Partikel als fein, die kleiner als 2mm sind. Nach absteigender Korngröße wären das: Sand, Schluff und schließlich Ton. Kam der Sand angeflogen, nennt man ihn Löss, sind die drei Anteile vermischt, handelt es sich um Lehm.
Entsprechend wird alles > 2mm dem Bodenskelett zugeordnet. Und genau hier beginnt eine spannende Reise in die unruhige Geschichte unserer Erde. Von der Überholspur betrachtet, und weinbaulich relevant startet diese im Devon vor 400 Millionen Jahren mit der Bildung des Schiefers, über die Perm-Zeit mit ausgeprägtem Vulkanismus aber auch der Ablagerung des Rotliegend. Gleichfalls Sedimente sind die drei beherrschenden Gesteinsarten der nachfolgenden Trias: Zuerst Buntsandstein, später Muschelkalk und obenauf Keuper. Tektonik aber, wie beispielsweise im Oberrheingraben, wirkt sprichwörtlich wie ein Fahrstuhl dieser Geschichte und sorgt für eine bunte Durchmischung der Schichten.
Die Rebsorten
Riesling: Die hochwertigste deutsche Rebsorte liefert fruchtbetonte Sekte mit viel knackiger Säure und großem Aromenspektrum. Er gehört zu den wandlungsfähigsten Sorten weltweit
Sauvignon Blanc: Aromasorte, die an der Loire und in Bordeaux beheimatet ist. Erfreut sich zunehmender Beliebtheit
Scheurebe: Ein Pfälzer Klassiker, gekreuzt aus Riesling & Bukettrebe. Sie zeigt animierende, fruchtig-florale Aromen
Muskateller: Der Oberbegriff für die wahrscheinlich älteste Rebsortenfamilie. Sie ergibt aromatische Weine und Sekte mit mittlerer Säure
Silvaner: Früher viel weiter verbreitet, überrascht mit Eleganz und Straffheit
Spätburgunder/ Pinot Noir: Die Mutter der Pinot-Familie stammt aus dem Burgund und steht für würzig elegante Rotweine. Als Sekt weiß gekeltert ist sie besonders filigran und komplex
Chardonnay: Die Weißwein-Traube aus dem Burgund ist eine Kreuzung aus Pinot Noir & Gouais Blanc. Im Sekt sorgt sie für Kraft plus Säure und kann fantastisch reifen
Weißburgunder: Ist eine komplett helle Mutation des Pinot Noir. Sie wird reinsortig oder in der Cuvée mit Chardonnay verwendet und ergibt cremig-frische Sekte
Schwarzriesling / Pinot Meunier: Mit Pinot Noir und Chardonnay die dritte klassische Rebsorte in der Champagne. Sie bringt Frucht und Balance
Grauburgunder: Die Mutation des Spätburgunders hat roséfarbene Beerenschalen. Die Weine sind oft besonders kraftvoll, im Sekt sorgt er ebenfalls für Opulenz und Schmelz
Der Grundwein
Hauptvoraussetzung für die Vielfalt der Schaumweine ist die Verschiedenartigkeit ihrer Grundweine. Bereits in diesem Stadium steht fest, welche Karriere der fertige Sekt einmal einschlagen wird. Deshalb stehen die Kellermeisterinnen und Kellermeister schon beim Ausbau der „Vins clairs“, wie sie in Frankreich heißen vor einer ganzen Reihe von Wegkreuzungen.
Allen gemeinsam ist der rigoros schonende Umgang mit dem Lesegut. Für die meisten Winzerinnen und Winzer ist selektive Handlese, schonender Transport in kleinen Kisten und Ganztraubenpressung bei geringem Pressdruck eine Selbstverständlichkeit. All diese Maßnahmen dienen der Minimierung von Verletzungen der Beerenschalen. Vor allem hier befinden sich die Phenole, eine riesige Stoffgruppe zu welcher auch die Farbstoffe (Anthocyane) und Gerbstoffe (Tannine) gehören. Die einen würden weißen Most verfärben, die anderen ihn bitter oder aggressiv schmecken lassen, sowie den edlen Schaum destabilisieren. Was beispielsweise gerade bei Rotwein erwünscht ist, sollte beim Keltern von (weißem) Sektgrundwein tunlichst vermieden werden.
Einzellage oder Lagencuvée
Wie beim Qualitätswein gilt natürlich auch beim Schaumwein die Regel: Je genauer die Herkunftsbezeichnung, umso individueller der Lagencharakter. Man kann insofern davon ausgehen, dass ein Sekt mit genauer Nennung der Einzellage eben ihren typischen Charakter spiegeln soll. Inwiefern aber ein außergewöhnlich langer Ausbau auf der Hefe dieser Prägung zuträglich ist, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Zudem kann die Vermählung sehr unterschiedlicher Herkünfte in einer Cuvée durchaus auch bereichernd für die Komplexität sein.
Reinsortig oder Verschnitt
Schöner klingt natürlich Monocépage oder Cuvée. Ganz ähnlich wie bei dem obigen Entscheidungsprozess gilt es auch hier- und das ebenfalls ohne Wertung- zu überlegen auf welcher Eigenschaft der Fokus liegen soll. Ein Sekt aus einer einzelnen Rebsorte rückt deren Typizität in den Vordergrund. Er zeigt ihre charakteristische Aromatik auf und spielt ihre Stärken aus. Beim Riesling sind das häufig die Komponenten Frucht plus Säure. In der Cuvée ergänzen sich die einzelnen Vorzüge. Hier kann beispielsweise die verspielte Komplexität eines Pinot Noir einem druckvollen Chardonnay eine wunderbare Lebendigkeit verleihen. Dabei tritt der einzelne Sortencharakter zugunsten des Gesamteindrucks in den Hintergrund.
Lesezeitpunkt
Nicht alles, was früh gelesen wird ist dünn und sauer. Und nicht alles, was physiologisch reif ist ergibt plumpe, langweilige Sekte. Hier liegt der Königsweg in der Mitte. Natürlich legt der Grundwein während der zweiten Gärung nochmals etwa 1,5 % vol an Alkohol zu, was ihm mehr Fülle verleiht. Diese Tatsache müssen die Winzerinnen und Winzer vor der Versektung auf dem Schirm haben. Deshalb handelt es sich hierbei in der Regel um schlanke, säurebetonte Weine, die durchaus ein paar Tage früher gelesen wurden. Wie schlank tatsächlich, hängt von dem gewünschten Resultat ab. Aber niemand wird wohl ernsthaft einen Grauburgunder mit bereits 14 % vol zu einem Sekt weiterverarbeiten.
Malolaktische Gärung
Je nach Stil durchlaufen viele Weine die „Malo“. Dabei handelt es sich um die Umwandlung der zupackenden Äpfelsäure in die mildere Milchsäure. Dieser Vorgang wird zumeist biologischer Säureabbau (BSA) genannt, weil er von Milchsäurebakterien durchgeführt wird. Bei Rotweinen findet er in aller Regel, bei den weißen Burgundersorten häufig statt. Für Rieslingweine ist er eher selten, weil hier die belebende Säure durchaus erwünscht ist. Ein fertiger Sekt, bei dem der Grundwein keine Malo durchlaufen hat, wirkt zumeist frischer und fruchtbetonter. Ein Schaumwein mit BSA kommt häufig im ersten Moment weniger rassig daher, schmeckt aber komplex und entwickelt sich oft interessanter.
Holz oder nicht Holz
Und wenn, was für ein Holz? „Großes Gebrauchtes oder kleines Neues“ um im Fachjargon zu bleiben. Aber fangen wir doch einfach mal ganz ohne an. Fortgeschrittene Weintrinkerinnen und Weintrinker kennen bereits den Unterschied zwischen den auf Primärfrucht getrimmten, zumeist im Edelstahl ausgebauten Vertretern und den Barriqueweinen mit ihrer typischen Röstaromatik. Alles zu seiner Zeit. Und dazwischen gibt es natürlich jede Menge weiterer Abstufungen. Grob gilt: Je größer und älter das Fass, umso weniger macht sich die Holznote bemerkbar. Trotzdem findet auch hier eine Oxidation, also weitere Reifung statt, die dem Wein eine zusätzliche Dimension verleiht. Beim späteren Sekt ist das nicht anders. Es kann also entweder die frische Fruchtigkeit oder eben ein Tick Würze erwünscht sein.
Zweite Gärung und Hefelager
Egal ob erste oder zweite Gärung: Hefen verstoffwechseln Zucker zu Alkohol und es entsteht Kohlendioxid. Da dieses nicht entweichen kann, verbindet es sich mit der Flüssigkeit zu Kohlensäure. Dabei spielen sowohl der Druck als auch die Temperatur gewichtige Rollen.
Und diese zweite Gärung in der Verkaufsflasche ist es, die das Herstellungsverfahren als „klassische“ Methode definiert. Dazu braucht es im Wesentlichen drei Dinge: Hefe, Zucker und bruchsichere Flaschen. 12-14 bar halten heutige Sektflaschen aus, gut 6 bar werden während des Herstellungsprozesses erreicht. Damit sind auch die Fragen nach den dicken Flaschenwänden und dem nach innen gewölbten Böden hinreichend beantwortet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie auch kein zweites Mal benutzt werden, außer als Trophäen auf dem Bücherregal oder Kerzenständer.
Um diesen enormen Druck zunächst aber erst einmal aufzubauen brauchen die Hefen Futter in Form von Saccharose. Der durchgegorene Grundwein wird also mit Fülldosage, dem Liqueur de tirage versetzt. Dieser besteht natürlich aus den Hefen, etwa 20- 24 g Zucker für den gewünschten Druck und zumeist einer sogenannten Rüttelhilfe. Häufig handelt es sich hierbei um Bentonit, welches bewirkt, dass sich das Depot später besser von der Flaschenwand löst.
Nachdem nun die Flaschen mit Kronkorken verschlossen wurden geht es zur Lagerung erneut in den Keller. Dabei fackeln die Hefen nicht lange, sondern beginnen sofort mit ihrem Stoffwechsel. Bereits nach drei bis vier Wochen sind die 6 bar erreicht und ab da heißt es warten. Insgesamt mindestens 9 Monate Lagerzeit sind verpflichtend für einen Winzersekt, 15 Monate sind es bei Champagner. Bei beiden Produkten ruhen die Spitzenqualitäten um ein Vielfaches länger. Ein Vorstoß in diese Richtung ist das VDP.SEKT.STATUT vom Sommer 2018. Hierbei haben die Mitgliedsbetriebe eine Mindestlagerzeit von 15 Monaten für die sogenannten Guts- und Ortssekte, sowie 36 Monate für Lagensekte beschlossen.
Während dieser Zeit ruhen die Flaschen zumeist in Gitterboxen bzw. früher akkurat geschichtet und teilweise mit dünnen Holzleisten justiert. Davon kommt der französische Ausdruck „sur lattes“. Durch die längere Lagerzeit verbindet sich die Kohlensäure besser mit der Flüssigkeit und es entsteht eine feinere Perlage. Nachdem die Hefen den gesamten zur Verfügung stehenden Zucker verstoffwechselt haben sterben sie ab und werden enzymatisch aufgelöst. Dieser Prozess nennt sich auch Autolyse und sorgt im Sekt für die typischen Noten nach Buttergebäck bzw. Brioche. Echte Alterungsvorgänge sind während des Hefelagers übrigens zu vernachlässigen. Kronkorken und die Hefen selbst wirken der Oxidation entgegen.
Rütteln und Degorgement
Nach der monate- oft sogar jahrelangen Auszeit in Seitenlage haben sich die abgestorbenen Hefezellen an den Unterseiten der Flaschen abgelagert. Der Begriff Depot erklärt die diffuse Konsistenz, welche bis auf die Farbe an den Bodensatz in einer Teekanne erinnert. Ein in dieser Form getrübter Schaumwein ließ sich natürlich nicht gut verkaufen, deshalb musste ein Weg gefunden werden das Hefedepot in Gänze zu entfernen.
Zeitweise wurden dazu die Flaschen kopfüber in den Sand gesteckt, was den Trub zunächst in Richtung Flaschenhals absinken ließ. Für die Abkehr von diesem mühseligen Verfahren sorgte zu Beginn des 19. Jahrhunderts offensichtlich die Witwe Clicquot-Ponsardin. Angeblich durchlöcherte sie gemeinsam mit ihrem Kellermeister den Küchentisch und erfand damit das Rüttelpult. Heute lehnen die Bretter mit den trichterförmigen Aussparungen häufig auch im Eingangsbereich zahlloser Lieblingsitaliener.
Gleichfalls sind sehr viele von ihnen aber auch noch im praktischen Gebrauch. Dabei geschehen während es Rüttelns gleich drei Dinge auf einmal: Mit einem Ruck wird das Depot von der Innenwand gelöst, die Flasche um ein paar Grad gedreht, und gleichzeitig aufgerichtet. Beidhändig schafft so eine geübte Spezialistin oder Spezialist gut 8 000 Flaschen pro Stunde. Dennoch dauert es auf diese Art etwa vier Wochen, bis – bei täglichem Rütteln – der Trub am Kronkorken im Flaschenkopf angekommen ist. Seit den 1970er Jahren wird der Job zumeist maschinell ausgeführt. Binnen weniger Tage stellen die sogenannten Gyropaletten Körbe mit 504 Flaschen auf den Kopf. Romantik war früher.
Für das darauffolgende Degorgement gibt es kein deutschsprachiges Äquivalent und Sie wollen die wörtliche Übersetzung auch nicht wirklich wissen. In den allermeisten Fällen wird es „kalt“ und maschinell ausgeführt. Dazu werden die Flaschenköpfe einige Minuten in einem Kältebad eingefroren um das Depot zu binden. Danach können die Flaschen gefahrlos aufgerichtet werden, eine Klinge schlägt den Kronkorken ab und der gefrorene, kompakte Hefepfropf schießt durch den Überdruck hinaus.
Es erfordert lange Übung und absolute Perfektion diesen Vorgang manuell durchzuführen. Mit einem Degorgierhaken wird die Flasche mit der einen Hand geöffnet während sie mit dem Daumen der anderen sofort nach dem Austritt der Hefe abgedichtet werden muss. Wenige Geübte beherrschen diesen Akt auch ohne das vorherige Eisbad. Insofern kommt es bei diesem „warmen“ Degorgement auf extremes Fingerspitzengefühl und perfektes Timing an.
Die Dosage
Sie besteht aus Süßreserve, Wein oder selten sogar Weinbrand mit Zucker und war häufig ein streng gehütetes Geheimnis: Die Versanddosage oder auch Liqueur d’expedition.
Nach Entfernung der Hefe ist der Sekt absolut trocken. Zudem ist ein Teil des Flascheninhalts verloren gegangen. Die Dosage löst diese Situation. Zum einen dient sie der geschmacklichen Abrundung des Schaumweins, zum anderen gleicht sie verloren gegangenes Volumen aus. Wird der Füllstand mit dem gleichen Produkt aus einer anderen Flasche angehoben sprechen wir von der Geschmacksrichtung pas dosé, zéro dosage oder brut nature. Kommt die Dosage zum Einsatz, so entstehen aufsteigend nach dem Restzuckergehalt folgende Geschmacksangaben:
Brut nature, naturherb
> 3 g/l
Extra brut, extra herb
0 – 6 g/l
Brut, herb
> 12 g/l
Extra dry, extra trocken
12 – 17 g/l
Dry, trocken, sec
17 – 32 g/l
Demi-sec, medium dry, halbtrocken
32 – 50 g/l
Sweet, doux, mild
< 50 g/l
Grundsätzlich wird eine Toleranz von 3 g/l eingeräumt. Der Gesamtalkohol darf durch die Dosage um nicht mehr als 0,5 % erhöht werden.
Danach wird die Flasche mit dem typischen pilzförmigen Korken verschlossen. Dieser wird mittels eines Drahtkörbchens, der Agraffe, fixiert. Dazwischen befindet sich ein Metalldeckel, der in Frankreich Capsule oder Plaque de Muselet genannt wird. Eine anschließende vorsichtige Kippung dient der Durchmischung des Ganzen, fertig ist der Sekt.
Wussten Sie übrigens, dass die Folienkapsel um den Flaschenhals in früheren Zeiten dazu diente die unterschiedlichen Füllstände zu kaschieren? Das ist bei der heutigen maschinellen Fertigung natürlich nicht mehr notwendig. Aufgrund des hohen Drucks verbleibt aber zur Sicherheit dennoch eine größere Menge Luft im Flaschenhals als es bei Stillweinen der Fall ist.
Klassische Schaumweinstile
Sekte aus einer Rebsorte
Genau wie beim Deutschen Qualitätswein, so müssen auch Sekte zu mindestens 85% aus der auf dem Etikett genannten Sorte bestehen. Dieser Typus stellt den individuellen Charakter einer bestimmten Rebsorte in den Vordergrund. Von Riesling ist demnach Säure, Frucht und Eleganz zu erwarten, von Traminer dagegen Exotik und Aromatik.
Jahrgangssekte
Hier sind es paradoxerweise oft die „kleineren“ Jahrgänge mit schlankeren Weinen die einen besonders komplexen und interessanten Sekt ergeben.
Blanc de Blancs
Weißer Schaumwein ausschließlich aus weißen Trauben. Diese zugegebenermaßen etwas verwirrende Bezeichnung stammt aus der Champagne. Dort handelt es sich zumeist um einen reinsortigen Chardonnay. Vom Stil her steht Blanc de Blancs für kraftvolle, mineralische Schaumweine mit reichlich Säure. Holzausbau ist häufig, aber nicht unbedingt notwendig. Großzügig interpretiert dürfen theoretisch sämtliche Weißweintrauben hinein.
Pinot
Unter dieser verhältnismäßig neuen und eher in Deutschland benutzten Bezeichnung segelt alles, was im internationalen Sprachgebrauch mit Vornamen Pinot heißt. Ein Verhältnis von roten zu weißen Rebsorten ist nicht festgelegt. Trotz Familienzugehörigkeit darf der Chardonnay hier aber nicht mitspielen, der Schwarzriesling als (Pinot) Meunier dagegen schon.
Blanc de Noirs
Weiß gekelterter Schaumwein aus dunklen Trauben ist ebenfalls eine Stilbezeichnung aus der Champagne. Sie entstehen, wenn die unversehrten Rotweintrauben schonend gepresst werden und der Most keinen weiteren Kontakt zu den Schalen hatte. Blancs de Noirs zeichnen sich durch ihre nuanciert fruchtige Art und enorm hohe Komplexität aus.
Rosé
Nach einer gewissen Kontaktzeit gehen die Farbstoffe aus den Beerenschalen in den Most über. Ist die gewünschte Farbtönung erreicht, müssen die beiden Bestandteile getrennt werden. Seltener sind die sogenannten Rosé d’Assemblage. Hier wird dem weißen Grundwein direkt etwas Rotwein zugegeben. Rosé-Sekte wollen in der Regel durch ihre primären Fruchtaromen bestechen, die häufig an Beeren erinnern. Es gibt aber auch zunehmend charaktervolle Gewächse mit Holzausbau und langem Hefelager.
Winzersekt genießen
Trinkreife
Eigentlich kommen Schaumweine im besten Alter auf den Markt. Denn eigentlich entscheiden die Winzerinnen und Winzer in welcher Form sie ihre Sekte auf die Kunden loslassen. Das gesetzliche Mindestalter liegt bei 9 Monaten. Diese recht leicht zu merkende Zeitspanne liefert jugendlich-fruchtbetonte Sprudler. In den meisten Fällen wird diese Frist aber deutlich überschritten, nicht selten um mehrere Jahre. Das Ergebnis sind Prestigesekte mit einem völlig anderen Aromenspektrum und natürlich Anspruch. Wem Sie den Vorzug geben hängt neben dem Geldbeutel selbstverständlich auch von den persönlichen Vorlieben, der Kennerschaft und dem Anlass ab. Anhängerinnen und Anhänger reiferer Geschmackseindrücke lagern die Schaumweine nach dem Degorgement auch ganz bewusst. Allerdings sind diese dann nicht mehr so hermetisch verschlossen und es fehlt vor allem die antioxidative Wirkung der Hefen. Fruchtige Noten beginnen in den Hintergrund zu treten, der Kohlensäuredruck lässt (langsam!) nach, wir sprechen von Flaschenreife. Häufig lohnt sogar das Öffnen der Flasche einige Stunden vor dem Genuss. In diesem Fall hilft eine gewisse Glasreife dem Sekt bei der Entfaltung. Letzten Endes ist es also wie bei Käse, Autos oder Menschen- persönliche Geschmackssache!
(Sekt)Gläser
Ähnlich wie ein geeignetes Weinglas sollte auch ein Sektglas folgende Eigenschaften haben: Einen guten Stand, einen Stiel, davon eine stabile Verbindung zur bauchigen Kuppa die sich nach oben hin verjüngt und eine geringe Wandstärke. Über das Ausmaß dieser Attribute entscheidet wie so oft in diesem Kapitel der Geschmack bzw. Anlass. Sehr schön wirkt eine angeraute Stelle in der Kelchmitte. Am sogenannten Moussierpunkt sammeln sich die Bläschen und steigen wie an einer Perlenkette zur Oberfläche. Generell ist für einfachere, fruchtigere Schaumweine auch ein etwas schlankeres Glas zu empfehlen. Entwickelte und komplexe Vertreter kommen oft sogar in einem voluminösen Weinglas besser zur Geltung. Ich empfehle Ihnen an der Stelle einmal Folgendes: Tragen Sie alle unterschiedlichen Gläser zusammen die Sie in Ihrer Vitrine auftreiben können. Verkosten Sie daraus dann Ihren aktuellen Lieblingsschäumer. Sie werden über die Unterschiede in der Wahrnehmung erstaunt sein.
Trinktemperatur
Je kälter der Glasinhalt ist, umso frischer und belebender wird er empfunden. Bei ein paar Grad mehr entfalten sich die Aromen komplexer und intensiver. Als grobe Orientierung gilt:
4-6°C
Restsüße Schaumweine und Bankettqualitäten
6-8°C
Einfachere, fruchtbetonte Sekte, z. B. frischer Riesling oder Rosé brut
8-10°C
Gehobene Qualitäten mit längerem Hefelager
10-12°C
Besonders komplexe oder gereifte Spezialitäten
Anlass
Die Marktzahlen beweisen es jedes Jahr aufs Neue: Der meiste Sekt wird bei uns kurz vor den Feiertagen zum Jahresende gekauft und in aller Regel auch getrunken. Und über das Jahr verteilt sind es Hochzeiten, Sektempfänge oder Rendezvous, die den Absatz ankurbeln. Für all diese Gelegenheiten bieten die deutschen Winzerinnen und Winzer hervorragende Schaumweine an. Aber wie sieht es mit der Speisenbegleitung aus? Anders als beispielsweise in Frankreich, hat sich hier die Idee, dass Sekt auch ein ganzes Menü begleiten kann noch nicht in vollem Maße durchgesetzt. Deshalb möchte ich es auf keinen Fall versäumen, Ihnen die eine oder andere Kombination schmackhaft zu machen:
Kalte Vorspeisen
Gemüse benötigt oft etwas „neutralere“ Begleitungen wie sanften Weißburgunder oder Silvaner. Zu Fisch passt Riesling, gerne mit etwas längerem Hefelager oder ein frischer Blanc de Blancs. Ein Blanc de Noirs oder Rosé schmeckt hervorragend zu Terrinen und Fleischpasteten.
Fisch und Meeresfrüchte
Je nach Zubereitungsart (gedämpft – gegrillt) und Beilagen kann die ganze Palette der Schaumweine gespielt werden. Riesling und Süßwasserfisch geben oft ein schönes Paar ab. Zu gehaltvollem Lachs oder Garnelen dürfen weiße Burgundersorten mit einem Tick Holz ran.
Fleisch
Auch hier lassen die Art und die Zubereitung viele Kombinationsmöglichkeiten zu. In der Regel empfehlen sich zupackende Rosés zu Kurzgebratenem und gereifte Pinots oder Rosé mit Holzausbau zu geschmortem Fleisch. Geflügel und Weißburgunder mögen sich.
Käse und Dessert
Vor allem Weichkäse und Schaumwein ziehen sich an. Probieren Sie unbedingt Riesling zu Ziegenkäse. Süße Desserts sind etwas kniffliger aber mit der Liebeshochzeit aus (süßem) Muskateller und (Erd-)Beeren ist der Genuss vorprogrammiert.
Was schäumt in Deutschland?
Ohne Zweifel spielt der Riesling in Deutschland, neben den auch international am häufigsten verwendeten Burgundersorten, immer noch eine Hauptrolle. Dabei fällt den Winzerinnen und Winzern in den nördlich gelegenen Anbaugebieten dieser Zugang naturgemäß etwas leichter. Riesling-Magier wie Thorsten Melsheimer oder Markus Molitor erzeugen stolz entwickelte und hochkomplexe Sekte aus besten Lagen an der Mosel. Aber auch die puristischen Rieslinge von Frank John oder Odinstal, die expressiven Interpretationen von Niko Brandner und natürlich die grandiosen Nahe-Botschafter von Caroline Diel gehören zum Besten was aus dieser Rebsorte schäumen kann. Schloss Sommerhausen oder das Juliusspital zeigen, dass auch Franken Spitzenriesling kann. Und selbst der Burgunder-Flüsterer Volker Raumland zieht einen 2008er aus dem Hut und punktet ganz oben mit.
Dennoch gilt das Hauptaugenmerk den Burgundern Hier herrscht im Übrigen momentan auch die meiste Dynamik. Zusätzlich zur Vielzahl der Stile und Möglichkeiten fällt es allerdings noch schwerer die absoluten Highlights zu benennen. Allzu hochwertig ist das Topsegment und die Spitzengruppe liegt dicht beieinander. In der Schublade Blanc de Blancs/Chardonnay zählen aber sicher Raumland, Griesel, Franz Keller, Schloss Sommerhausen, ebenso wie das superbe Jahrgangsdouble von H.O. Spanier, der Tirus von Daniel Wagner sowie die pikanten Rheingauer Chardonnays von Chat Sauvage und Gunter Künstler zu den Siegern. Die Königsklasse, Cuvées aus roten und weißen Sorten besteht aus der unvergleichlichen Vertikale von Aldinger brut nature, dem Monument MonRose von Raumland, dem geschliffenen „pure“ von Stefan Winter und der Klassikerin Cuvée MO von Caroline Diel. Mit Ausnahme des MonRose extra brut sind allesamt brut nature. In seiner Paradedisziplin Blanc de Noirs belegt Volker Raumland mit der Cuvée Katharina, der Grande Réserve und dem neuen Kirchenstück gleich drei der Spitzenplätze. Aber auch die Sektkellerei Reinecker bietet einen spannenden Flight hervorragender Lagensekte vom Spätburgunder. Ebenfalls aus Baden, die Shelter Winery, sowie Jochen Dreissigacker und Marc Weinreich aus Rheinhessen seien in dieser Kategorie noch erwähnt. Beim Rosé sichert sich Niko Brandner für Griesel den Spitzenplatz vor der Kreation Aldinger Wöhrwag, sowie dem starken Pfalztrio: Margrit von Bassermann-Jordan, Pinot Rosé von Steffen und Andreas Rings, sowie Pinot Noir Rosé von Vincent Eymann, Gratulation!
Sektvielfalt in Deutschland bedeutet aber auch das Festhalten an weiteren Rebsorten, zum Teil als regionale Spezialitäten. Angelina und Kilian Franzen trutzen dem steilen Calmont einen bemerkenswerten Elbling-Sekt ab. Und was wäre der Main ohne Silvaner? Ausgerechnet der Teilzeitfranke Markus Heid erzeugt gemeinsam mit Lukas Herrmann einen wahnsinnig zupackenden Sekt aus Silvaner. Mit Mut zu mehr Aroma bereichern die Pfälzer Andres & Mugler, Philipp Kuhn sowie Regine Minges und ihren zum Teil staubtrockenen Muskatellern die Geschmackspalette. Gewagt und gewonnen hat auch der Wilhelmshof mit sogar einer animierenden fruchtsüßen Version der Aromarebe.
Die Sekte in diesem Guide stammen tatsächlich aus allen 13 Anbaugebieten für Qualitätswein. Von daher ist es besonders erfreulich, dass auch in den flächenmäßig kleineren Regionen bzw. den einzelnen Bereichen hochwertige Sekte erzeugt werden. Die Philipps-Mühle am Mittelrhein, Martin Schwarz in Sachsen, Alexander Stodden an der Ahr, Reverchon an der Saar und natürlich das Sekthaus Griesel an der Hessischen Bergstraße steigern das Qualitätsniveau auch abseits von Rheingau & Co. ganz beachtlich.