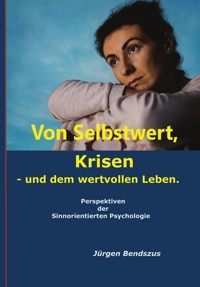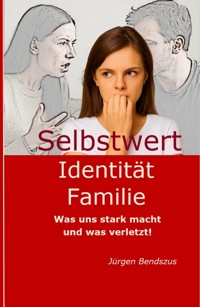
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Das Selbstwertgefühl zeigt an, wie wir unsere Persönlichkeit, Stellung in der Gesellschaft und Zukunft bewerten: Ob wir uns zuversichtlich auf der Sonnenseite des Lebens erfahren - oder unsicher und bedeutungslos am Rande mit wenig Einfluss. Der Selbstwert und die Identität sind das Fundament der Persönlichkeit und ein aktiver Player. Ihre Stärke beeinflusst, wie Kinder und Jugendliche ihre Herausforderungen bewältigen und wie glücklich ihre Zukunft verlaufen wird. Eine unsichere Identität macht junge Menschen manipulierbar durch verführerische Influenzer mit schädlichen Leit- und Weltbildern. Warum ist die Entwicklung von Selbstwert und Identität für viele so schwer? Weil Jugendliche und Erwachsene empfindlich auf Krisen, zerbrechende Familienbeziehungen, Orientierungslosigkeit und das Wegschmelzen der Werte reagieren. Themen im Buch: - Ursprung und Säulen von Selbstwert und Identität und die Bedeutung der Eltern - Psychisch kranke Eltern: Wie entwickeln sich ihre Kinder? - Emotionale Entwicklung in Trennungsfamilien - Psychologie der Liebe und des Trennungsprozesses - Identitätskrisen bei Jugendlichen und die Dominanz von Gefühl, Sexualität und Körper bei der Identitätsbildung - Aktuelle Befunde aus der Forschung - Lebensnah mit vielen Fallbeispielen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titel
Impressum
Inhalt
0. Einführung: Identität und Chaos
1. Selbstwert: Schlüssel zum Glück
1.1. Selbstwertgefühl im Spiel des Lebens
1.2. Säulen des Selbstwertgefühls
1.3. Das Selbst als Steuerungsfunktion
2. Kindheit und Selbstwert
2.1. Urvertrauen
2.2. Geburt des Selbst
2.3. Leistungsmotiv und Selbstwert
2.4. Den Willen stärken
2.5. Was Kinder schwächt
3. Psychisch kranke Mütter
3.1. Depressive Mütter: Wie sie erziehen
3.2. Verbreitung von Depressionen
3.3. Erlebnisse der Kinder
4. Emotionale Entwicklung der Kinder
4.1. Still face experiment
4.2. Depressionen im System Familie
4.3. Mutter-Kind-Interaktion
4.4. Depressive Mütter und ihr Weltbild
4.5. Erziehungskompetenz depressiver Mütter
4.6. Paarbeziehung bei Depressionen
4.7. Parentifizierung
4.8. Tabus und Kommunikation
4.9. Forschungsbefunde
4.10. Zukunftsperspektiven. Fallbeispiel aus der Therapie
4.11. Gesellschaft und Ressourcen
5. Trennungsfamilien: Wie geht es den Kindern?
5.1. Was Kinder und Jugendliche erleben
5.2. Kampf um Liebe
5.3. Wenn ein Elternteil fehlt ...
5.4. Forschungsbefunde
6. Eltern: Psychologie der Liebe und Trennung
6.1. Bedürfnisse und Sehnsüchte
6.2. Enttäuschungen und Kränkungen
6.3. Selbstwert, Identität in der Trennungsphase
6.4. Phasen des Trennungsprozesses
7. Identität und Identitätskrisen
7.1. Identitätskrisen als Phänomen unserer Zeit
7.2. Das soziale Vorstellungsschema
7.3. J. Rousseau, der neue Mensch und Sinn der Gefühle
7.4. S. Freud und die Sexualisierung der Gesellschaft
7.5. Sexualität im Kleinkindalter
7.6. Identität, Körper, Sexualität bei Heranwachsenden
7.7. Fallbeispiel: Misslungene Transitionsbehandlung
Literatur und Quellen
Der Autor
Jürgen Bendszus
Selbstwert - Identität - Familie.
Was uns stark macht und was verletzt!
2., überarbeitete Auflage
© Copyright 2025 Hans-Jürgen Bendszus
Die 1. Auflage (2019) erschien unter dem Titel:
„Selbstwert und Beziehung. Quellen unserer Selbstachtung und was sie verletzt.“
Covergestaltung: H.-J. Bendszus. Bildquelle Cover: pixabuy
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist mit allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeisung, Verarbeitung und Verbreitung in elektronischen Systemen. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Impressum:
Hans-Jürgen Bendszus Publishing,
Egon-von-Romberg-Weg 80,
49082 Osnabrück, Deutschland
Email: rat.und.hilfe[at]gelingendesleben.de
Inhalt
Einführung:Auf der Suche nach Identität im Chaos der Gegenwart
1. Das Selbstwertgefühl als Schlüssel zum Glück
- Das Selbstwertgefühl als aktiver Player im Spiel des Lebens
- Vier Säulen des guten Selbstwertgefühls
- Das Selbst als Steuerungsfunktion der Persönlichkeit
2. Kindheit und die Anfänge des Selbstwertgefühls
- Urvertrauen
- Die Geburt des Selbst und Selbstwertgefühls
- Das Leistungsmotiv: Selbstwert gewinnen durch Kompetenz
- den Willen stärken
- Was Kinder schwächt und entmutigt
3. Psychisch kranke Mütter: Was erleben ihre Kinder?
- Depressive Mütter und wie sie erziehen
- Verbreitung depressiver Symptomatik
- Was erleben Kinder depressiver Eltern
4. Depressive Eltern: die emotionale Entwicklung ihrer KinderBefunde der Forschung
- „Still Face Experiment“
- Wie beeinflusst mütterliche Depressivität die seelische Gesundheit des Kindes?
- Depressivität und Mutter-Kind-Interaktion
- Einfluss des „Weltbilds“ depressiver Mütter
- Erziehungskompetenz depressiver Mütter
- Depressivität und die elterliche Paarbeziehung
- Parentifizierung
- Tabus und unfreie Kommunikation
- Empirische Forschungsbefunde
- Zukunftsperspektiven der Kinder
- Gesellschaft und Ressourcen
5. Erlebnisse und emotionale Entwicklung der Kinder aus
- Was Kinder und Jugendliche erleben
- Der Kampf der Eltern um die Liebe des Kindes
- Die Rolle von Vater und Mutter: Wenn ein Elternteil fehlt
- Empirische Befunde zur emotionalen Entwicklung von Trennungskindern
6. Die Eltern - und Paarbeziehung im Trennungsprozess
- Bedürfnisse und Sehnsüchte
- Enttäuschungen und Kränkungen
- Selbstwert und Identität in der Trennungsphase
- Phasen des Trennungsprozesses
7. Identitätskrisen und die Dominanz von Gefühl Sexualität und Körper bei der Identitätsbildung
- Identitätskrisen als Phänomen unserer Zeit
- Das soziale Vorstellungsschema: die geistige Tiefenstruktur der Gesellschaft
- Der Schrittmacher für den psychologischen Menschen: Jean J. Rousseau
- Sigmund Freud und die Sexualisierung der Gesellschaft
- Sexualität im Kleinkindalter
- Identität, Sexualität und Körper bei Heranwachsenden
- Fallbeispiel: Das Mädchen Chloe Cole und ihre leidvolle Transitionsbehandlung
Quellen und Literatur
Über den Autor
Einführung:
Auf der Suche nach Identität im Chaos der Gegenwart
Im Spiel des Lebens verhält sich das Selbstgefühl wie ein Seismograph. Es ist die emotionale Komponente der Identität und zeigt an, wie Menschen ihre Persönlichkeit und ihr Leben erleben und bewerten.
Manchen fällt scheinbar alles Glück zu: Wohlstand, viele gute Beziehungen, Anerkennung im Beruf und die Erfüllung in der Partnerschaft und Liebe. Andere dagegen haben nach ihrem Gefühl zu wenig davon - zu wenig gesellschaftlichen Status, zu wenige gute Freunde, zu wenig Erfolg am Arbeitsplatz und keine Familie. Im Selbstwertgefühl und der Identität spiegelt sich dieses alles wider. Im Identitätsgefühl schlägt sich die ganze Lebensgeschichte eines Menschen nieder, auch die Bewertung seiner körperlichen und seelischen Kräfte, seine erlebte Stellung in der Gesellschaft. Ja, das Gefühl des Selbstwerts und der Identität ist Ausdruck davon, wie ein Mensch seine Stellung im Leben schlechthin bewertet und wie sicher er sich in der Welt fühlt.
Wir können annehmen, dass sich die Selbstwert- und Identitätsproblematik bei jungen Menschen in den letzten Jahren deshalb so verschärft hat, weil die Heranwachsenden ein feines Gespür dafür haben, was unsere Gesellschaft bewegt. Unsere Gesellschaft lebt im Krisenmodus. Wir leben in einer chaotischen Welt, wo im privaten Leben der persönlichen Beziehungen und der Familie wie auch im sozialen und politischen Makrokosmos alte Sicherheiten, soziale Strukturen und unsere Werte bedroht sind oder zerbrechen. Zugleich ist der berufliche und soziale Leistungs- und Anpassungsdruck hoch. Viele fühlen sich überfordert. Diese sozialen Unsicherheiten verstärken die schon in der jugendlichen Persönlichkeit angelegten Unsicherheiten und Angstbereitschaft.
Wir sehen, welchen Erfolg diejenigen Influencer auf Social Media bei Heranwachsenden haben, die Lebensstile, Werte und Schönheits- und Körperideale zur Selbstoptimierung und Erlangung von mehr Selbstwert präsentieren. Daraus können wir schließen, dass so viele Jugendliche ihnen folgen, weil sie sich durch diese Vorbilder Lebensmodelle für die Bewältigung ihrer Selbstzweifel und unsicheren Identität erhoffen.
Vielleicht sind die Unsicherheiten bei jungen Männern noch größer als bei Frauen. Denn viele männliche Heranwachsende können mit dem zunehmenden schulischen und beruflichen Erfolg der Frauen und ihrer wachsenden Autonomie im privaten Beziehungsleben schlecht umgehen. Wie können sie also Stärke und Identität zum Ausdruck bringen? Für manche ist der eigene Körper der Raum, in dem sie noch etwas gestalten und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen können: durch Tattoos, Piercings, Bodybuilding oder Härte- und Überlebenstraining im Wald, angeleitet durch „Männlichkeits-Coaches“. Kritisch für die Gesellschaft wird es aber, wenn diese selbstunsicheren Männer Politiker anziehend finden, die auf Social Media solche Sätze aussprechen wie: „Echte Männer sind rechts. Dann klappt´s auch mit der Freundin.“ Die gesellschaftliche Relevanz unserer Thematik ist also offensichtlich.
Doch auch unsichere junge Frauen laufen Gefahr, manipuliert zu werden, wenn sie ihr ganzes Geld für „Beauty“ und „Lifestyle“ ausgeben, wenn sie horrende Summen für Schönheitschirurgen zahlen. Manche haben davon gehört, dass man Gefühle von Selbstentfremdung und „im falschen Geschlecht zu leben“ überwinden kann und zur „wahren“ authentischen Identität durch medizinische Maßnahmen gelangen kann. Das kann zu Versuchen führen, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Im letzten Kapitel habe ich diese Thematik mit einem klinischen Fallbeispiel näher beleuchtet und gezeigt, wie verhängnisvoll eine solche Entscheidung sein kann.
Für viele jungen Frauen ist aber ein Thema viel drängender, das symptomatisch für die gegenwärtige Bedeutung der Selbstwert- und Identitätsproblematik ist: Essstörungen. Hunderttausende leiden daran. Laut dem Statistische Bundesamt hat sich die Zahl der stationären Behandlungen der 10- bis 17-jährigen Patientinnen von 2003 bis 2023 verdoppelt. Im Jahr 2023 wurden mit dieser Diagnose hierzulande 12100 Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 93 Prozent Frauen. Das Gefühl, den gesellschaftlichen Körperidealen nicht zu genügen, das für junge Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl besonders quälend ist, spielt bei Essstörungen immer eine große Rolle.
Es sind die eher ängstlichen Jugendlichen, die in ihrer Herkunftsfamilie keine ausreichende Resilienz erwerben und keine identitätsstiftenden Werte entwickeln konnten, die sich von verführerischen „Lifestyle-Influencern“ oder politischen Influencern mit einem einfachen, Ordnung und Sicherheit versprechen Gesellschaftsbild leichter manipulieren lassen können.
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Kosten für diese Tendenzen können noch höher werden als sie jetzt schon sind. Daher ist es wichtig, dass die Familie und ihre Bedeutung für die Entwicklung des kindlichen Selbstwerts und der Identität in der öffentlichen Wahrnehmung einen hohen Stellenwert haben. Wir alle wissen, dass in der Familie die Weichen für die Zukunft eines Menschen gestellt werden. Das seelische Wohlbefinden im Erwachsenenalter, die Verwirklichung der eigenen Visionen vom glücklichen Leben oder auch das private und berufliche Scheitern werden durch die Beziehungserfahrungen in den ersten Lebensjahren entscheidend beeinflusst.
Dabei spielt das Selbstwertgefühl eine wichtige Rolle. Seine Stärke im gesamten Lebenslauf hängt von den Familienerfahrungen des Kindes in seinen ersten Lebensjahren entscheidend ab. Es zeigt nicht nur wie ein Seismograph an, ob wir uns auf der Sonnenseite oder Schattenseite des Lebens stehend erleben. Wie die intuitive Erfahrung, aber auch die empirische Forschung zeigen, ist es auch ein aktiver Resilienzfaktor, der hilft, die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen.
In diesem Buch versuche ich, die Phänomene Selbstwert und Identität in ihrer Entwicklung, Struktur und den sie beeinflussenden Kräften zu beschreiben. Wenn wir ein vertieftes Verständnis von ihren Quellen haben, wissen wir genau, was unsere Kinder für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit brauchen. Dieses Wissen hilft auch, dass wir als Erwachsenen für uns besser sorgen, indem wir eher die Situationen suchen, die uns stärken und Erfahrungen meiden, die uns verletzen. Es hilft, unser Leben besser zu gestalten.
Der einflussreichste Faktor für das Selbstvertrauen und die Identitätsentwicklung ist die Familie. Leider sind die Beziehungsverhältnisse in vielen Familien zum Leidwesen der Kinder problematisch. Viele Kinder haben Verhaltensprobleme. Psychotherapeuten können die vielen Anfragen nach Beratung und Therapie kaum bewältigen. Hinter den kindlichen Verhaltensstörungen stehen aber vielfach Beziehungsprobleme und seelischen Schwierigkeiten der Eltern. Wenn wir die Kinder verstehen und ihnen helfen wollen, müssen wir verstehen, was ihre Eltern belastet.
Viele Familien und elterliche Paarbeziehungen zerbrechen. Wie sieht dann die Versorgung und Erziehung der Kinder bei Familien im Trennungsprozess aus? Was bedeutet diese Erfahrung für die kindliche Selbstwertentwicklung? Was bedeutet eine Trennung für die Gesundheit und das Identitätsgefühl der Eltern? Wie verarbeiten erwachsene Paare schlechthin die Trennung vom Lebens- und Liebespartner? Was geschieht mit ihren Bedürfnissen, Sehnsüchten und Emotionen? Alle diese Themen werden umfassend beleuchtet.
Im letzten Kapitel wird sich zeigen, dass die Identitätsprobleme unserer Zeit nicht allein durch brüchige Familienstrukturen, die vielen Unsicherheiten unserer Lebensbedingungen oder die Vielfalt der Lebensstilangebote erklärbar sind. Denn die identitätsstiftenden Werte von Menschen, ihre Sehnsüchte und ihr Verhalten werden von einer kaum bewussten Dimension gesteuert: Es ist das „soziale Vorstellungsschema“, die geistige Tiefenstruktur einer Gesellschaft und ihrer Submilieus. Man könnte es das „kollektive Unbewusste“ nennen.
Für wen habe ich dieses Buch geschrieben?
Es ist ein Sach- und Fachbuch und sollte die Studierenden in den Fächern Sozialpädagogik und Psychologie und in verwandten Studiengebieten ansprechen, um sie auf ihre zukünftigen Arbeitsfelder vorzubereiten: z. B. in den Jugendämtern, in Kita und Schule, in Beratungsstellen oder in Vereinen und Selbsthilfegruppen. An vielen Stellen des Buches werden die seelischen Erfahrungen und Nöte von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Sinne der phänomenologischen Methode erlebnisnah und mit Fallbeispielen veranschaulicht. Die theoretischen Schlussfolgerungen werden durch aktuelle Befunde aus der empirischen psychologischen Forschung belegt, wenngleich der empirische Forschungsstand nicht der Schwerpunkt ist.
Ich habe also eine möglichst verständliche Sprache gewählt. Somit werden auch nichtprofessionelle Interessierte, die die Erlebnisse und Persönlichkeit ihrer Kinder und ihr eigenes Leben besser verstehen und gestalten wollen, dieses Buch mit Gewinn lesen.
Kap.1
Das Selbstwertgefühl
als Schlüssel zum Glück
Inhalt
- Das Selbstwertgefühl als aktiver Player im Spiel des Lebens
- Vier Säulen des guten Selbstwertgefühls
- Das Selbst als Steuerungsfunktion der Persönlichkeit
Das Selbstwertgefühl als aktiver Player im Spiel des Lebens
Im Selbstwertgefühl schlagen sich alle Lebenserfahrungen nieder: die guten oder die niederdrückenden Erfahrungen aus der Kindheit, die Erfolge oder Misserfolge aus der Zeit des Jugendalters und das Glück oder Unglück in der gegenwärtigen privaten und beruflichen Lebenssituation. Im Selbstwertgefühl drückt sich aus, wie wir unsere seelischen und körperlichen Kräfte bewerten.
Lange dachte man, das Selbstwertgefühl sei eine reine Begleiterscheinung günstiger oder ungünstiger Erfahrungen, Prägungen und Lebensumstände. Wir wissen heute aber, was auch die Forschung bestätigt: Das Selbstwertgefühl ist im Spiel des Lebens auch ein aktiver Player, ein Faktor, der uns in unseren privaten wie beruflichen Beziehungen helfen kann, erfolgreicher und glücklicher zu werden. Ein gutes Selbstwertgefühl hilft, Herausforderungen zu bewältigen. Wer sich schon einmal in einem Bewerbungsgespräch um einen Arbeitsplatz bemüht hat, weiß intuitiv, dass der Erfolg dieser Bewerbung auch sehr vom Auftreten und Selbstwertgefühl abhängt.
Im Alltag und in der Forschung werden im Zusammenhang mit der Selbstwertproblematik auch diese Begriffe verwendet: Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe … In der psychologischen Fachsprache sind allerdings diese miteinander verwandten Wörter nicht immer Synonyme. Ich gehe etwas später darauf ein.
Zunächst möchte ich an wenigen Erlebnisberichten zeigen, wie beeinträchtigend ein zu geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen im privaten und beruflichen Leben sein können.
Ein Fall aus der Beratungspraxis: Um therapeutische Hilfe zu erhalten, rief mich eine Tierärztin mit eigener Praxis an. Wenn sie ein krankes Tier operieren sollte, erlebte sie starke Selbstzweifel und Versagensängste. Sie befürchtete, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Um diesen belastenden Gefühlen zu entgehen, hatte sie eine weitere Tierärztin angestellt, welche ihr vor allem die Operationen abnehmen sollte.
Auch der Arzt Russ Harris, gibt freimütig seine inneren Unsicherheiten zu:
„Wenn einer meiner Patienten sagte: ´Danke. Sie sind ein wundervoller Arzt`, dachte ich bei mir: ´Ja klar, Du würdest das nicht sagen, wenn Du wüsstest, was ich wirklich bin`. Ich konnte solche Komplimente einfach nicht annehmen, obgleich ich meine Arbeit gut machte. Dann fing ich an, an mir zu zweifeln: Hatte ich bei diesen Magenschmerzen eine Fehldiagnose gestellt? Hatte ich das falsche Antibiotikum verschrieben? Hatte ich etwas Wesentliches übersehen?“ (1.)
Viele Heranwachsende und Erwachsene erkennen, dass ihr geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ein Schlüsselproblem für ihre Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen und der Sexualität sind. So bekennt eine junge Frau in einer Internetgruppe:
„Bin seit 2 Monaten mit meinem Freund zusammen, alles läuft sehr gut. Wir verstehen uns super und er kümmert sich um mich, hilft mir. Nur habe ich extreme Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Immer wenn er mal alleine unterwegs ist, mache ich mir immer tierische Sorgen, dass er vielleicht eine bessere als mich findet. Er meldet sich zwischendurch und kommt auch danach immer zu mir. Allgemein mache ich mir oft um diese Sache Sorgen. Er arbeitet bei einem Konzern und dort arbeiten auch viele hübsche und schlaue Frauen. Ich habe ziemliche Probleme, ihm zu vertrauen. Nun stelle ich fest, dass sich mein geringes Selbstwertgefühl durch sämtliche Beziehungen zieht. Ich habe einfach immer Angst verlassen zu werden und dass mein Freund etwas Besseres als mich findet!
Verlassen worden bin ich noch nie in einer Beziehung. Ich habe immer die Beziehungen selbst beendet.“ (2.)
Eine andere junge Frau hat Probleme, Zärtlichkeit zuzulassen:„Ich habe ein sehr geringes Selbstwertgefühl und als ich dann vor drei Jahren meinen Freund gefunden habe, hat das mir anscheinend geholfen. Doch mittlerweile bin ich wieder ganz unten: Ich finde mich einfach nicht hübsch und kann mich deshalb nicht fallen lassen. Ich möchte nicht mehr, dass mich mein Freund an bestimmten Stellen anfässt, weil ich mich nicht sexy fühle.“ (3.)
Minderwertigkeitsfühle und das Erleben von Scham, der Wunsch, einen vermeintlichen Mangel verbergen zu wollen, hängen eng miteinander zusammen. Viele Heranwachsende, besonders Frauen, sehen am Tag Dutzende Male unsicher in den Spiegel und fragen sich, ob ihr Gesicht und ihr Körper so in Ordnung sind. Andere flüchten vor dem Spiegel, weil sie ihr Gesicht und ihren Körper nicht mehr ertragen können. Es ist der ständige Vergleich mit medial und gesellschaftlich vermittelten kaum erreichbaren Schönheitsidealen, der eher bei Frauen, jedoch auch bei Männern zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper führen kann und das Selbstwertgefühl vermindert. (4.)
Das zu geringes Selbstwertgefühl verringert aufgrund von Selbstzweifeln, innerer Verkrampfung und dem Verlust an natürlicher Spontaneität die Erlebnisqualität, die Freude und das Glücksempfinden in Beziehungen. In Liebesbeziehungen kommt es in Konfliktsituationen häufiger zum Rückzug des Partners mit dem geringeren Selbstwertgefühl. Das Risiko des Scheiterns der Beziehung steigt. (5)
Die Forschung und klinische Praxis bestätigen, dass ein zu geringes Selbstwertgefühl die seelische Gesundheit beeinträchtigt. Durch die dadurch erhöhte Vulnerabilität steigt das Risiko, in anhaltend belastenden Lebenssituationen an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. Die Selbstfürsorge für das körperliche Wohlbefinden kann ebenfalls beeinträchtigt sein und zu einem gesundheitsschädlichen Verhalten wie zu geringer körperlicher Aktivität führen.
Wenn die Höhe des Selbstwertgefühls so bedeutsam für die Lebensqualität ist, stellen sich diese Fragen: Kann die Stärke des Selbstwertgefühls von uns beeinflusst werden – auch in späteren Lebensphasen? Was sind die Bedingungen dafür, dass wir uns annehmen und selbst lieben können?
Vier Säulen des guten Selbstwertgefühls
Das Selbstwertgefühl ist die emotionale Komponente des Selbstbildes bzw. der Identität. Ein positives Selbstbild spiegelt sich in der Emotion eines hohen Selbstwertgefühls wider. Dagegen führt ein Selbstbild mit vielen Negativbewertungen der eigenen Person zu einem schwachen Selbstwertgefühl. Wenn die Identität in Lebenskrisen brüchig wird, sinkt das Selbstwertgefühl. (6.)
Das Selbstwertgefühl bzw. der Selbstwert sind ein psychologisches Konstrukt. Ein für die therapeutische Praxis und die Selbsthilfe brauchbares Konstrukt ist das Modell der vier Säulen des Selbstwertes, wie es nun vorgestellt wird. (7.)
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit:
Menschen mit gutem Selbstwertgefühl trauen sich viel zu und haben eine positive Einstellung zu ihren Kenntnissen, ihren Potentialen und ihrer Leistungsfähigkeit. Auf welche Gebiete kann sich das Selbstvertrauen (hier synonym mit Selbstsicherheit) zum Beispiel beziehen? Es kann der Bereich sozialer Beziehungen, des Berufes, der Freizeit, des Sportes sein. Es kann um handwerkliche und technische Geschicklichkeit gehen. Auch Bildung, Lernfähigkeit oder wissenschaftliche Kompetenz können Bausteine für Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sein. Menschen mit Selbstvertrauen sind mit dem, was sie können, vollkommen zufrieden, aber auch in der Lage, persönliche Grenzen zu akzeptieren. - Menschen mit zu geringem Selbstvertrauen haben dagegen häufig ein Gefühl der Unzulänglichkeit und eine selektive Wahrnehmung für die eigenen Fehler und Schwächen.
Selbstakzeptanz:
Es fragt sich, ob eine positive Einstellung zum eigenen Können, Selbstsicherheit und Erfolgserlebnisse in bestimmten Segmenten des Lebensvollzugs ausreichend für einen stabilen Selbstwert sind. Wir brauchen ein tieferes, fundamentaleres Gefühl der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe, damit ein stabiles Selbstwertgefühl aufrechterhalten werden kann. Diese Selbstliebe umfasst auch die Annahme eigener Schwächen und Grenzen, letztlich auch des eigenen Scheiterns. Selbstakzeptanz und die bedeutungsmäßig verwandten Begriffe wie Selbstachtung und Selbstliebe spiegeln sich in einem weiten Feld von Gefühlen, Einstellungen und Erfahrungen wider. Sie kommen in diesen Sätzen zum Ausdruck:
- „Ich bin mit mir selbst zufrieden; das heißt, ich mag mich im Großen und Ganzen so wie ich bin“. - „Ich fühle mich auch wohl, wenn ich anderen nicht immer gefalle.“ - „Ich kann zugeben, wenn ich Fehler mache.“
Das Psychologenpaar Reinhard und Anne-Marie Tausch stellt fest: „Wenn wir uns selbst mögen, … empfinden wir weniger Angst. Wir bringen unser Fühlen und Denken offener, deutlicher und spontaner zum Ausdruck. Wir nehmen unsere Umwelt und andere Menschen weniger verzerrt wahr. Wenn wir ein überwiegend positives Selbstbild haben, können wir auch bei anderen ´die guten Seiten´ erkennen. Wir können freier und bewusster leben. Wir fühlen uns sicherer und lassen uns weniger durch erniedrigende Erfahrungen entmutigen, sind nicht so leicht enttäuscht von uns. Wir geraten seltener in schlechte Stimmungen…“ (8.)
Selbstannahme umfasst auch die dunklen Gefühle, wie sie eine Zwanzigjährige erlebt:
„Ich wollte das Allein-sein, die Traurigkeit als einen Teil von mir nicht annehmen. Jetzt habe ich gelernt, da hindurchzugehen, es mit mir auszuhalten. Ich glaube, ich bin früher oft vor meiner Einsamkeit weggelaufen. Ich konnte sie nicht akzeptieren. Endlich habe ich keine Angst mehr. Ich bin einsam, aber ich habe zu mir gefunden, und das ist ein unheimlich schönes Gefühl.“ (9)
Selbstliebe setzt voraus, dass wir bestimmte Einstellungen und Wünsche loslassen können, zum Beispiel unseren Perfektionismus oder den Wunsch, von allen geliebt zu werden. Dazu gehört auch der Wunsch nach einem perfekten Körper.
Das soziale Netz:
Von Natur aus sind wir Beziehungswesen und brauchen andere Menschen. Daher sind soziale Beziehungen eine wichtige Quelle für unser Wohlbefinden und Selbstwertgefühl. Was sind die Merkmale eines guten sozialen Netzes? Hierzu zählen: befriedigende Partnerschaft und Familie, verwandtschaftliche Beziehungen, ein Freundeskreis, gute kollegiale Kontakte, nachbarschaftliche Beziehungen und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben oder an einer religiösen Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen, mit denen wir geistigen und emotionalen Austausch haben. Dann bewirken das soziale Netz und die Kommunikation, dass …
- wir uns lebendig fühlen
- von unseren Sorgen abgelenkt werden - uns als bedeutsam und von anderen gebraucht erfahren
- uns als angenommen erleben können in unserer ganz besonderen Individualität
Ein gutes soziales Netz zeichnet sich auch durch die Verlässlichkeit der Beziehungen aus. Es ist in kritischen Lebenssituationen für unsere seelische Sicherheit und Stabilität wichtig, dass wir wissen: unsere Angehörigen und Freunde sind für uns da, wenn wir sie brauchen. Dieses soziale Netz kann aber zerreißen: Wenn beispielsweise eine Beziehung oder Familie von Trennung und Scheidung zerrissen wird. Dann erleben alle Familienmitglieder nicht nur äußere, sondern eine innere, seelisch schwächende Zerrissenheit der Identität und die Verminderung des Selbstwertgefühls. Besonders die Kinder leiden unter den Trennungsfolgen. Ihnen fehlen dann die den seelischen Halt und Geborgenheit vermittelnden verlässlichen Familienstrukturen. (10.)
Soziale Kompetenz:
Was nützen ein soziales Netz und der Kontakt zu anderen Menschen, wenn die Kommunikation nicht befriedigend gestaltet werden kann? Wir brauchen die Kompetenz, mit anderen Menschen auf eine Art und Weise umgehen zu können, dass ein zwischenmenschliches Klima von gegenseitiger Wertschätzung gefördert wird. So werden kränkende, selbstwertschädliche Missverständnisse und Konflikte vermieden. Menschen sind unterschiedlich befähigt, zu einem wertschätzenden Klima beizutragen.
Es gibt individuelle Unterschiede hinsichtlich einer interpersonellen Kompetenz, die man auch als soziale Kompetenz oder soziale Intelligenz bezeichnen kann. Soziale Kompetenz bedeutet: Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, Vermeiden von verbalen Aggressionen, Vorwürfen, Misstrauen und die Bereitschaft, zur Deeskalation in konflikthaften sozialen Situationen im privaten, familiären und beruflichen Feld beizutragen. Machtspiele und Dominanzgebaren werden vermieden.
Es gibt eine Nähe zur emotionalen Intelligenz, ein von D. P. Goleman erstmals verwendeter Begriff. Menschen, mit einer guten sozialen Kompetenz zeichnen sich aus durch
- Wahrnehmung der eigenen und fremder Gefühle: Um eine lebendige Kommunikation mit anderen Menschen zu haben, ist die Verbindung mit den eigenen Emotionen wichtig: mit der Freude, der Traurigkeit, der Angst und der Aggression. Nur wer die eigenen Gefühle wahrnimmt, kann mit den Gefühlen anderer mit-schwingen, sie spüren und Empathie zeigen. Die Forschung zeigt, dass Empathie, Selbstwertgefühl und als Folge davon die Lebenszufriedenheit schon bei Schülern miteinander korrelieren.(11.)
- Sprachkompetenz: Sprachkompetenz ist für den Ausdruck von Witz, Humor, Wertschätzung, Empathie und die Wahrnehmung und Mitteilung von Emotionen wichtig; das sind alles Kommunikationsaspekte, die einem guten sozialen Klima nützen und der gegenseitigen Selbstwertstärkung dienen.