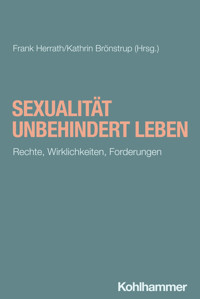
Sexualität unbehindert leben E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Sexuelle Selbstbestimmung ist ein für alle gültiges Menschenrecht, dennoch kommt unbehinderte Sexualität in der 2009 von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention als zu schützendes Rechtsgut nicht vor. Dabei steht es um die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen nicht zum besten: Frauen mit Behinderungen erfahren sexuelle Gewalt deutlich häufiger als Frauen ohne Behinderung, hilfreiche sexualitätsbezogene Bildungsangebote und Informationsmedien in leichter Sprache sind rar, Institutionen der Eingliederungshilfe stehen den sexuellen Interessen der von ihnen betreuten Menschen noch oft rechtswidrig und manchmal gewalttätig im Wege, das Recht auf Elternschaft wird Menschen mit kognitiver Einschränkung nicht selten verwehrt, Teilhabe wird strukturell mannigfaltig behindert. Andererseits setzen sich immer mehr Menschen mit Behinderung aktivistisch für ihre Belange und Rechte ein, sind medial sichtbarer, wächst die Zahl der Fachkräfte der Eingliederungshilfe, die sich sexualpädagogisch qualifizieren, ist Sexualassistenz nicht mehr bloß eine exotische und schlecht beleumundete Option. Wie gelingt es also 2024 Menschen mit Beeinträchtigungen, Sexualität unbehindert zu leben? Welche Wirklichkeiten führen zu welchen Forderungen, um sexuell gleichberechtigt zu sein? Das Buch versammelt ExpertInnen unterschiedlichster Handlungsfelder, verwirklicht in der Wahl der AutorInnen den BRK-Leitsatz "Nichts über uns ohne uns" und differenziert die Besonderheiten sexuellen Lebens für die Behinderungsvarianten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Einleitung
Sex tut gut!
Kapitel 1 Sexualität – ein gutes Recht für Menschen mit Behinderung?
Rechtsfragen der Sexualität und Partner*innenschaft von Menschen mit Behinderungen
Entsexualisierung als Kernaspekt und aufrechterhaltende Komponente von ableistischer Diskriminierung von Menschen mit Behinderung
Verpasste Chancen, viel Aktionismus und allerlei Barrieren. Sexuelle Selbstbestimmung und institutionelle Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Deutschland
Mit brennender Ungeduld und langem Atem weiterkämpfen! Ein Interview zur zweiten und dritten Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-BRK
Kapitel 2 Vielfältige Sexualitäten und vielfältige Behinderungen. Nichts über uns ohne uns!
(K)eine individuelle Geschichte: Barrierefreiheit und Gleichstellung als gemeinsame Herausforderung
Damit die Gesellschaft das sieht ... Ein Statement
Muss Ihr Vermieter damit einverstanden sein, wenn Sie Sexualität leben wollen? Ein Interview
Wenn die Seele leidet. Psychische Beeinträchtigung und Sexualität
Wenn sanfte Berührungen zu Speerstichen werden. Sexualität und Autismus
»Blinde haben besseren Sex« – Legende oder Vorurteil?
Wenn plötzliches alles anders ist. Menschen mit erworbenen Hirnschäden und Sexualität
Zur Förderung von sexueller Selbstbestimmung bei Komplexer Behinderung. Sexualitätsbegleitung mit dem LIS-Konzept
Kapitel 3 Diskriminierungen und Gewalt
Sexuelle Gewalt gegen Männer und Frauen mit Behinderungen: Beispiel Österreich
Mehr als ein »nice-to-have«: Umfassender Gewaltschutz für Frauen mit Beeinträchtigungen
Sexualität und institutioneller Gewaltschutz für Kinder und Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung. Herausforderungen und Fallstricke
Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes zum Nutzen von Menschen mit Behinderung. Ein best practice-Beispiel
To exist is to resist! Behindert und Queer
Kapitel 4 Kinderwunsch und Elternschaft
Verhütung, Familienplanung und Elternschaft von Menschen mit Behinderungen: Rechtliche Rahmenbedingungen
Eltern werden, Eltern sein! Barrieren – Herausforderungen – Möglichkeiten der Begleitung
Sexualität von Menschen mit Behinderungen – Was geht das Angehörige an? Pädagogische und rechtliche Aspekte
Kapitel 5 Information, Beratung, Bildung und Assistenz
Grüße aus der Talsohle der Bildungskrise. Sexuelle Bildung für Menschen mit Behinderungen
»Ja, Vulva!« Zehn Bemerkungen zur Sexualerziehung in Förderschulen
Ein Blick von außen, ein Blick von innen. Was Menschen mit Behinderung in Filmen über ihre Sexualität und deren Einschränkung ausdrücken
Sexuelle Aktivitäten in digitalen Kontexten. Chancen und Risiken für Menschen mit Behinderung
Welche sexualitätsbezogene Assistenz unterstützt?
Sexualassistenz ist Empowerment. Interview mit einer Sexarbeiterin
Lust ohne Barrieren?!? Sexualberatung von Menschen mit Beeinträchtigung – Aufgaben und Besonderheiten
Kapitel 6 Lasst tausend Blumen blühen! Blitzlichter sexualitätsbezogener Bildungspraxis
Wie für alle anderen auch! Sexualitätsbezogene Beratung von Menschen mit Behinderungen
Letztendlich ist eine Behinderung nicht mehr und nicht weniger als ein anderes Körpermerkmal
Fortbildungen für Fachkräfte wirken! Empowerment durch Bildungsformate
Reflexion, Fachwissen, Mut und Durchhaltevermögen oder: Wie professionelle Begleitung gelingen kann
Echt mein Recht! Mit Bildung gegen Reglementierung und Bevormundung
Lust auf lernen, sprechen und selbstbestimmtes Leben. Materialien für eine vielfaltsbewusste und enttabuisierende sexuelle Bildung
Partizipation auf allen Ebenen. Vom Nutzen, Informationen einfach(er) zu machen
Kapitel 7 Perspektiven
Ist der Fortschritt Schnecke oder Fata Morgana?
Verzeichnisse
Autor*innenverzeichnis
Die Herausgebenden
Dr. Frank Herrath und Kathrin Brönstrup sind freie Mitarbeitende des Instituts für Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Sie gestalten dort Weiterbildungen mit dem Themenschwerpunkt »Sexualität und Behinderung«.
Dr. Frank Herrath ist zudem Fachreferent für Gewaltschutz und sexuelle Bildung in einer großen diakonischen Komplexeinrichtung, Kathrin Brönstrup hat als Sozialpädagogin langjährige Leitungserfahrung in verschiedenen Institutionen der Eingliederungshilfe.
Frank Herrath/Kathrin Brönstrup (Hrsg.)
Sexualitätunbehindert leben
Rechte, Wirklichkeiten, Forderungen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-044808-7
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-044809-4epub: ISBN 978-3-17-044810-0
Vorwort
Jana Offergeld
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Sie müssen, wie alle anderen Menschen, darüber entscheiden können, wann, wie und mit wem sie ihre Sexualität ausleben möchten und ob und wie viele Kinder sie haben möchten. Außerdem haben sie Anspruch auf Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Wir wissen allerdings, dass viele Menschen mit Behinderungen diese Rechte nicht gleichberechtigt mit anderen ausleben können – auch 15 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Die Sexualität gehört leider auch heute zu den Lebensbereichen, in denen die anhaltende Diskriminierung und Verwehrung von Selbstbestimmung gegenüber Menschen mit Behinderungen besonders schwerwiegend sind.
Noch immer werden sowohl das Recht von Menschen mit Behinderungen als auch ihre Fähigkeit, Sexualität zu leben, vielerorts grundlegend in Frage gestellt. Diese Entsexualisierung geht mit gravierenden Unrechtserfahrungen einher, die im politischen und fachlichen Diskurs über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bisher wenig Aufmerksamkeit erfahren. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass sich dieser Sammelband diesem dringenden Thema widmet.
Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen überprüft die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention weltweit. Die Umsetzung in Deutschland hat er im Jahr 2023 zum zweiten Mal überprüft. Das Ergebnis dieser Staatenprüfung ist in den sogenannten Abschließenden Bemerkungen nachzulesen, die der Ausschuss am 3. Oktober 2023 veröffentlichte. Darin werden konkrete Probleme adressiert, die für die sexuelle Selbstbestimmung und Elternschaft von Menschen mit Behinderungen relevant sind. Es wird bemängelt, dass Menschen mit Behinderungen empfängnisverhütende Maßnahmen ohne ihre freie und informierte Zustimmung erleben und ihr Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität und Elternschaft nicht ausüben können. Es fehlen angemessene Präventions- und Schutzmaßnahmen bei Missbrauch und sexualisierter Gewalt sowie barrierefrei zugängliche Unterstützungsstrukturen wie Frauenhäuser oder Beratungsstellen. Bewohner*innen von institutionalisierten Wohnformen sind in besonderem Maße von Einschränkungen ihrer (sexuellen) Teilhabe und Selbstbestimmung sowie von Gewalterfahrungen betroffen.
Die Beiträge dieses Buches thematisieren viele der genannten menschenrechtlichen Herausforderungen. Dabei wird insbesondere der Perspektive selbst betroffener Menschen Raum gegeben. Die Autor*innen prangern eindrücklich die beharrlichen strukturellen, aber auch einstellungsbezogenen Barrieren an, die Menschen mit Behinderungen in Deutschland an der selbstbestimmten Ausübung ihrer Sexualität hindern. Es werden aber auch positive Entwicklungen und Ansätze zu ihrer Bewältigung aufgezeigt. Dabei wird deutlich, wie wichtig die politische, wissenschaftliche, soziale und pädagogische Arbeit sowie das Engagement von Selbstvertreter*innen in diesem Bereich ist.
Wir wünschen dem Buch die größtmögliche Verbreitung, damit die Beiträge neue Aufmerksamkeit auf bestehende Missstände lenken und notwendige Transformationsprozesse mit anstoßen können.
Jana Offergeld,Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonventiondes Deutschen Instituts für Menschenrechte
Einleitung
Frank Herrath & Kathrin Brönstrup
Als »Sexualität leben ohne Behinderung« 2013 erschien, war der Befund zur Lage der Verwirklichung der sexuellen Menschenrechte für Menschen mit Behinderung: Die Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention 2009 hatte wenig Auswirkungen für sexuelles Leben von Menschen mit Behinderungen.
Kein Wunder – war doch das durch massive sexualitätsbezogene Diskriminierungsrealitäten von Seiten der EU-Vertretungen gut begründete Bemühen, den Lebensbereich Sexualität in der Konvention ausdrücklich zu berücksichtigen, am Veto sexnegativer Staatenvertretungen gescheitert.
Es war Verdienst der Publikation, Notwendigkeit und Bedeutung des Einsatzes für sexuelle Selbstbestimmung in Bezug auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen zu reklamieren und aufzuzeigen, wo Veränderungsbedarf bestand und besteht – strukturell, alltagspraktisch und für die verschiedenen sexualitätsbezogenen Detailthemen.
An der Notwendigkeit des Einsatzes für sexuelle Selbstbestimmung hat sich in den letzten gut zehn Jahren nichts geändert, denn die Bilanz des gesellschaftlichen Fortschritts in der Gleichachtung sexuellen Lebens von Menschen mit Behinderungen ist ernüchternd. Ähnlich der Bilanz der Inklusionserfolge insgesamt ist die der Verbesserung sexueller Gleichberechtigung beschämend schwach.
Etwas positiver ausgedrückt sind alle Detailthemen sexuellen Lebens, die in »Sexualität leben ohne Behinderung« entfaltet wurden, weiterhin bedeutsam und erfordern Engagement.
Nach dem desaströsen Abschneiden der Bundesrepublik bei der kombinierten zweiten und dritten Staatenprüfung zum Status der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 2023 lag es nahe, auch einen erneuten Blick auf den Status sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu werfen.
In diesem Buch schreiben Menschen mit sogenannten kognitiven Einschränkungen, körperlichen Behinderungen, erworbenen Behinderungen, Sinnesbehinderungen, Menschen aus dem Autismus-Spektrum, Fachpersonen aus Lehre, Forschung, Institutionen sozialer Arbeit und Fachverbänden. Es enthält Erfahrungsberichte, Einschätzungen der Lage bezogen auf konkrete sexualitätsbezogene Themen und Studien- und rechtsbasierte Fachtexte.
Das Buch trägt den Titel »Sexualität unbehindert leben – Rechte, Wirklichkeiten, Forderungen«. Alle Autor*innen erklären nachdrücklicher denn je den Rechtsanspruch auf die sexualitätsbezogene Gleichachtung von Menschen mit Behinderungen in selbstverständlicher Akzeptanz von für alle gesellschaftlich verabredeten Rechten – und bitten nicht um gnädige Gewährung. Sie schildern als Expert*innen in eigener Sache ihre vielfältigen Erfahrungen mit Ignoranz, Missachtung, Diskriminierung, Paternalismus und Fremdbestimmung als Behinderte, als sexuelle Wesen, als sexuelle Wesen mit Behinderungen. Sie fordern die in Institutionen der sogenannten Behindertenhilfe Tätigen wie die in anderen Handlungsfeldern unterstützend Wirkenden auf, weiter in gutem Kontakt mit ihnen zu bleiben, um die Teilhabebarrieren zu erkennen und abzuräumen, die sexueller Selbstbestimmung im Wege stehen.
Forschende und Aktivist*innen sind sich einig, dass unbehindertes sexuelles Leben eine wichtige Voraussetzung für Wohlbefinden und Glück darstellt, egal, welche Bedeutsamkeit sexuelle (Inter)aktionen in individuellen Biografien für ein gutes Leben haben.
Eine der positiven Entwicklungen der letzten Jahre ist die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber der Vielfalt sexuellen Lebens und die größere Bereitschaft, gegenüber anderen Respekt zu zeigen und sich um Akzeptanz zu bemühen – auch wenn deren Idee von Gelungenem, von Zufriedenheit eine andere als die eigene ist.
Da gleichzeitig Hasskriminalität angestiegen ist und Normabweichungen immer wieder ins Fadenkreuz von Abendlandrettungskampagnen geraten, braucht es Stellungnahmen, engagierten Einsatz und Entschiedenheit, in diesem Engagement nicht zu ermüden. Die öffentliche Demonstration des Willens, eine demokratische, bunte Gesellschaft ohne Fremdenfeindlichkeit zu verteidigen, war in Zeiten schwerer großer Krisen zu Beginn des Jahres 2024 ein ermutigendes Zeichen, dass viele Menschen nicht bereit sind, menschenfeindlichen Säuberungsideen zu folgen.
Die Verteidigung eines Zusammenlebens in Vielfalt muss die Achtung sexueller Vielfalt inkludieren. Die Rechtssicherung selbstbestimmten sexuellen Lebens wird nicht erreicht werden, wenn sie nicht vom Einsatz für die allgemeinen Menschenrechte flankiert wird.
Behinderung ist ein Vielfaltsaspekt – Menschen mit Behinderungen gewönnen doppelt, wenn sexuelle Selbstbestimmung in der Menschenrechtsagenda angemessen gesetzt und nicht am Katzentisch platziert wäre.
Behinderung ist nicht gleich Behinderung, sexuelles Leben (mit Behinderung) ist vielfältig – das sind Binsen. Trotzdem schnurrt bei vielen der gutwilligen Antidiskriminierungsaktivist*innen die Wahrnehmung und das Bedenken zum Themenfeld »Sexualität und Behinderung« oft auf die Besonderheit der kognitiven Beeinträchtigung zusammen. Eine weitere Engführung im antiableistischen Engagement ist die alleinige Fokussierung auf diejenigen, die institutionell betreut sind.
Wir haben uns daher bemüht, Beiträger*innen zu gewinnen, die die Diversität von Sexualität und Behinderung aufspannen.
Und natürlich haben wir gemäß des BRK-Leitspruchs »Nichts über uns ohne uns!« der Expertise der wissenschaftlichen und in verschiedenen Kontexten professionell aktiven Fachpersonen die derjenigen dazugesellt, die als »Expert*innen in eigener Sache« bezeichnet werden – nicht wenige von ihnen selbst professionell aktiv.
Die Detailthemen sind über die Jahre im Wesentlichen stabil geblieben, die Probleme und das notwendige Engagement für eine Besserung der Zustände auch. Sexuelle Gewalt und Diskriminierung hat ein eigenes Kapitel bekommen müssen, da Menschen mit Behinderungen unverändert und besonders Grenzverletzungen erfahren. Und leider erleben sie auch recht unvermindert die Behinderung, als Mensch mit Behinderung bei Kinderwunsch und Wille zur Elternschaft missachtet zu werden.
Wichtiger geworden ist (nicht nur) für Menschen mit Behinderungen die Barrierefreiheit zu Information und Bildung – im digitalen Raum wie in leibhaftiger Begegnung in diversen Bildungssettings. Neben Beiträgen zur schulischen Sexualpädagogik, zur Sexualberatung und zur medialen Selbstermächtigung sind auf Grund der positiven Entwicklung im Bildungsangebotsspektrum deshalb auch in unterschiedlichen Kontexten eingebundene Bildungsaktivist*innen zu Kurzstatements gebeten worden.
Sie werden sehen: die Beitragsformate des Buches sind divers, die Beitragsfarben bunt – die Mischung aus Übersichtsbeiträgen, Forschungsberichten, individuellen und kollektiven Erzählungen, Interviews und Statements kommt den schillernden Wirklichkeiten des sexuellen Lebens mit Behinderung so nahe, wie es bei solch einem großen Thema eben geht.
Vor der kurzen Führung durch die 6 Kapitel noch einige Bemerkungen zum Zumutungsanteil von Verschiedenheit: Herausgebende wie Autor*innen bemühen sich auch bei der Ansprache und Begriffsnutzung um Inklusion und Diskriminierungsvermeidung, was aber im sehr Konkreten nicht immer zu »der einen richtigen« Begrifflichkeit führt. Gute Orientierung bietet die Webseite »Leidmedien«1 des von Raul Krauthausen und Jan Mörsch gegründeten Berliner Vereins »Sozialhelden«. Dort wird z. B. begründet dargelegt, warum der Begriff »Handicap« keine modern-schicke Alternative zu Behinderung ist, dass Behinderung nicht vor allem Leid und schon gar nicht Fesselung ist und »geistige Behinderung« nicht vorliegt, wenn Menschen kognitiv beeinträchtigt sind oder Lernschwierigkeiten haben. Im Bemühen um größtmöglichen Respekt bei der Wortwahl gibt es jedoch auch unterschiedliche Positionen. Während viele Verbände den Begriff »Menschen mit Lernschwierigkeiten« empfehlen, halten andere die Vermeidung des Adjektives »behindert« für unangemessen euphemistisch.
»Behindertenhilfe« hat die Aura des Paternalismus, wenngleich der Alternativbegriff »Eingliederungshilfe« auch nicht besonders nach Selbstbestimmung schmeckt. Einige Beiträger*innen schreiben von »sogenannter Behindertenhilfe«, um die Problematik des Begriffs zu beschreiben, aber wohl wissend, dass das Gesamt der Vielfalt der Dienste und Einrichtung noch am ehesten allgemeinverständlich benannt ist, wenn der Sammelbegriff »Behindertenhilfe« verwendet wird.
Allen Autor*innen des Buches ist es ein Anliegen, nicht-binäre Menschen nicht durch Ignoranz zu diskriminieren. Die meisten nutzen den Gender-Stern, andere bevorzugen den Doppelpunkt; beides ist nicht ideal – so wie die Wirklichkeit –, zeigt aber gleich stark das Bemühen um Gleichachtung.
Respekt zeigt sich sicherlich auch im sprachlichen Ausdruck; jedoch ändert sich an diskriminierenden Wirklichkeiten nicht das Geringste durch die Verwendung korrekter Begriffe.
Im ersten Kapitel »Sexualität – ein gutes Recht für Menschen mit Behinderung?« nehmen Grundsatzbeiträge zur rechtlichen, politischen und kulturellen Situation Stellung, die sich zu Sexualität und Behinderung in Deutschland zeigt – im Gap zwischen menschenrechtlicher Unmissverständlichkeit und schwerstbehindernden Diskriminierungswirklichkeiten, nicht nur, aber gerade auch in Settings institutioneller Betreuung.
Das zweite Kapitel »Vielfältige Sexualitäten und vielfältige Behinderungen. Nichts über uns ohne uns!« fächert die sexualitätsbezogenen Besonderheiten auf, wie sie sich für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen darstellen können. Der grundsätzliche Mangel an alltäglicher universeller Barrierefreiheit hat unabhängig von der konkreten Einschränkung deutliche Wirkung für die Gestaltungsmöglichkeiten sexuellen Lebens. Wir haben Dunja Reichert gebeten, die diskriminierenden Auswirkungen von vor allem baulichen Barrieren für den Alltag von Menschen mit einer körperlichen Behinderung ausführlich zu beschreiben, um zu zeigen, dass der Einsatz für sexuelle Gleichachtung von Menschen mit Behinderung nur erfolgreich werden wird, wenn er verbunden ist mit der Kritik an den von ableistischer Ignoranz geprägten exkludierenden Normalitäten in allen gesellschaftlichen Bereichen. Stephanie Meer-Walter macht die Vielfalt der Barrieren für Menschen aus dem Autismusspektrum deutlich, Reiner Delgado stellt besonders die Barrieren dar, die sich für Menschen mit Sehbeeinträchtigung auftun, wenn sie ihr Recht auf Information und Bildung wahrnehmen wollen. Erst wenn man sich den für die Ausgestaltung sexueller Möglichkeiten beachtenswerten Besonderheiten der Behinderungsvarianten interessiert zuwendet, gelingen Verstehen und Klarheit darüber, was für Verbündete im Einsatz für die sexuelle Selbstbestimmung der Verschiedenen zu tun und zu lassen ist.
Sexuelle Gewalt widerfährt Menschen mit Behinderungen besonders, sie trifft Frauen mit Behinderungen in stärkerem Maße als Frauen ohne Behinderung, queere Menschen in stärkerem Maße als heteronorme Menschen und sie ereignet sich massiv vor allem in institutioneller Betreuung. Im dritten Kapitel »Diskriminierungen und Gewalt« werden diese seit Jahren robusten Tatbestände dargestellt und analysiert. Dass es so nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ist, bietet keinerlei Anlass für Relativierung. Wenn Gewaltschutz inhaltlich mit sexueller Bildung verknüpft, finanziell solide ausgestaltet wäre und mit ernsthafter Deinstitutionalisierung einhergehen würde, könnte sich die Selbstverständlichkeit von Gewalterfahrungen bei Menschen mit Behinderungen verringern. Da das nicht zu erwarten ist, bleibt es singulären Initiativen überlassen, das Beste zu versuchen und andere mit ihrem Beispiel zu inspirieren.
Dass die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen und Männern mit Behinderungen zwar in ehrenwerten Erklärungen unterstrichen werden, der Zugang zu Information, Beratung, Gesundheitsversorgung für sie aber durch vielfältige Barrieren erschwert ist, Frauen mit Behinderung noch sehr häufig zu Verhütung genötigt werden und ihnen und ihren Partner*innen ihr sozialgesetzlich verbriefter Anspruch auf gezielte Unterstützung in ihrem Vorhaben, Eltern zu werden, vorenthalten wird, ist im vierten Kapitel »Kinderwunsch und Elternschaft« zu lesen. Nachdrücklich reklamieren die Autorinnen die Rechtsverwirklichung durch baldige, konkrete, ressourcengesicherte Maßnahmen. Dass Menschenrechtsachtung auch von Sorgeberechtigten gegenüber ihren behinderten Kindern einzufordern ist, erläutert der letzte Beitrag des Kapitels.
Es ist ein gutes Zeichen, dass das fünfte Kapitel das umfangreichste ist, denn die Voraussetzung für (sexualitätsbezogene) Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind »Information, Beratung, Bildung und Assistenz« von Qualität.
Nach einem Überblick über das Gesamt aktueller sexueller Bildung (mit dem Fokus Behinderung) finden sich hier Beiträge zu den wichtigsten Bildungsfeldern und -orten: Schulische Bildung, mediale, digitale Bildung, Beratung. Zum immergrünen Thema Sexualassistenz musste der Beitrag aus »Sexualität leben ohne Behinderung« von 2013 nur geringfügig aktualisiert werden. Ergänzt wird der Beitrag durch ein Interview mit einer Sexarbeiterin.
Kapitel 6 »Lasst tausend Blumen blühen! Blitzlichter sexualitätsbezogener Bildungspraxis« versammelt Kurzbeschreibungen von Gelungenem. Im Format von »3 Fragen an...« beschreiben sieben in der sexuellen Bildung für Menschen mit Behinderungen aktive Multiplikator*innen prägnant die Besonderheiten ihrer Arbeit.
Frage 1 der drei Fragen ist jedoch allen gleich gestellt: »Wie behindert sind Sexualitäten von Menschen mit Behinderung?« – eine absichtlich große und allgemeine Frage, deren knappe Beantwortungen einen ähnlich defizitären Gesamtbefund ergeben. Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – sind und bleiben sie Aktivist*innen, die an ihren jeweiligen Orten nicht resignieren, sondern unverzagt, überzeugt von Sinn und Effekt ihres Tuns, Fortschritt machen.
Im Kapitel 7 »Perspektiven« wird mit der gebotenen Vorsicht versucht, auf dem dünnen Eis der Zukunftserwartung die Schritte nach vorn für die Sicherung sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu beschreiben, die zu gehen möglich und nötig sind.
Die unterschiedlichen Beiträge des Buches sollen dazu anregen und auffordern, Behinderungen abzubauen, Achtung, Würde und Gleichberechtigung in Bezug auf sexuelles Leben zu stärken.
Beim Lesen der Beiträge könnte fast der Eindruck entstehen, die Autor*innen hätten sich vorab an einem runden Tisch getroffen und ausgetauscht, denn die Beschreibung der Zustände sind trotz aller Verschiedenheit der Arbeitsfelder, Themen und Blickwinkel unterm Strich gleich tragisch und machen deutlich, dass es ohne Aktivismus und gravierende Veränderung keine menschenrechtskonforme Lebenswirklichkeit geben wird. Gerade weil dies so ist, freuen wir uns, dass die Poetryslammerin Hannah Long in ihrem sich an diese Einleitung anschließenden Text klare Worte und Haltung mit einem positiven Zugang zum Thema Sexualität paart.
Wir würden uns freuen, wenn das Buch dazu beiträgt, sich zuzuhören, sich aufeinander zu beziehen und den Einsatz für den hier dringend nötigen Fortschritt zu inspirieren.
Endnoten
1https://leidmedien.de/begriffe-ueber-behinderung-von-a-bis-z/
Sex tut gut!
Hannah Long
Jemand greift nach meiner Hand. Ich spüre, wie die Energie durch mich fließt.Wie ein belebender Wasserfall fühlt sich mein Bewusstsein an. Frisch, klar und schwungvoll.Es ist spürbar, wie das Glücksgefühl durch meinen Körper strömt.Ein Gefühl, was ich lange nicht hatte – höchstens bei Schokolade.Interessiert sich da wirklich jemand für mich?
Tja, die Schokolade war aufgegessen – und nun sitzt vor mir ein Künstler, der offensichtlich die Kunst beherrscht, andere Leute zu berühren.Ich weiß nicht, woher das Gefühl kam, aber ich wollte in seine Seele eintauchen. Ich wollte diese Energie in mir aufnehmen, ich wollte, dass die Welt es mitbekommt und dass man dieses Gefühl weitergibt. Ich fühlte mich plötzlich als Frau.Ja, ich bin eine Frau!
Es schien mir so, als ob das Oxytocin gar nicht mehr aus meinem Körper verschwinden wollte.Tagelang nach unserem Date hatte ich noch dieses Gefühl des belebenden Wasserfalls.Meine Laune blieb konsequent hoch oben, ein Wolkenkratzer in meiner Straße.Die Sonne schien und wärmte mich.
Mir waren die Auswirkungen von Sexualität gar nicht bewusst.Es ist so viel mehr als der Akt.Es ist ein neues Körpergefühl. Der positive Geist wird aktiviert.Die Blumen scheinen so viel bunter.Sexualität stärkt unser Bewusstsein, das Abwehrsystem und erfüllt uns mit Glück.
Wo fängt bei dir Glück an?
Sex ist ein Grundbedürfnis.Wir werden täglich zum Toilettengang begleitet, Essen wird zubereitet und angereicht.Wir werden geduscht, gepflegt.Aber über Sex wird oft geschwiegen. Warum?Wir haben ein Recht auf Intimität und Sexualität.
Sex tut gut!
Kapitel 1Sexualität – ein gutes Recht für Menschen mit Behinderung?
Rechtsfragen der Sexualität und Partner*innenschaft von Menschen mit Behinderungen
Julia Zinsmeister
Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung. Der Beitrag beleuchtet, welche Anforderungen sich daraus und aus den betreuungs-, sozial- und strafrechtlichen Vorgaben an den Umgang der rechtlichen Betreuenden und der Mitarbeitenden sozialer Einrichtungen und Dienste mit dem Sexualleben von Menschen mit Behinderungen ableiten lassen. Wie können und müssen sie zur Sicherung und Förderung der sexuellen Selbstbestimmung der Adressat*innen beitragen und zugleich ihrer Schutzverantwortung gerecht werden?
Das Recht auf geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung
Art. 2 Abs. 1 GG gewährt allen Menschen in Deutschland das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Geschützt werden ihre allgemeine Handlungsfreiheit und – in Zusammenschau mit Art. 1 Abs.1 GG – ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht.2 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verpflichtet den Staat, den Einzelnen die Grundbedingungen zu sichern, die sie brauchen, um ihre Individualität selbstbestimmt entwickeln und wahren zu können.3 Zu den geschützten Aspekten der eigenen Persönlichkeit zählen Rechtsprechung und rechtswissenschaftliche Lehre auch die geschlechtliche Identität eines Menschen und seine Sexualität.4
Mit dem Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung befasste sich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingehender 2017. In seiner Entscheidung wies es darauf hin, dass der Zuordnung zu einem Geschlecht nicht nur herausragende Bedeutung für die individuelle Identität der Einzelnen, sondern gegenwärtig auch noch für deren gesellschaftliche Positionierung zukommt.5 Die Verfassung, betont das Gericht, schützt auch die geschlechtliche Identität jener Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind.6 Werden sie durch binärgeschlechtlich gestaltete Strukturen gezwungen, sich als Frau oder Mann einzuordnen, kann darin eine verbotene Benachteiligung liegen (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG).7 Die Entscheidung fordert eine Sensibilisierung und Anpassung gesellschaftlicher Strukturen an diese Vielfalt – auch in der Eingliederungshilfe. Einrichtungen und Dienste sind aufgefordert, ihre Politiken und Praktiken zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht diskriminierend wirken und die Vielfalt der Geschlechter berücksichtigen.
Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wird weder in unserer nationalen Rechtsordnung noch im europäischen und internationalen Recht positiv definiert. Das BVerfG hat es mehrfach als Grundrecht eingeordnet, sich aber nur mit Teilaspekten dieses Rechts befasst8 und offen gelassen, was darunter konkret zu verstehen ist.
Internationale Menschenrechtsexpert*innen und Nichtregierungsorganisationen haben darum Interpretationshilfen erarbeitet, die zwar rechtlich nicht verbindlich sind, aufgrund ihres tiefen Verständnisses der Bedeutung sexueller und reproduktiver Rechte aber hohe Argumentationskraft haben: Dazu zählen insbesondere die »Yogyakarta Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity« von 20079 und deren Ergänzungen von 2017.10 Orientierung geben auch internationale Fachgesellschaften wie die International Planned Parenthood Federation (IPPF) mit ihrer Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte von 1995.11
Eine eingehende Analyse der deutschen Rechtsprechung zum Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und dessen gesamter Kontur hat 2021 erstmals Valentiner vorgelegt. Sie charakterisiert das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als die Befugnis einer Person, darüber zu bestimmen, ob, mit wem, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen sie Sex hat, und ob und in welchen Grenzen sie Einwirkungen anderer Personen auf ihre Entscheidungen und Handlungen zulässt.12 Das Recht der Einzelnen auf sexuelle Selbstbestimmung endet wie alle Freiheitsrechte da, wo diese auf Kosten der geschützten Selbstbestimmung anderer gelebt werden soll. Einigkeit herrscht daher, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nur konsensuale und nicht machtmissbräuchliche Sexualitäten schützt.13 Sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, der Besitz von Missbrauchsabbildungen (sog. Kinder- oder Jugendpornographie) und ähnliche Handlungen werden in Deutschland darum als »Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung« bezeichnet und staatlich verfolgt.
Vor allem für heterosexuelle cis-Frauen ist ihre sexuelle Selbstbestimmung eng verknüpft mit ihrem Recht, sich frei für oder gegen eine Schwangerschaft entscheiden zu können.14 Dieses Recht ist Ausfluss des Rechts auf reproduktive Selbstbestimmung, das behinderten Menschen häufig vorenthalten wird und dem in diesem Band darum ein eigenes Kapitel gewidmet ist.
Setzt das Recht auf Selbstbestimmung die Fähigkeit auf Selbstbestimmung voraus?
Behinderten Menschen wird das Recht auf (sexuelle) Selbstbestimmung oft abgesprochen mit der Begründung, sie seien nicht zu freiverantwortlichem Handeln fähig. Das gilt in besonderem Maße für Menschen mit der Diagnose einer Intelligenzstörung, die gemeinhin als »geistig behindert« bezeichnet werden, diese Bezeichnung aber vielfach als diskriminierend ablehnen.15 Aus Respekt vor ihrem Recht auf Selbstdefinition und in Abkehr vom medizinischen Modell von Behinderung16 spreche ich nachfolgend von Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten.
Grund- und Menschenrechte gelten universal und dienen gerade dem Schutz derjenigen, deren Menschenrechtsfähigkeit oder -würdigkeit angezweifelt wird. In Art. 3 der UN-BRK haben sich Deutschland und die anderen Vertragsstaaten explizit verpflichtet, die Autonomie aller Menschen mit Behinderungen anzuerkennen. Autonom sind wir nie allein.17 In welchem Maße die Einzelnen die Fähigkeit zu (sexueller) Autonomie entwickeln, hängt maßgeblich von ihrem Zugang zu sozialer Unterstützung, Information und Bildung und davon ab, welche Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten ihnen offen stehen, um sich alleine und in der Interaktion mit anderen zu erfahren und zu erproben.
Diesem relationalen Modell von Autonomie folgend versteht die UN-BRK Selbstbestimmung nicht als einen statischen Zustand, der besteht oder nicht, sondern als eine Kapazität, die Menschen grundsätzlich nur mit Hilfe fördernder und unterstützender Strukturen in unterschiedlichem Maße entwickeln und im Lebensverlauf wieder verlieren können.18 Zu diesen Strukturen zählen garantierte Freiheits- und Teilhaberechte, die den Einzelnen Entfaltungsmöglichkeiten sichern, aber auch die Familie, Kitas, Schulen sowie staatliche und nichtstaatliche Informations-, Beratungs- und Serviceangebote.
Die Pflicht des Unterstützungssystems, behinderten Menschen (sexuelle) Selbstbestimmung zu ermöglichen
Für Menschen mit Behinderungen sind in Deutschland flankierend zu den allgemeinen Institutionen, die Bildung, Beratung und andere Unterstützung anbieten, die Träger, Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe und anderer Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) dafür zuständig, die »Selbstbestimmung und [...] volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe« behinderter Menschen »am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken« (§ 1 SGB IX). Können erwachsene Menschen krankheits- oder behinderungsbedingt ihre Angelegenheiten nicht alleine rechtlich besorgen, soll der Staat ihnen rechtliche Betreuer*innen an die Seite stellen, die sie darin unterstützen, ihr Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten (§ 1821 Abs.1 Satz 2 und Abs. 2 BGB).
Die sich hieraus ergebenden Handlungspflichten der Unterstützer*innen sind mehr als ein moralischer Appell: Ihre Verletzung kann aufsichtsrechtliche oder betreuungsgerichtliche Maßnahmen, Haftungsansprüche oder Kürzungen der Leistungsentgelte (§ 129 SGB IX) nach sich ziehen. Bestimmte Pflichtverletzungen, z. B. die unbefugte Weitergabe sexualbezogener Informationen über Bewohner*innen an deren rechtliche Betreuer*innen oder die Desinformation einer Person, um sie zur Einwilligung in ihre Sterilisation zu bewegen, können auch strafrechtlich verfolgt werden.19
Wie aber können rechtliche Betreuer*innen und Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe konkret zum Schutz und zur Förderung der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen beitragen?
In der Literatur und Praxis werden bislang vorrangig ihre individuelle Förderung durch spezielle sexualpädagogische Angebote propagiert.20
Die UN-BRK macht jedoch deutlich, dass es zur Sicherung der Selbstbestimmung behinderter Menschen neben der Förderung ihrer individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten stets auch der Ermöglichung von Freiheit bedarf und dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen und als Rechtssubjekte, d. h. Träger von Rechten und Pflichten, anzuerkennen sind (Art.12 UN-BRK). Aufgabe der rechtlichen Betreuer*innen und der Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe ist es, sie dabei zu unterstützen und hierzu auch die strukturellen Einschränkungen zu beseitigen, die ihre Autonomieräume beschränken. Hierzu gilt es, sowohl die einstellungs- und umweltbedingten Barrieren in den Blick zu nehmen, die Menschen mit Behinderungen aus analog-digitalen sozialen Netzwerken ausgrenzen und an der Inanspruchnahme allgemeiner Infrastruktur hindern, als auch die eigenen Strukturen, Haltungen und Handlungsweisen zu hinterfragen.21 Studien zeigen, dass die Schwierigkeiten von Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten, soziale und sexuelle Beziehungen einzugehen, stärker auf ihre Wohnform als auf ihre individuellen Einschränkungen zurückzuführen sind: Sie leben vergleichsweise lange im Elternhaus und besonders häufig in sogenannten besonderen Wohnformen.22 Dort sind Privatheit und partnerschaftliche und sexuelle Kontakte schwer herstellbar. Besondere Wohnformen wirken der sozialen Isolation nicht entgegen, sondern verstärken diese tendenziell: Zwischen den Bewohner*innen entwickeln sich nur selten Freundschaften und vertrauensvolle Beziehungen.23 Außenkontakte können aus Wohneinrichtungen heraus wiederum schwer geknüpft und gepflegt werden.24 Es fehlen Rückzugsorte und Wohnmöglichkeiten für Paare und Familien. Besondere Wohnformen bergen zudem ein erhöhtes Risiko von (sexualisierten) Grenzverletzungen und Gewalt. Starre Organisationslogiken (z. B. feste Essens-, Schlafens-, Ausgeh- und Besuchszeiten) reproduzieren und verfestigen die (sexuelle) Fremdbestimmung, die zur immanenten biografischen Erfahrung der Menschen wird.25
Der wichtigste Schritt zur Förderung der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen besteht folglich darin, anzuerkennen, dass auch Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten und hohem Unterstützungsbedarf in der eigenen Wohnung leben können, wenn sie Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten und persönliche Assistenz erhalten. Die Leistungsträger der Eingliederungshilfe, die Mitarbeitenden von Einrichtungen und Diensten und rechtliche Betreuer*innen sind aufgefordert, Art. 19 UN-BRK Geltung zu verschaffen, d. h. dazu beizutragen, dass »Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben« (Art. 19 lit. (a) UN-BRK).
Ein weiterer Schritt besteht in der Anerkennung, dass sexuelle Autonomie, wie Holzleithner zutreffend feststellt, einen kontinuierlichen Prozess von Gelingen und Scheitern beschreibt: »Es geht um das Herstellen einer Balance zwischen eigenen und fremden Bedürfnissen, die Wachheit und Aufmerksamkeit erfordern. (...) Dieser Prozess ist von Kind an sensibel zu begleiten (...).« (Holzleithner 2017). Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung umfasst daher auch das Recht, unklug zu handeln und sich dabei gegebenenfalls selbst zu schädigen. Das Gebot der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen schließt ihre Teilhabe an Risiken mit ein. Mit dem Risiko zu Scheitern geht wiederum die Chance einher, aus Fehlern zu lernen.
Rechtliche Betreuer*innen und die Leitungsverantwortlichen und Mitarbeitenden besonderer Wohnformen sehen sich oft daran gehindert, die Freiheitsrechte von Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten zu respektieren, weil sie sich umfassend für deren (so verstandenes) Wohl verantwortlich fühlen. Das nachfolgende Zitat aus dem Interview mit einer Leitungsverantwortlichen Person aus der Eingliederungshilfe zeigt, dass hinter dem Bedürfnis der Fürsorge allerdings vielfach die Selbstsorge steht – d. h. der Wunsch der Betreuungspersonen, nicht für mögliche Schäden haftbar gemacht zu werden.
»Die dürfen zusammen in einem Zimmer übernachten, wobei wir da halt natürlich die Verhütungsfrage sicherstellen müssen. Und natürlich an unsere Grenzen kommen, wenn die Eltern jetzt zum Beispiel keine Verhütungsmittel möchten. Wobei wir den Fall nicht haben. Aber wäre das so, dass jetzt ein Elternteil sagen würde, ›Das möchte ich nicht‹, dann können wir natürlich nicht mehr guten Gewissens sagen, die sollen in einem Bett schlafen. Weil wer will dann da die Verantwortung tragen. Also das müsste man zumindest mit der gesetzlichen Betreuung klären.«26
Die interviewte Führungskraft richtet vorliegend die Organisationslogik nicht an den Rechten, Bedürfnissen und Bedarfen der behinderten Person aus, sondern an ihrem eigenen Bedürfnis, keine Verantwortung für mögliche Konsequenzen des »zusammen in einem Zimmer Übernachtens« übernehmen zu wollen. Ihr Fokus auf (Schwangerschafts-)Verhütung legt nahe, dass sie fürchtet, für die Schwangerschaft einer Bewohner*in haftbar gemacht werden zu können.27 Betreuungspersonen sind aber rechtlich weder verpflichtet noch tatsächlich in der Lage, Menschen vor allgemeinen Lebensrisiken zu bewahren.28
Eine Haftung droht der Leitungsperson hier allenfalls durch Kompetenzüberschreitung: Sie hält sich für ermächtigt, erwachsenen Menschen mit Behinderungen Besuche erlauben und verbieten zu können und deren sexuellen Kontakte an die Bedingung der Verhütung zu knüpfen zu dürfen und agiert in einer Weise, die dem gesetzlichen Auftrag ihrer Organisation diametral entgegensteht. Sie geht fälschlich davon aus, dass rechtliche Betreuer*innen anstelle der Betreuten darüber zu entscheiden hätten, ob bzw. unter welchen Bedingungen sie Besuch empfangen und sexuelle Beziehungen eingehen können. Sie hält sich daher möglicherweise für befugt, Informationen über das Sexualleben der Bewohner*innen an die rechtlichen Betreuer*innen weiterzugeben. Ohne Einwilligungen der Betroffenen könnte diese Weitergabe aber sowohl datenschutzrechtliche als ggf. auch strafrechtliche Konsequenzen (§ 203 StGB) nach sich ziehen.
Äußerungen wie die der Leitungsperson geben Anlass, nachfolgend eingehender die Ziele und Handlungsmaxime der rechtlichen Betreuung einerseits, die Schutzverantwortung und Befugnisse der Träger besonderer Wohnformen andererseits zu beleuchten.
Rechtliche Betreuung im Kontext von Sexualität und Partner*innenschaft
Volljährige Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten sind grundsätzlich selbst für sich verantwortlich und in aller Regel auch uneingeschränkt geschäftsfähig.29 Können Volljährige ihre Angelegenheiten krankheits- und behinderungsbedingt nicht alleine rechtlich regeln und haben sie für diesen Fall keine Vorsorgevollmacht erteilt, soll das Betreuungsgericht ihnen erforderlichenfalls eine rechtliche Betreuung an die Seite stellen (§ 1814 BGB).
Aufgabe der rechtlichen Betreuer*innen ist es, die Betreuten darin zu unterstützen, ihre Angelegenheiten rechtlich so zu besorgen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nach eigenen Wünschen gestalten können (§ 1821 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BGB). Hierzu leisten die rechtlichen Betreuer*innen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Von ihrer Vertretungsmacht (§ 1823 BGB) dürfen sie nur Gebrauch machen, wenn die Betreuten nicht (rechtzeitig) mittels Unterstützung in die Lage versetzt werden können, ihre Angelegenheit selbst zu regeln. Die Betreuer*innen müssen dann anstelle der Betreuten deren Wünschen oder – wenn diese nicht zu ermitteln sind – ihrem mutmaßlichen Willen Geltung verschaffen (§ 1821 Abs. 2 BGB).
Kein Einfluss rechtlicher Betreuer*innen auf das Sexualleben der Betreuten
Anders als einst die Vormundschaft für Erwachsene oder die Personensorge für Minderjährige ist die rechtliche Betreuung keine Betreuung in der allgemeinen Lebensführung, sondern reine Rechtsfürsorge: Die Betreuer*innen erhalten vom Betreuungsgericht klar eingegrenzte Aufgabenkreise zugewiesen, innerhalb der sie die Betreuten bei bestimmten, rechtlich zu besorgenden Angelegenheiten unterstützen sollen, also z. B. beim Abschluss von Verträgen und in behördlichen Verfahren.30
Sexualität ist keine rechtlich zu besorgende Angelegenheit. Sie ist dem Einfluss der rechtlichen Betreuer*innen ebenso entzogen wie alle anderen Bereiche der alltäglichen Lebensführung, z. B. die Entscheidungen der Betreuten, wie sie sich ernähren, ihre Freizeit gestalten, wie sie welche Medien nutzen und mit wem sie Umgang pflegen.
Rechtlich zu besorgen sind im Kontext von Sexualität und Partnerschaft allenfalls finanzielle Angelegenheiten wie z. B. der Erwerb von Sextoys und pornografischem Material oder die vertragliche Vereinbarung sexueller Dienstleistungen. Ist rechtlichen Betreuer*innen vom Gericht der Aufgabenkreis »Vermögenssorge« übertragen und umfasst dieser auch die Anschaffung entsprechender Waren und Dienstleistungen, haben sie, soweit dies erforderlich erscheint, die Betreuten zu beraten, wie sie ausreichend Geld für die geplanten Ausgaben ansparen oder in anderer Weise beschaffen können. Ob es ihnen die einmalige Inanspruchnahme von Sexualbegleitung wert ist, auf den geplanten Kurzurlaub oder die regelmäßigen Kinobesuche zu verzichten, entscheiden alleine die Betreuten.
Rechtlich zu besorgen sind auch der Rechtsschutz vor sexueller Diskriminierung und Gewalt und die Geltendmachung der sich hieraus ergebenden Rechte, z. B. Anträge auf Schutzanordnungen und Wohnungszuweisungen auf Grundlage des Gewaltschutzgesetzes, die Entscheidung, nach einer Sexualstraftat anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, Strafantrag zu stellen oder Leistungen der sozialen Entschädigung zu beantragen, die Geltendmachung von Schmerzensgeldansprüchen sowie Ansprüchen gegen Arbeitgeber*innen oder Werkstattleitungen auf Schutz vor sexueller Belästigung (§ 3 Abs. 4 AGG) oder die Sicherung der anwaltlichen Vertretung einer betreuten Person, die der sexuellen Diskriminierung oder Gewalt verdächtigt wird.
Aufenthalts- und Umgangsbestimmung durch rechtliche Betreuer*innen?
Ist rechtlichen Betreuer*innen der Aufgabenbereich »Aufenthaltsbestimmung« übertragen, sind damit alleine rechtsgeschäftliche Veränderungen des Aufenthalts gemeint, z. B. die Ummeldung des Wohnsitzes, nicht aber – wie im Bereich der Personensorge für Minderjährige – die Entscheidung, wo sich die betreute Person vorübergehend aufhält. Auf den persönlichen Umgang der Betreuten, d. h. die Entscheidung, wann, wie und mit wem sie soziale, einschließlich sexuelle Kontakte pflegen, dürfen rechtliche Betreuer*innen nur Einfluss nehmen, wenn das Betreuungsgericht sie hierzu ausdrücklich ermächtigt (§ 1815 Abs. 2 Nr. 4 BGB) und die betreute Person dies selbst wünscht – z. B. weil sie sich selbst gegen aufgedrängte Kontakte oder Besuche nicht wehren kann (§ 1834 Abs. 1 1. Alt. BGB).
Gegen oder ohne den Willen der Betreuten kommt eine Umgangsbestimmung gem. § 1834 Abs. 1 2. Alt BGB nur in Betracht, wenn eine konkrete und erhebliche Gefährdung im Sinne des § 1821 Abs. 3 Nr. 1 BGB droht, die die betreute Person selbst nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. Bejaht wird dies in Rechtsprechung und Literatur z. B., wenn abhängigkeitserkrankte Menschen vor dem Kontakt mit Dealern bewahrt werden sollen,31 sich Betreute beeinträchtigungsbedingt nicht gegen eine*n sie misshandelnde*n Partner*in wehren können,32 oder sie von Angehörigen psychisch massiv in einer sie gesundheitlich konkret schädigenden Weise unter Druck gesetzt werden.33 Rechtliche Betreuer*innen können die Betreuten aber nicht daran hindern, bei Bekannten zu übernachten und dort Alkohol zu konsumieren34 oder sich bei einvernehmlichen, sexuellen Kontakten der Gefahr einer Schwangerschaft auszusetzen.35 Milderen Mitteln ist bei gleicher Eignung stets der Vorzug vor einer Umgangsregelung zu geben. Hier kommen vor allem Maßnahmen zur Stärkung der Selbstschutzkompetenz, z. B. durch Fachberatungsstellen, therapeutische Begleitung und Selbstbehauptungstrainings in Betracht. Sie wirken nicht so schnell, dafür aber nachhaltiger als Umgangsverbote. Nötigenfalls kann der erforderliche Schutz ergänzend vorübergehend durch die Anwesenheit Dritter (»begleiteter Umgang«) bewirkt werden.36
Lässt sich eine Person mit anderen Lernmöglichkeiten von dem bzw. der sie manipulierenden Partner*in regelmäßig ihre knapp bemessenen Einkünfte abnehmen, hätte das Gericht vorrangig einen Einwilligungsvorbehalt nach § 1825 BGB zu prüfen.
Die genannten Grenzen der Einflussnahme der Betreuungsperson auf Umgangskontakte der Betreuten gelten auch für Kontakte mittels sozialer Medien.37 Ohne konkrete Ermächtigung des Gerichts dürfen rechtliche Betreuer*innen den Betreuten weder das Handy abnehmen, noch ohne oder gegen ihren Willen mittels technischer Einstellungen ihre Umgangskontakte beschränken, § 1815 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 BGB.38
Vorrang sozialer vor rechtlicher Betreuung
Die Ausführungen machen die weitreichenden Unterschiede zwischen der früheren Vormundschaft und der rechtlichen Betreuung deutlich. Diese wurden bislang in der Praxis jedoch vielfach ignoriert. Dazu hat auch die im Sozialwesen verbreitete Bezeichnung der rechtlichen Betreuung als »gesetzliche« Betreuung beigetragen, weil sie deren Charakter der personenzentrierten Rechtsfürsorge verschleiert.
Um dem entgegen zu wirken und sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gemäß Art. 12 UN-BRK ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen verwirklichen können, hat der Gesetzgeber das Betreuungsrecht zum 1. 1. 2023 reformiert.39 Der Erforderlichkeitsgrundsatz wurde noch stärker hervorgehoben und die Gerichte verpflichtet, die Aufgabenkreise des Betreuer*innen eng zu fassen und genau auf die konkreten Belange des Betroffenen abzustimmen (§ 1815 Abs. 1 BGB). Eine Betreuung in allen Angelegenheiten oder die Übertragung der Personensorge ist nicht mehr zulässig, entsprechende Betreuer*innenbestellungen sind bis zum 1. 1. 2024 zu ändern.40Das Gesetz begrenzt die Tätigkeit der Betreuer*innen nicht nur auf die Rechtsfürsorge, sondern auch auf das erforderliche Maß, § 1814 Abs. 3 BGB. Kann die betreute Person die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung auch durch eine Fachberatungsstelle, ihre persönliche Assistenz, andere Mitarbeitende der Eingliederungshilfe oder Personen aus ihrem persönlichen Umfeld erhalten, ist die Einbeziehung der rechtlichen Betreuung nicht erforderlich. Dieser Vorrang sozialer Unterstützung vor rechtlicher Betreuung ist nicht nur bei der Einrichtung der Betreuung durch das Gericht zu beachten, sondern prägt – wie im Zuge der Reform in § 17 Abs. 4 SGB I klargestellt wurde – auch das Verhältnis zwischen den Mitarbeiter*innen sozialer Einrichtungen und Dienste und den rechtlichen Betreuer*innen.41
Rechtliche Betreuung ist in erster Linie Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
Anstelle der Betreuten können rechtliche Betreuer*innen nur entscheiden, wenn sie es den Betreuten also nicht (rechtzeitig) im Wege der unterstützten Entscheidungsfindung ermöglichen können, ihre Angelegenheit selbst zu regeln. Zur unterstützten Entscheidungsfindung gehört es, dass die rechtlichen Betreuer*innen den Betreuten die Sach- und Rechtslage neutral und ggf. in Leichter Sprache oder im Wege der unterstützten Kommunikation erklären, ihnen alle Entscheidungsoptionen mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigen und Gelegenheit zu geben, sich entsprechend ihrer eigenen Präferenzen und Wertvorstellungen für eine dieser Optionen zu entscheiden. Soweit die Betreuten keine Wünsche artikulieren (oder ihr Umfeld ihre Mitteilungen nicht entsprechend zu deuten vermag), haben rechtliche Betreuer*innen gemäß § 1821 Abs. 4 BGB ihren mutmaßlichen Willen zu ermitteln, um diesem Geltung zu verschaffen. Der mutmaßliche Wille ist anhand konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln und hierzu ggf. das soziale und professionelle Umfeld der Betreuten einzubeziehen: Lassen frühere Äußerungen bzw. Reaktionen oder ihre ethischen oder religiösen Überzeugungen Rückschlüsse zu, was sie jetzt in der aktuellen Situation wünschen?
Artikulieren die Betreuten Wünsche, sind diese grundsätzlich auch dann handlungsleitend, wenn sie den rechtlichen Betreuer*innen unerfüllbar,42 unvernünftig oder sogar selbstschädigend erscheinen. Eine drohende Selbstschädigung ist gemäß § 1821 Abs. 3 BGB allenfalls beachtlich, wenn sie erheblich ist, die betreute Person dies aber beeinträchtigungsbedingt nicht, auch nicht mit Unterstützung, erkennen kann. In einem solchen Fall haben sich die rechtlichen Betreuer*innen gem. § 1821 Abs. 4 BGB nicht länger an einem »objektiven Wohl« der Betreuten zu orientieren (wie es bis 31. 12. 2022 § 1901 BGB noch vorsah), sondern an ihrem eben skizzierten mutmaßlichen Willen.43
Die Verwirklichung der Wünsche der Betreuten ist rechtlichen Betreuer*innen gem. § 1821 Abs. 3 Nr. 2 BGB ausnahmsweise nur dann nicht zumutbar, wenn sie diese zur Unzeit erledigen sollen (z. B. nachts) oder sich die Betreuer*innen dadurch haftbar oder strafbar machen würden.44 Es ist ihnen aber zumutbar, Angelegenheiten der Betreuten in einer Weise zu erledigen, die ihren eigenen Vorstellungen von Partnerschaft oder Sexualität widerspricht.45 Sehen sich rechtliche Betreuer*innen aus innerer Überzeugung nicht in der Lage, sich an den Wünschen der Betreuten zu orientieren, liegt kein Fall der Unzumutbarkeit, sondern eine mangelnde Eignung für die Betreuung – zumindest dieser Angelegenheit – und damit ein Grund für einen (partiellen) Betreuer*innenwechsel vor.46
Eltern als rechtliche Betreuer*innen
Für Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten werden oft die Eltern zu ihren rechtlichen Betreuer*innen bestellt. Dies birgt das Risiko, dass beide Seiten das Erziehungsverhältnis fortsetzen,47 während andere Generationen in dieser Lebensphase die Ablösung, Individuation und Transition durchlaufen können.48 Um in ein rechtliches Betreuungsverhältnis zu finden, müssen sie ein anderes Rollenverständnis und Verhältnis zueinander entwickeln. Hier können Betreuungsvereine und -behörden ggf. beratend tätig werden. Denn Studien zeigen, dass ehrenamtliche Betreuer*innen und die von ihnen betreuten Menschen bisher oft nur unzureichend über Ziele und Handlungsmaxime der rechtlichen Betreuung informiert sind.49 Die Fachkräfte der Eingliederungshilfe können einen Beitrag leisten, in dem sie sowohl für die behinderten Adressat*innen als auch für die Angehörigenbetreuer*innen Informations-, Reflexions- und Austauschmöglichkeiten mit Peers schaffen.50
»Aber wenn die Betreuerin ihn dann aus der Einrichtung nimmt?«
Bei Konflikten zwischen Betreuten und rechtlichen Betreuer*innen sehen Mitarbeitende der Eingliederungshilfe die Betreuer*innen oft am längeren Hebel, da diese die Betreuten ja aus der Einrichtung nehmen könnten.51 Die Macht, Betreute im Konfliktfall ohne oder gegen ihren Willen zum Umzug zu veranlassen, haben rechtliche Betreuer*innen aber allenfalls faktisch, nicht rechtlich. Finden sich konkrete Anhaltspunkte, dass sie ihre Kompetenzen überschreiten und ihre Macht missbrauchen, hat das Betreuungsgericht auf entsprechenden Hinweis hin die Pflichtwidrigkeit von Amts wegen aufzuklären und bei Bedarf geeignete aufsichtsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Betreuten zu ergreifen (§ 1862 BGB).52Entsprechende Hinweise können auch aus dem sozialen und professionellen Umfeld der Betreuten kommen,53 sollten aber zuvor mit ihnen abgestimmt werden.
Je nach Sachlage kann das Gericht im Falle pflichtwidrigen Verhaltens Ge- oder Verbote aussprechen, der Betreuungsperson einzelne Aufgabenbereiche entziehen und auf eine andere Person übertragen. Äußerstenfalls kann das Gericht die Betreuungsperson entlassen (§ 1868 BGB).
Um eine Eskalation von Konflikten zu vermeiden, empfiehlt es sich, frühzeitig anerkannte Betreuungsvereine bzw. die Betreuungsbehörde zu kontaktieren. Diese bieten Beratung und Unterstützung an, §§ 5, 8 und 15 Abs. 1 Nr. 3 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG).
Sexualität und Partnerschaft in der Eingliederungshilfe: Zwischen Ermöglichung und Schutz
Liest man vor dem betreuungsrechtlichen Hintergrund nochmals die Aussagen der oben zitierten Leitungskraft, wird deutlich, dass die Verantwortung für die Entscheidung, solo oder mit anderen Sex zu haben, alleine bei den Bewohner*innen und nicht bei deren rechtlichen Betreuer*innen liegt. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Barrieren abzubauen, die Menschen mit Behinderungen daran hindern, Sexualität alleine oder mit anderen möglichst selbstbestimmt und sicher pflegen zu können und ggf. ergänzend Assistenz zu leisten (dazu unten). »Sicher« bedeutet, dass sie sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaften schützen können, wenn sie es wollen. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung umfasst aber wie bei allem Menschen auch die Entscheidung, erkannte gesundheitliche Risiken in Kauf zu nehmen oder bewusst eine Schwangerschaft anzustreben. Es liegt daher keinesfalls in der Verantwortung eines Einrichtungsträgers, Schwangerschaften generell zu verhindern; seine Aufgabe ist es vielmehr, es den Bewohner*innen zu ermöglichen, sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften zu schützen – durch Sicherung ihres Zugangs zu sexueller Bildung, zu Verhütungsmitteln und unabhängiger Beratung durch spezialisierte Sexual-, Familien-, und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.54
Eine Haftung des Einrichtungsträgers, wie sie die interviewte Leitungsperson befürchtet, kommt nur in Betracht, wenn er den Bewohner*innen entsprechende Unterstützung vorenthält und die Bewohner*innen dadurch einen Schaden erleiden.
In besonderen Wohnformen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) gehen viele Fachkräfte rechtsirrtümlich davon aus, sie seien verpflichtet und auch berechtigt, laufend general-präventiv in die Freiheit der behinderten Nutzer*innen einzugreifen, um sie vor Gewalt, anderen leidvollen Erfahrungen oder Schwangerschaften zu bewahren oder zu verhindern, dass sie Dritte schädigen. Möglicherweise denken sie auch, für alle Schäden haftbar gemacht werden zu können, die sich die Nutzer*innen selbst oder anderen zufügen.
Schutzverantwortung und Haftungsrisiken
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind die Träger von Einrichtungen und Diensten bzw. deren Mitarbeitende weder verpflichtet noch berechtigt, alle nur denkbaren Sicherungsvorkehrungen zu treffen, um die Nutzer*innen ihres Angebots vor Schäden zu bewahren und sie ständig zu überwachen.55 Ob sie neben oder anstelle der Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten für Schäden haftbar gemacht werden können, richtet sich danach, ob sie (ggf. schuldhaft) gegen eine ihnen obliegenden Schutzpflicht verstoßen haben. Dabei lassen sich drei Kategorien unterscheiden: Organisations- und Verkehrssicherungspflichten, vertragliche Obhutspflichten und gesetzliche Schutzpflichten.
Im Rahmen ihrer Organisations- und Verkehrssicherungspflichten haben die Träger von Einrichtungen und -dienste ihre Infrastruktur und Betriebsabläufe so zu gestalten, dass Nutzer:innen und Beschäftigte möglichst nicht zu Schaden kommen.56 Zu den typischen und zu vermeidenden Betriebsrisiken zählen neben baulichen, technischen oder Hygienemängeln auch das institutionell bedingte Risiko von Verletzungen der Privatheit der Bewohner*innen, rechtswidrige Freiheitsbeschränkungen, Grenzverletzungen und Gewalt. So müssen die Träger besonderer Wohnformen dafür Sorge tragen, dass die Bewohner*innen ihre Privaträume bestmöglich vor ungewollten Besucher*innen schützen können. Eine Haftung kommt in Betracht, wenn sie sexualisierte Übergriffe auf Bewohner*innen durch den Einbau eines Schließsystem hätten verhindern können oder grenzverletzendes Verhalten von Nutzer*innen beobachtet, aber in Folge keine Maßnahmen ergriffen haben, um erneuten Übergriffe vorzubeugen.
Aus der Tatsache, dass Menschen in 24/7-Einrichtungen leben, folgt nicht, dass die Mitarbeitenden sie 24/7 Stunden beaufsichtigen müssten. Ob und in welchem Umgang eine Aufsichtspflicht für Minderjährige oder Obhutspflicht für Erwachsene besteht, richtet sich nach der vertraglichen Vereinbarung, die die Personensorgeberechtigten der Minderjährigen bzw. die erwachsenen Nutzer*innen (ggf. vertreten durch ihre rechtlichen Betreuer*innen) mit den Trägern der Dienste und Einrichtungen geschlossen haben. Zur Frage, wann und mit welchen Mitteln die Träger und ihre Mitarbeitenden dieser Pflicht nachzukommen haben, gibt es inzwischen einige Rechtsprechung. Bezogen auf Erwachsene bejahen die Gerichte eine vertragliche Obhutspflicht der Träger und ihrer Mitarbeitenden nur in Situationen der konkreten, gegenwärtigen Gefahr und soweit die Nutzer*innen beeinträchtigungsbedingt außerstande sind, diese Gefahr zu erkennen und sich risikoadäquat zu verhalten.57 Bloße Mutmaßungen, wonach der dominant auftretende Freund einer Bewohnerin diese zu sexuellen Handlungen bewegen könnte, die sie eigentlich nicht will, rechtfertigen es daher nicht, schützend und regulierend in ihre Beziehung einzugreifen. Sie geben aber Anlass für Gesprächsangebote und zur Ermutigung der Bewohner*in, sich selbst und damit ihre Grenzen zu achten und zu verteidigen.
Mitarbeitende müssen also lediglich dort schützend eingreifen, wo die von ihnen unterstützten Menschen sich oder andere konkret gefährden oder sie konkret von anderen gefährdet werden. Geschuldet sind nur solche Schutzmaßnahmen, die den behinderten Menschen und den Mitarbeitenden zumutbar und von den Trägern mit einem vernünftigen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar sind.58 Die Schutzmaßnahmen müssen mit dem Auftrag und Ziel der Eingliederungshilfe, die Selbstbestimmung und volle und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen zu fördern, vereinbar sein.«59 Die Mitarbeitenden können nur solche Schutzmaßnahmen ergreifen, zu denen sie auch legitimiert sind. Zwang – beginnend vom Verbot bis hin zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und körperlicher Gewalt – ist kein legitimes Mittel der Eingliederungshilfe. Er kann allenfalls gerechtfertigt sein, wenn die Betreffenden hiermit einverstanden sind oder der Eingriff zur Abwendung eines gegenwärtigen körperlichen Angriffs im Rahmen der Notwehr oder Nothilfe (§ 32 StGB) erforderlich oder von einer gerichtlichen Genehmigung (z. B. nach § 1631b Abs. 2 BGB, § 1831 Abs. 4 BGB) gedeckt ist.
Dass Menschen nicht zwangsweise, und damit u. U. nicht sofort und jederzeit davon abgehalten werden können, sich oder andere (mutmaßlich) zu gefährden und zu schädigen, konfrontiert diejenigen, die sich für ihren Schutz verantwortlich fühlen, mit ihrer eigenen Ohnmacht. Die Selbstbestimmung der Beteiligten zu achten, bedeutet aber nicht, sich der professionellen und institutionellen Schutzverantwortung zu entziehen.
Aufgabe und Kompetenz sozialer Einrichtungen und Dienste ist es, Gefährdungen langfristig durch Maßnahmen vorzubeugen, die bei den Ursachen der Gefahr bzw. des gefährdenden Verhaltens ansetzen und nachhaltig wirken. Zwang zielt lediglich auf die Unterdrückung der Symptome und befördert vielfach einen Kreislauf der Gewalt. Um langfristige Änderungen zu bewirken, gilt es, die strukturellen, situativen und individuellen, z. B. biografischen Entstehungsbedingungen in den Blick zu nehmen, die Menschen herausfordern, sich und andere in bestimmten Situationen zu gefährden. Gewaltfördernde Strukturen müssen umgestaltet, die Mitarbeitenden qualifiziert werden. Bildung, Beratung, Training und ggf. Therapie eröffnen auch den Adressat*innen ggf. Wege, sich und anderen achtsamer zu begegnen. Können Adressat*innen Gefahren nicht erkennen oder bewältigen, sind Mitarbeitende gehalten, die Gefahrenquellen besser abzusichern und die Adressat*innen im Umgang damit anzuleiten und zu begleiten. Sie sind in aller Regel nicht berechtigt, den Adressat*innen Weisungen zu erteilen, sondern können Regeln allenfalls aushandeln.60
Gesetzliche Schutzpflichten ergeben sich für die Träger besonderer Wohnformen vor allem aus den Landesheimordnungsgesetzen – zu schützen haben sie demnach vor allem die Ehre, die Freiheit, Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit der Betroffenen und hierzu u. a. auch geeignete Maßnahmen zu ihrem Schutz vor Gewalt zu treffen.
Für die Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe ergibt sich diese Pflicht auch aus § 37a SGB IX, für Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, aus § 45 Abs. 2 SGB VIII. Die Schutzpflichten begründen zugleich eine strafrechtliche Garantenstellung (§ 13 StGB). Mit dem Wort »insbesondere« bringt der Gesetzgeber in § 37a SGB IX zum Ausdruck, dass die Schutzmaßnahmen ein Schutzkonzept umfassen müssen, sich aber nicht darin erschöpfen können. Schutzkonzepte sind als fortlaufende Organisationsentwicklungsprozesse zu verstehen. Sie müssen bei den Entstehungsbedingungen der Gewalt ansetzen, den Adressat:innen und Mitarbeitenden aber auch im akuten Gefährdungsfall Handlungssicherheit geben.61 Hierzu gilt es in einem ersten Schritt, gemeinsam mit den Nutzer*innen die organisationsspezifischen Risikofaktoren zu ermitteln und gezielt abzubauen. Ebenso sollte ermittelt werden, welche Ressourcen (Schutzfaktoren) bereits vorhanden sind und wie sie besser genutzt und erweitert werden können. Einen wichtigen Bestandteil bildet auch der Interventionsleitfaden im Umgang mit konkreten Verdachtsmomenten oder akuter Gewalt sowie das interne und externe Beschwerdemanagement.
Das Hausrecht der Bewohner*innen
Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, haben wie andere Mieter*innen auch das Recht, selbst zu bestimmen, wem sie wann und wie lange Zutritt zu ihrem Zimmer gewähren.62 Ihnen steht das Hausrecht an diesen Räumen zu.63 Dies wird in den Heimordnungsgesetzen einiger Länder ausdrücklich hervorgehoben (z. B. in § 11 Abs.2 BlnWTG und § 15 Abs. 1 Nr. 5 LWTG Rheinland-Pfalz), gilt aber gleichermaßen in Bundesländern, in denen dies nicht explizit geregelt ist. Denn Heim- und Hotelzimmer fallen in den Schutzbereich des Grundrechts der Bewohner*innen auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art.13 GG).64Dieses Grundrecht haben Einrichtungen und Dienste freier Träger, wenn sie staatliche Sozialleistungen ausführen, gem. § 1 Abs. 2 SGB I zu achten und zu schützen wie der Staat.
Das Hausrecht der Bewohner*innen umfasst auch ihr Recht, bei Tag und über Nacht Besuche zu empfangen und mit diesen ungestört zu sein. Die Besucher*innen haben sich an die vereinbarten Regelungen des Zusammenlebens (z. B. Nachtruhe) zu halten. Einrichtungsträger haben nicht die Rechtsmacht, Außenstehenden ab einer bestimmten Uhrzeit den Zutritt zum Gebäude zu verweigern.65 Entsprechende Begrenzungen der Besuchszeiten in Verträgen und Hausordnungen sind grundrechtswidrig.66 Teilen sich Bewohner*innen ein Zimmer, üben sie das Hausrecht gemeinsam aus. Können sie sich nicht einigen, kommt dem Einrichtungsträger und seinen Mitarbeitenden eine moderierende Rolle zu.67 Selbst wenn es gelingt, Kompromisse zu finden, so bleiben der Möglichkeit der Einzelnen, in einem mehrfachbelegten Zimmer stundenweise ungestört Besuch zu empfangen, strukturelle Grenzen gesetzt.
Ohne oder gegen den Willen der Bewohner*innen dürfen Besuche vom Träger nur untersagt oder beschränkt werden, wenn dies unerlässlich ist, um eine unzumutbare Beeinträchtigung ihrer Interessen oder der ihrer Mitbewohner*innen bzw. des Einrichtungsbetriebes abzuwenden.68 Dies wäre zu bejahen, wenn z. B. ein Besucher wiederholt trotz Abmahnung das Zusammenleben auf dem Wohnbereich durch lautes Geschrei, Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen der Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen stört,69 oder eine Besucherin die Gesundheit eines Bewohners gefährdet, indem sie ihm seine Medikamente wegnimmt oder die Ernährung über die Sonde unterbricht.70 Aus dem Recht der Bewohner*innen, Besuche zu empfangen, leitet sich nicht die Pflicht der Träger ab, den Besuch zu verpflegen oder ihnen bei Bedarf Assistenz zu leisten. Für Schäden, die Besucher*innen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch der Infrastruktur erleiden, haften Träger von Einrichtungen nur, wenn sie diese durch die Verletzung ihrer Verkehrssicherungspflichten (mit-)verursacht haben. Das wäre z. B. der Fall, wenn Besucher*innen auf verschneiten, aber vom Träger nicht geräumten Zugangswegen stürzen.
Der Schutzbereich des Art.13 GG umfasst auch Gemeinschaftsräume wie das gemeinsame Ess- und Wohnzimmer oder die Wohngruppenküche. Der Träger hat diese Gemeinschaftsräume mitvermietet und die Bewohner*innen haben daher das Recht, sie jederzeit bestimmungsgemäß zu nutzen. Nutzungseinschränkungen sind nur zulässig, wenn sie in einer Hausordnung geregelt sind. Diese muss Bestandteil des Wohn- und Betreuungsvertrags geworden sein. Die Hausordnung unterliegt der Mitbestimmung der Bewohner*innen. Die bestimmungsgemäße Nutzung der Gemeinschaftsräume durch die einzelnen Bewohner*innen darf gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur in dem Maße eingeschränkt werden, wie dies zum Schutz höherrangiger Interessen der Gemeinschaft und ggf. des Trägers erforderlich ist.
Zugang von Sexarbeiter*innen und Sexualbegleiter*innen zu den Wohnräumen
Das durch Art .13 GG gesicherte Recht der Bewohner*innen, frei zu entscheiden, wen sie auf ihren Zimmern empfangen wollen, schließt Sexarbeiter*innen und Sexualbegleiter*innen mit ein. Das gilt auch für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Zwar schützt Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Weimarer Reichsverfassung (WRV) das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften und erstreckt sich die Religionsausübungsfreiheit kirchlicher Träger nach Art. 4 Abs. 2 GG auch auf deren karitative Tätigkeit.71 Die Träger können diese Rechte aber nur innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze – d. h. unter Achtung der Grundrechte der Leistungsberechtigten – ausüben. Zu deren Achtung und Förderung haben sie sich als Sozialleistungserbringer ausdrücklich verpflichtet und erhalten hierfür staatlich Vergütungen.
Liegt die Wohnung assistenzbedürftiger Menschen oder die Einrichtung, in der sie leben, in einem Sperrbezirk, könnten Sexualbegleiter*innen und Sexarbeiter*innen allerdings aus ordnungsrechtlichen Gründen am Besuch der Bewohner*innen gehindert sein. Sperrbezirke können von den Landesregierungen gem. Art. 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch »zum Schutze der Jugend oder des öffentlichen Anstandes« eingerichtet werden.72 Innerhalb der Sperrbezirke ist es verboten, allen oder in den Verordnungen festgelegten Formen der Prostitution nachzugehen. Als Prostitution wird die wiederholte Vornahme sexueller Handlungen gegen Entgelt mit oder vor wechselnden Partner*innen definiert.73 Ob Angebote der aktiven Sexualassistenz/Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderungen als Prostitution einzustufen sind, ist im Einzelfall zu beurteilen.
In den Sperrbezirken verboten werden dürfen nach der Rechtsprechung nur solche Formen der Sexarbeit, von denen zumindest abstrakt eine Jugendgefährdung oder »Belästigungen der Anwohner, milieubedingte Unruhe, das Ansprechen Unbeteiligter sowie das Anfahren und Abfahren der Freier als sichtbare Begleiterscheinungen« ausgehen können.74 Bei der Wohnungsprostitution haben das OVG Saarlouis75 und der VGH Kassel76 eine solch abstrakte Gefahr der öffentlichen Sichtbarkeit verneint. Hausbesuche von Sexualbegleiter*innen und anderen Sexarbeiter*innen in Wohneinrichtungen verlaufen noch unauffälliger in zeitlich großen Abständen. Ihr Verbot käme für Menschen, die ihre Sexualität nur mit Hilfe sexueller Dienstleistungen verwirklichen können, unter Umständen einem generellen Sexverbot gleich, denn für sie wird es oft besonders schwer und kaum finanzierbar sein, geeignete barrierefreie Angebote außerhalb des Sperrbezirks aufzusuchen. Soweit nicht von vornherein die öffentliche Sichtbarkeit zu verneinen ist, so sind in die Abwägung der individuellen Rechtsgüter gegen den öffentlichen Konfrontationsschutz neben der Berufsausübungsfreiheit der Sexarbeiter*innen aus Art. 14 GG77 auch das Grundrecht dieser Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG78 einzubeziehen. Eine entsprechende rechtliche Klarstellung in den Sperrbezirksverordnungen wäre wünschenswert.79
Ist die Sexualassistenz/Sexualbegleitung eine Leistung der Eingliederungshilfe?
Personenzentrierte Assistenz orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Adressat*innen, dies schließt deren sexuelle Bedürfnisse mit ein. Mitarbeitende der Eingliederungshilfe haben Menschen mit Behinderungen bei Bedarf dabei zu unterstützen, soziale, einschließlich sexuelle Beziehungen analog-digital aufzubauen und zu pflegen. Sie haben die Privatheit der Adressat*innen zu achten und zu schützen und ihnen möglichst viel Raum für ungestörte sexuelle Betätigung solo oder mit anderen zu sichern.80 Von Pflegehandlungen, die von den Adressat*innen nicht gewünscht und abgelehnt werden, ist Abstand zu nehmen und nach akzeptablen Alternativen zu suchen (z. B. dem Abbrausen ohne Waschlappen oder dem Einsatz einer anderen Pflegeperson).
Sexualassistenz ist den Mitarbeitenden zur Unterstützung erwachsener Personen erlaubt, soweit sie nicht in eine sexuelle Interaktion einbezogen sind, sondern in anderer Weise, z. B. durch die Beschaffung von Sextoys, Verhütungsmitteln oder die Vermittlung des Kontakts zu potentiellen Sexualpartner*innen »passiv« assistieren.81 Mitarbeitende dürfen auch Jugendlichen Verhütungsmittel und Sextoys beschaffen, ihnen aber keinen Zugang zu Pornografie gewähren (§ 184 StGB). Vermitteln sie ihnen den Kontakt zu Sexarbeiter*innen und Sexualbegleiter*innen, laufen sie Gefahr, gemäß § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB kriminalisiert zu werden.82 Übernachtungen von Jugendlichen bei ihren Liebespartner*innen oder deren Übernachtung bei den Jugendlichen sollten mit den Personensorgeberechtigten abgestimmt werden (§ 180 Abs. 1 Satz 2 StGB). Diese haben alle Entscheidungen, die ihre Kinder betreffen, alters- und entwicklungsgerecht mit diesen zu besprechen und Einvernehmen anzustreben (§ 1626 Abs. 2 BGB). Ihr Sorgerecht ist ein pflichtgebundenes Recht, das sie nur zum Wohle der Kinder ausüben dürfen (§ 1627 BGB).
Von der Frage, ob passive Sexualassistenz in einem institutionalisierten Unterstützungsverhältnis straffrei erbracht werden kann, zu unterscheiden sind die Fragen, ob die Einrichtungen und Dienste diese auf Wunsch der behinderten Menschen hin erbringen müssen und sie in diesem Falle die einzelnen Mitarbeitenden auch zur passiven Sexualassistenz verpflichten können. § 78 Abs. 2 SGB IX sichert eingliederungshilfeberechtigten Menschen auch in besonderen Wohnformen das Recht, selbst auf der Grundlage ihres Teilhabe- bzw. Gesamtplans zu entscheiden, wie ihre Assistenz durch die Mitarbeitenden konkret hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt gestaltet werden soll. Zudem müssen die Eingliederungshilfeträger ihnen die im Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden Assistenzleistungen (§ 113 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX) im Bereich der Gestaltung sozialer Beziehungen und der persönlichen Lebensplanung gem. § 104 Abs. 3 Satz 4 SGB IX auf Wunsch als rein personenzentrierte Assistenz nur an die Leistungsberechtigten und nicht gleichzeitig an weitere Mitbewohner*innen erbringen, d. h. auch den damit einhergehenden höheren Personalaufwand finanzieren.
Haben damit alle Mitarbeitende, die in der Eingliederungshilfe Assistenz im Bereich des Wohnens erbringen, auf Wunsch der Leistungsberechtigten hin auch passive Sexualassistenz zu leisten? Das ist vor dem Hintergrund der vorgegangenen Ausführungen grundsätzlich zu bejahen. Gleichzeitig können Beschäftigte von ihren Arbeitgeber*innen verlangen, am Arbeitsplatz nicht mit unerwünschten sexuellen Handlungen, Äußerungen und pornografischen Abbildungen konfrontiert zu werden (§ 7 Abs.1 iVm §§ 1, 3 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]). Wer sich jedoch als Arbeitsplatz das Schlafzimmer anderer Menschen wählt, kann nicht erwarten, dort gänzlich von deren Intimleben verschont zu werden. Die Professionalität der Mitarbeitenden gebietet es daher, sich kritisch mit den eigenen Widerständen auseinanderzusetzen. Eine Grenze ihrer Pflicht zur passiven Sexualassistenz dürfte dann zu ziehen sein, wenn Grenzverletzungen drohen oder sie Leistungsberechtigte bei der Auswahl von Pornos unterstützen und sich diese hierzu mit ansehen müssten. Solche Aufgaben sollten nur Mitarbeitenden übertragen werden, die hierzu freiwillig bereit sind. Zudem sind Mitarbeitende nicht zu strafbaren Handlungen verpflichtet und müssen Leistungsberechtigten daher z. B. keinen Zugang zu Missbrauchsabbildungen (sog. Kinder- oder Jugendpornografie) verschaffen.
Zur aktiven Assistenz gehört die Hilfe beim Solosex, die Anleitung bei der Nutzung von Sextoys oder die Unterstützung eines mobilitätsbehinderten Paares bei der sexuellen Begegnung. In einem laufenden Aufsichts-, Beratungs-, Betreuungs-, und Behandlungsverhältnis können diese Handlungen den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs nach §§ 174, 174a Abs. 2 StGB und § 174c Abs. 1 und 2 StGB erfüllen. Denn das Einverständnis der behinderten Person lässt den Vorwurf der Missbräuchlichkeit der sexuellen Handlungen in der professionellen Beziehung nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) nur entfallen, wenn sich die Beteiligten auf Augenhöhe begegnet sind 83 und eine professionelle Vertrauensbeziehung entweder nicht entstanden ist oder aber für die sexuellen Handlungen ohne Bedeutung war.84 Die Strafbarkeit richtet sich damit entscheidend nach dem Charakter der Assistenz: In Wohneinrichtungen sind die Bewohner*innen in hohem Maße von den Mitarbeitenden abhängig. Sie können entscheiden, wann sie Bewohner*innen auf der Toilette oder bei der Kommunikation mit Außenstehenden helfen. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist vom Gesetzgeber zwar vorgesehen,85 strukturell bedingt aber nicht gegeben. Die Abhängigkeit kann nur überwunden werden, wenn Menschen mit Behinderung – z. B. im sogenannten Arbeitgeber*innenmodell – tatsächlich die Auswahl-, Anleitungs- und Organisationskompetenz über ihre Assistenz erlangen (»Persönliche Assistenz«). In einem solchen Setting wird aktive Sexualassistenz regelmäßig keinen rechtlichen Bedenken begegnen, in allen anderen Settings sollte sie nur von externen Dienstleister*innen erbracht werden.
Soweit Menschen mit Behinderungen sexuelle Dienstleistungen von Sexarbeiter*innen und Sexualbegleiter*innen in Anspruch nehmen, diese aber nicht aus dem eigenen Einkommen und Vermögen finanzieren können, wird streitig diskutiert, ob auch diese Kosten vom Staat finanziert werden können und müssen. Dabei geht es nicht um »Sex auf Krankenschein«, sondern um die Frage, ob entsprechende Leistungen über die Grundsicherung (SGB II/SGB XII) oder als Leistungen der sozialen Teilhabe von den Trägern der Unfallversicherung, sozialen Entschädigung, der Eingliederungshilfe oder – für junge Erwachsene mit seelischer Behinderung – der Kinder- und Jugendhilfe finanziert werden können.
In die Kalkulation der pauschalierten Regelbedarfe in der Grundsicherung wurden Ausgaben für sexuelle Dienstleistungen nicht einbezogen.86





























