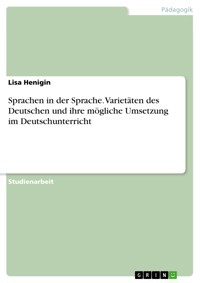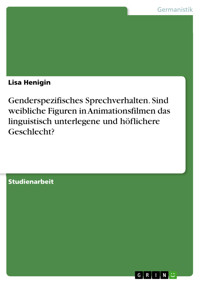Sexuelle Vielfalt im Deutschunterricht. Bedeutung und Möglichkeiten der Thematisierung von sexueller Vielfalt in der Schule E-Book
Lisa Henigin
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Homophobie und Diskriminierung sind noch immer gesellschaftliche Phänomene. Diskriminierende Handlungen und Äußerungen können im Alltag, in Liedtexten, Filmen, Büchern, Zeitschriften, aber auch auf Schulhöfen und in Klassenräumen vorkommen. Lisa Henigin untersucht in ihrer Publikation deshalb, wie Lehrerinnen und Lehrer im Literaturunterricht sexuelle Vielfalt thematisieren können. Welche kinder- und jugendliterarischen Werke eignen sich dazu? Und wie setzt man sie im Deutschunterricht richtig ein? Vor allem in der Schule befinden sich die Jugendlichen in einer Lebensphase, in welcher Diskriminierung langfristige Folgen haben kann. Henigin erklärt deshalb, wie gerade die Schule als Lernort und Lebensraum zu einem von Akzeptanz geprägten Miteinander beitragen kann. Aus dem Inhalt: - Sexuelle Vielfalt; - Homosexualität; - LGBTIQ; - Deutschunterricht; - Kinder- und Jugendliteratur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Anmerkung
2 Einleitung
3 Überblick über das Themenfeld der sexuellen Vielfalt
3.1 Geschlechtervielfalt
3.2 Sexuelle Orientierung
3.3 Heteronormativität
3.4 ‚Phobien‘ und Diskriminierung
3.4.1 Homophobie und Trans*phobie
3.4.2 Diskriminierung
3.4.2.1 Diskriminierung von LGBTIQ*-Personen im schulischen Umfeld
4 Stellenwert sexueller Vielfalt in schulischen Richtlinien
4.1 Überblick über die Thematisierung durch die Länder
4.1.1 Baden-Württemberg
4.1.2 Bayern
4.1.3 Berlin und Brandenburg
4.1.4 Bremen
4.1.5 Hamburg
4.1.6 Hessen
4.1.7 Mecklenburg-Vorpommern
4.1.8 Niedersachsen
4.1.9 Nordrhein-Westfalen
4.1.10 Rheinland-Pfalz
4.1.11 Saarland
4.1.12 Sachsen
4.1.13 Sachsen-Anhalt
4.1.14 Schleswig-Holstein
4.1.15 Thüringen
4.2 Deutschlehrpläne: Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Vergleich
4.2.1 Rheinland-Pfalz
4.2.2 Baden-Württemberg
5 Sexuelle Vielfalt im Deutschunterricht: Eine Umfrage unter Lehrkräften und Studierenden
5.1 Wahl der Methode
5.2 Auswertung der Umfrage unter Lehrkräften
5.2.1 Persönliche Einstellungen
5.2.2 Bisherige Thematisierung von sexueller Vielfalt
5.2.3 Interesse bezüglich zukünftiger Thematisierung von sexueller Vielfalt
5.2.4 Stellungnahme zu kinder- und jugendliterarischen Werken
5.3 Auswertung der Umfrage unter Studierenden
5.3.1 Persönliche Einstellung zu sexueller Vielfalt
5.3.2 Thematisierung von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht zur eigenen Schulzeit
5.3.3 Interesse bezüglich zukünftiger Thematisierung von sexueller Vielfalt
5.3.4 Stellungnahme zu kinder- und jugendliterarischen Werken
5.4 Fazit
6 Möglichkeiten des aktiven Beitragens zur gesellschaftlichen Akzeptanz von sexueller Vielfalt durch Schule
6.1 Möglichkeiten in der Schule als Subsystem der Gesellschaft
6.2 Möglichkeiten im Fach Deutsch durch Literaturunterricht
7 Sexuelle Vielfalt als Thema in der Kinder- und Jugendliteratur
7.1 Begriffsdefinition: Kinder- und Jugendliteratur
7.2 Die historische Ebene
7.2.1 Beginn des 20. Jahrhunderts
7.2.2 Weimarer Republik
7.2.3 Der Zweite Weltkrieg und die Restauration
7.2.4 Die Kehrtwende der 1970er Jahre
7.2.5 Die Etablierung des Themas in den 1980er Jahren
7.2.6 Die 1990er Jahre
7.2.7 Die Situation nach der Jahrtausendwende
7.3 Analyse ausgewählter kinder- und jugendliterarischer Texte
7.3.1 Zur Vorgehensweise
7.3.2 Zur Werkauswahl
7.3.3 Letztendlich sind wir dem Universum egal
7.3.4 Die Mitte der Welt
7.3.5 Die wilden Hühner und die Liebe
7.3.6 Das dänische Mädchen
7.3.7 Middlesex
8 Unterrichtspraktische Beispiele
8.1 Letztendlich sind wir dem Universum egal im Deutschunterricht
8.2 Die Mitte der Welt im Deutschunterricht
8.3 Die wilden Hühner und die Liebe im Deutschunterricht
8.4 Das dänische Mädchen im Deutschunterricht
8.5 Middlesex im Deutschunterricht
9 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Fragebogen: Studierende
Anhang 2: Fragebogen: Lehrkräfte
Anhang 3: Arbeitsblatt: Letztendlich sind wir dem Universum egal
Anhang 4: Werbeanzeige: Einstieg in Unterrichtsstunde zu Middlesex
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 - Persönliche Einstellung zu Homosexualität
Abbildung 2 - Persönliche Einstellung zu Bisexualität
Abbildung 3 - Persönliche Einstellung zu Transsexualität
Abbildung 4 - Persönliche Einstellung zu Intersexualität
Abbildung 5 - Ich habe das Thema Homosexualität schon häufig in meinem Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 6 - Ich habe das Thema Bisexualität schon häufig in meinem Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 7 - Ich habe das Thema Transsexualität schon häufig in meinem Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 8 - Ich habe das Thema Intersexualität schon häufig in meinem Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 9 - Reaktionen und Rückmeldungen der Schüler_innen beim Behandeln der Themen der sexuellen Vielfalt
Abbildung 10 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Homosexualität in Zukunft (häufiger) in meinem Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 11 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Bisexualität in Zukunft (häufiger) in meinem Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 12 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Transsexualität in Zukunft (häufiger) in meinem Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 13 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Intersexualität in Zukunft (häufiger) in meinem Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 14 - Befürchtete Schwierigkeiten und Hindernisse beim (häufigeren) Behandeln von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht
Abbildung 15 - Gründe, warum kein/kaum Interesse an der (häufigeren) Thematisierung von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht besteht
Abbildung 16 - Ich bin der Meinung, dass sexuelle Vielfalt in den Lehrplänen und Bildungsstandards des Faches Deutsch ausreichend thematisiert wird.
Abbildung 17 - Ab welcher Klassenstufe ist die Thematisierung von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht angemessen?
Abbildung 18 - Literaturunterricht bietet sich meiner Meinung nach zum Behandeln der oben genannten Themen der sexuellen Vielfalt sehr gut an.
Abbildung 19 - Sind Ihnen kinder- und jugendliterarische Werke bekannt, die sich mit einem oder mehreren Themen der sexuellen Vielfalt in Haupt- und/oder Nebenhandlungen auseinandersetzen?
Abbildung 20 - Autor und Titel der den Lehrkräften bekannten Werke
Abbildung 21 - Persönlich Einstellung zu Homosexualität
Abbildung 22 - Persönlich Einstellung zu Bisexualität
Abbildung 23 - Persönliche Einstellung zu Transsexualität
Abbildung 24 - Persönlich Einstellung zu Intersexualität
Abbildung 25 - In meiner Schulzeit wurde das Thema Homosexualität häufig im Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 26 - In meiner Schulzeit wurde das Thema Bisexualität häufig im Deutschunterricht behandelt.
Abbildung 27 - In meiner Schulzeit wurde das Thema Transsexualität häufig im Deutschunterricht behandelt
Abbildung 28 - In meiner Schulzeit wurde das Thema Intersexualität häufig im Deutschunterricht behandelt
Abbildung 29 - Die Reaktionen und Rückmeldungen meiner Mitschüler_innen waren beim Behandeln der Themen der sexuellen Vielfalt sehr positiv.
Abbildung 30 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Homosexualität später als Lehrer_in in meinem eigenen Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 31 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Bisexualität später als Lehrer_in in meinem eigenen Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 32 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Transsexualität später als Lehrer_in in meinem eigenen Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 33 - Ich habe großes Interesse daran, das Thema Intersexualität später als Lehrer_in in meinem eigenen Deutschunterricht zu behandeln.
Abbildung 34 - Gründe, warum kein/kaum Interesse an der Thematisierung von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht besteht
Abbildung 35 - Ich bin der Meinung, dass sexuelle Vielfalt in den Lehrplänen und Bildungsstandards des Faches Deutsch ausreichend thematisiert wird.
Abbildung 36 - Ab welcher Klassenstufe ist die Thematisierung von sexueller Vielfalt im Deutschunterricht angemessen?
Abbildung 37 - Literaturunterricht bietet sich zum Behandeln der Themen der sexuellen Vielfalt meiner Meinung nach sehr gut an.
Abbildung 38 - Sind Ihnen kinder- und jugendliterarische Werke bekannt, die sich mit einem oder mehreren Themen der sexuellen Vielfalt in Haupt- und/oder Nebenhandlungen auseinandersetzen?
Abbildung 39 - Autor und Titel der den Studierenden bekannten Werke
Abbildung 40 - Bekanntheit der Werke aus Schulunterricht oder Freizeit
Abbildung 41 - Fragebogen Studierende 1
Abbildung 42 - Fragebogen Studierende 2
Abbildung 43 - Fragebogen Lehrkräfte 1
Abbildung 44 - Fragebogen Lehrkräfte 2
Abbildung 45 - Arbeitsblatt: Letztendlich sind wir dem Universum egal
Abbildung 46 - Werbeanzeige: Kinder Überraschung für Mädchen
1Anmerkung
Zu Beginn soll angemerkt werden, dass in der vorliegenden Arbeit als Form der geschlechtergerechten Sprache der ‚Gender_Gap‘ verwendet wird. Der Unterstrich stellt grafisch einen Zwischenraum dar, der über die Geschlechterdichotomie Mann/Frau hinausgeht und alle Geschlechtsidentitäten und somit auch Menschen miteinschließt, die sich nicht in diesem Schema wiederfinden (vgl. Recla und Schmitz-Weicht 2015: 275). Für Menschen, die nicht den heteronormativen Regeln entsprechen, wird im Folgenden das Akronym LGBTIQ* verwendet, welches für lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersexual and queer, also lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell und queer steht. Der Begriff ‚Queer‘ bedeutet im Englischen ‚seltsam‘, ‚sonderbar‘ oder ‚verrückt‘ und wurde im englischen Sprachraum ursprünglich als Schimpfwort für LGBTIQ* -Personen verwendet. Im Laufe der Zeit wurde ‚queer‘ jedoch von verschiedenen Gruppierungen als positive Selbstbezeichnung genutzt und hat inzwischen auch in die Wissenschaft Einzug erhalten. In Deutschland wird der Begriff häufig als Sammelbezeichnung für Menschen gebraucht, die von der hegemonialen Heteronormativität abweichen (vgl. Recla und Schmitz-Weicht: 276). Der Asterisk (*) in LGBTIQ* stellt in der vorliegenden Arbeit nunmehr den Versuch dar, sämtliche Identitätsformen und Lebensweisen im Spektrum sexueller Vielfalt zu berücksichtigen und somit auch Personen einzubeziehen, die sich keinem der durch das Akronym explizit definierten Konzepte zugehörig fühlen.
2 Einleitung
Homophobie und Diskriminierung sind noch immer weltweit wahrnehmbare gesellschaftliche Phänomene, welche von verbalen bis hin zu physischen Gewalthandlungen gegenüber LGBTIQ*-Menschen reichen. Diskriminierende Handlungen und Äußerungen können im Alltag in Liedtexten, TV-Sendungen, Filmen, Büchern, Zeitschriften, aber auch auf Schulhöfen und in Klassenräumen vernommen werden.
Letzteres ist ein Problem, welchem sich die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg im Jahr 2013 annahm und eine Umgestaltung und teilweise Neugestaltung der Bildungspläne für das Jahr 2015 plante, die vorsah, dass die Thematisierung von sexueller Vielfalt Einzug in mehrere Fächer erhält (vgl. Vonderlehr 2014: 1). In einem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) abgedruckten Zeitungsartikel vom April 2014, äußerte sich Kultusminister Andreas Stoch, dass es das Ziel sei, „dass die Schule zu einem von Vorurteilen und Diskriminierungen freien Raum wird“ (Soldt 2014). Dass dies ein kühnes Ziel ist, in Zeiten, in denen „schwule Sau“ eines der beliebtesten Schimpfwörter auf Schulhöfen darstellt, zeigte sich kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Vorhabens, als in Baden-Württemberg tausende demonstrierende Bürger_innen auf die Straße gingen, um ihren Unmut über den neuen Bildungsplan kundzutun (Vonderlehr 2014: 1). Es entfachte eine breit geführte Kontroverse dahingehend, ob es überhaupt die Aufgabe der Schule sei, eine Erziehung und Bildung bezüglich sexueller Vielfalt und schließlich auch hin zu einer Toleranz eben dieser, durchzuführen. Viele befürchteten eine „Frühsexualisierung und Indoktrination“ von Heranwachsenden und betonten, dass es die Aufgabe der Eltern sei, solche Entscheidungen bezüglich der Erziehung ihrer Kinder zu treffen (vgl. Vonderlehr 2014: 2).
Die Hassparolen, die die Diskussion teilweise begleiteten, sind nur einer von vielen Aspekten, die zeigen, wie dringend nötig ein härteres Arbeiten an der Gleichstellung von sexuellen Minderheiten ist. Dass durchaus etwas erreicht werden kann, zeigt sich daran, dass Homophobie unter Erwachsenen laut Vonderlehr unter anderem aufgrund einer positiveren Darstellung in den Medien, verschiedener Aufklärungskampagnen und der veränderten Gesetzeslage bezüglich der gleichgeschlechtlichen Ehe teilweise zurückgegangen ist (vgl. Vonderlehr 2014: 34). Gerade Schule, als Lernort und Lebensraum, in dem Heranwachsende viel Zeit verbringen, kann zu solch positiven Entwicklungen beitragen. Außerdem ist gerade hier ein Unterbinden von Diskriminierung wichtig, da sich Heranwachsende in einer Phase ihres Lebens befinden, in welcher ihnen entgegengebrachte Diskriminierung weitreichende und nachhaltig negative Auswirkungen haben und zu negativen gesundheitlichen Folgen führen kann (vgl. Leufke 2016: Klappentext).
Eine von Klocke an Berliner Schulen durchgeführte Studie zeigt, dass ein angemessener Umgang mit Mobbing und Diskriminierung zu mehr Akzeptanz gegenüber sexueller Vielfalt bei den Schüler_innen beiträgt. Wenn den Schüler_innen der Befragungsschulen bewusst war, dass Mobbing im Leitbild ihrer Schule geächtet ist, hatten sie deutlich positivere Einstellungen zu LGBTIQ* und verhielten sich solidarischer gegenüber LGBTIQ*-Mitschüler_innen, oder jenen, denen dies nachgesagt wurde (vgl. Klocke 2012: 92). Außerdem zeigte die Studie, dass auch eine Thematisierung von sexueller Vielfalt im Unterricht bezüglich der Akzeptanz eben dieser hilfreich ist. Je häufiger sexuelle Vielfalt thematisiert wurde, desto besser wussten die Schüler_innen über LGBTIQ* Bescheid und desto positiver waren ihre Einstellungen zu LGBTIQ* (vgl. Klocke 2012: 89). Klocke betont hier, dass es wichtig sei, das Thema sexuelle Vielfalt nicht auf ein Unterrichtsfach oder wenige Unterrichtsfächer zu beschränken, „sondern es in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen möglichst selbstverständlich aufzugreifen“ (ebd.).
Sexuelle Vielfalt im Unterricht des Faches Deutsch soll Thema der hier vorliegenden Arbeit sein, wobei der Fokus auf den Möglichkeiten im Literaturunterricht durch das Behandeln thematisch passender kinder- und jugendliterarischer Werke liegt. Die Frage, die sich hierbei zunächst stellt, ist die Frage inwiefern sexuelle Vielfalt aktuell an Schulen und im Deutschunterricht als Thema aufgegriffen wird und was dies für die Situation von LGBTIQ*-Personen bedeutet. Des Weiteren stellt sich die Frage, warum sich Schule und gerade das Fach Deutsch einer solchen Thematik überhaupt annehmen sollte und inwiefern sich Literaturunterricht zur Thematisierung von sexueller Vielfalt eignet. Im Zuge dessen stellt sich die Frage, ob überhaupt geeignete kinder- und jugendliterarische Werke zur Thematik existieren und wenn ja, wie sie im Deutschunterricht genutzt werden können.
Zur Beantwortung dieser Fragen soll zunächst ein Blick auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtigen Begriffe bezüglich des Themenfelds der sexuellen Vielfalt geworfen werden, um ein gemeinsames Verständnis der Begrifflichkeiten zu schaffen. Hierbei wird bei der Begriffsbestimmung von Diskriminierung zusätzlich auf die für diese Arbeit wichtige Thematik der Diskriminierung von LGBTIQ*-Personen im schulischen Umfeld eingegangen. Nach den notwendigen Begriffsbestimmungen folgt ein kurzer Überblick über die Situation bezüglich sexueller Vielfalt in schulischen Richtlinien und Lehrplänen in Deutschland, woraufhin die Deutschlehrpläne von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg genauer betrachtet und verglichen werden. Im Anschluss folgt die Vorstellung und Auswertung einer Befragung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften und Lehramtsstudierenden des Faches Deutsch, die Einblicke in die aktuelle Situation der Thematisierung von sexueller Vielfalt an Schulen in Rheinland-Pfalz und die Bereitschaft zur Thematisierung durch zukünftige Lehrkräfte geben soll. Des Weiteren wird auf Möglichkeiten eingegangen, um in der Schule und vor allem im Fach Deutsch zu einem von Akzeptanz geprägten Miteinander beizutragen.
3 Überblick über das Themenfeld der sexuellen Vielfalt
Im Rahmen der Handreichung Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen des sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg, definiert Kugler ‚Sexuelle Vielfalt‘ als einen gesellschaftspolitischen Begriff, welcher für „die Vielfalt von Lebensformen, sexuellen Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und Geschlechterinszenierungen“ steht (Kugler 2012: 17). Der Begriff bezieht sich also nicht auf Sexualpraktiken, sondern auf bestimmte Lebensformen und Identitäten von Menschen. Als sexuelle Identität bezeichnet man das Selbstverständnis der Menschen davon, „wer sie als geschlechtliche Wesen sind“, also ihre Selbstwahrnehmung und wie sie wahrgenommen werden wollen (Kugler 2012: 24). Dieses Verständnis schließt laut Kugler vier grundlegende Komponenten ein, auf welche im Folgenden genauer eingegangen werden soll: das biologische Geschlecht, das psychische Geschlecht, das soziale Geschlecht und die sexuelle Orientierung (vgl. ebd.). Im Rahmen dessen wird im Folgenden außerdem genauer auf die Begriffe Intersexualität, Intergeschlechtlichkeit, Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit, Heterosexualität, Homosexualität und Bisexualität eingegangen, um einen Überblick darzubieten und ein Verständnis der Begrifflichkeiten zu schaffen, da sie von grundlegender Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit sind.
3.1 Geschlechtervielfalt
Der generelle Begriff ‚Geschlecht‘ beschreibt die Wahrnehmung von Menschen als ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ und ermöglicht so eine Einteilung in die Gruppen Frauen und Männer. Grundlage sind hierbei ein biologisches Verständnis von Geschlecht, das von der Reproduktionsfähigkeit der Menschen ausgeht, und ein daraus resultierendes soziales Verständnis von Geschlecht als kulturell definierte Geschlechterrolle (vgl. Dreier et al. 2012: 88).
Das biologische Geschlecht, im Englischen ‚sex‘ genannt, umfasst biologische Merkmale, die Menschen als männlich, weiblich oder eine Mischform der beiden auszeichnen. Dazu gehören unter anderem Chromosomensätze, Keimdrüsen, Hormone und Geschlechtsorgane (vgl. Dreier et al. 2012: 85-86). Anhand ausgewählter biologischer Merkmale, wird Menschen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen, doch es ist nicht in allen Fällen eindeutig festzulegen, um welches biologisches Geschlecht es sich handelt. Es gibt neben den bekannten Chromosomensätzen XX für weibliche Personen und XY für männliche Personen auch andere Kombinationen. Kugler führt als Beispiel die XY-Frauen an, die nach ihrem chromosomalen Geschlecht als Männer gelten müssten, aber als Frauen erzogen wurden (vgl. Kugler 2012: 18). Des Weiteren gib es Menschen, die uneindeutige Keimdrüsen oder Geschlechtsorgane besitzen und somit weder klar als männlich oder klar als weiblich klassifiziert werden können. Manchmal kommt es zum Beispiel vor, dass sich vermeintliche Mädchen in der Pubertät zu Jungen entwickeln (vgl. ebd.). Menschen, deren biologisches Geschlecht nicht eindeutig zuzuordnen ist, werden als ‚intersexuell‘ bezeichnet. Als Selbstbezeichnung wählen manche intersexuellen Menschen auch Begriffe wie ‚Hermaphrodit‘, ‚Zwitter‘, ‚intergeschlechtlich‘ oder ‚inter*‘ (vgl. Dreier et al. 2012: 91).
Viele Menschen, deren genitales Geschlecht intersexuell ist, fühlen sich, da das genitale Geschlecht nur einer von mehreren Aspekten einer Geschlechtsidentität ist, trotzdem einem der beiden binären Geschlechter zugehörig. Sie sehen sich selbst also entweder als Mann oder als Frau. Andere intersexuelle Menschen hingegen sehen ihr genitales Geschlecht und ihre geschlechtliche Identität nicht im Widerspruch zueinander, was bedeutet, dass sie sich einem nicht-binären Geschlecht zugehörig fühlen. Hier kommt der Begriff ‚intergeschlechtlich‘ ins Spiel, in dessen Zusammenhang auch häufig der Begriff ‚drittes Geschlecht‘ genutzt wird (vgl. Dreier et al. 2012: 88-89).
Etwa zwei von 2000 Kindern kommen laut Kugler mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen zur Welt und obwohl sie „zwischen den Geschlechtern geboren werden“, müssen intergeschlechtliche Menschen oft als Männer oder Frauen leben, da für sie rechtlich keine dritte Möglichkeit vorgesehen ist (Kugler 2012: 18). Kosmetische Operationen an intersexuellen Kindern werden zwar zunehmend, vor allem von intersexuellen Menschen selbst und ihren Interessenverbänden, kritisiert, da sie das Menschrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzen, medizinisch oft nicht notwendig sind und nur der Aufrechterhaltung der Zwei-Geschlechterordnung dienen, dennoch werden sie noch immer durchgeführt (vgl. Dreier et al. 2012: 91-92). Im Jahr 2012 forderte das deutsche Ethikrat, neben ‚männlich‘ und ‚weiblich‘, eine dritte Option im Personenstandsrecht einzuführen und so intersexuelle Menschen vor medizinischen Fehlentwicklungen und vor Diskriminierung zu schützen (vgl. Kugler 2012: 18-19). Diese Debatte wurde jüngst wieder aufgegriffen, als das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 8. November 2017 einen Beschluss vom 10. Oktober 2017 präsentierte, in welchem es heißt:
„Die Regelungen des Personenstandsrechts sind mit den grundgesetzlichen Anforderungen insoweit nicht vereinbar, als § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz (PStG) neben dem Eintrag ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ keine dritte Möglichkeit bietet, ein Geschlecht positiv eintragen zu lassen. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Darüber hinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht auch gegen das Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG), soweit die Eintragung eines anderen Geschlechts als „männlich“ oder „weiblich“ ausgeschlossen wird. Der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 2018 eine Neuregelung zu schaffen.“[1]
Somit fordert das Bundesverfassungsgericht ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister und verweist dabei auf das im Grundgesetz geschützte Persönlichkeitsrecht, um auch Menschen, die sich selbst als weder männlich noch weiblich wahrnehmen, zu berücksichtigen.
Die innere Gewissheit eines Menschen männlich, weiblich oder etwas Drittes zu sein, wird ‚psychisches Geschlecht‘ genannt. Bei den meisten Menschen stimmen das biologische und das psychische Geschlecht überein, doch einige Menschen stellen für sich fest, dass sie „im falschen Körper stecken“ und beschreiben sich entweder als Frau mit einem Männerkörper (Transfrau), oder als Mann mit einem Frauenkörper (Transmann) (Kugler 2012: 19). Für sie gibt es laut Kugler die Möglichkeit, den Weg in das andere Geschlecht mit Hilfe des Transsexuellen-Gesetzes zu gehen, nach welchem eine juristische Geschlechts- und Vornamensänderung möglich ist, oder sich mit Hilfe von Hormonen und geschlechtsangleichenden Operationen auch biologisch ihrem psychischen Geschlecht anzupassen (vgl. ebd.). Transsexualität ist somit keine sexuelle Orientierung, sondern bezieht sich auf die Geschlechtsidentität. Transsexuelle leben, wie alle anderen Menschen auch, als heterosexuell, bisexuell, lesbisch oder schwul (vgl. ebd.).
Das soziale Geschlecht, im Englischen ‚gender‘ genannt, beschreibt all das, was wir unabhängig von biologischen Merkmalen als männlich oder weiblich wahrnehmen, wie zum Beispiel Aussehen, Kleidung, Frisur, Körpersprache, Verhaltensweisen, Sprachformen, Berufe und so weiter. Aufgrund des hohen kulturellen Einflusses auf das soziale Geschlecht, wird es auch häufig als soziokulturelles Geschlecht bezeichnet (vgl. Kugler 2012: 19). Dies betont die Tatsache, dass Vorstellungen über ‚typisch weibliche‘ oder ‚typisch männliche‘ Attribute und Rollen nicht naturgegeben, sondern auf kulturelle und gesellschaftliche Traditionen und Konventionen zurückzuführen sind. Es ist von Kultur zu Kultur, von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, was als männlich und was als weiblich wahrgenommen wird. Dabei werden Männer meist sehr positiv bewertet und das männliche Geschlecht als das ‚starke Geschlecht‘ bezeichnet, während Frauen das ‚schöne Geschlecht‘ sein und sich den überlegenen Männern unterordnen sollen (vgl. Kugler 2012: 20). Auch durch unsere westliche Gesellschaft geistern Bilder von ‚richtigen Männern‘ und ‚richtigen Frauen‘, welche vor allem durch Medien dargestellt und verbreitet werden. Kugler führt an, dass schon Kleinkindern lernen, dass Barbie sich hübsch für Ken macht und „die warmherzige TV-Mutter freundlich Kaffee und Kuchen für die ganze Familie serviert, bevor sie die von Welterkundung und Forscherdrang ihrer kleinen und großen Jungs strapazierten Kleider mit nachsichtigem Schmunzeln in die Waschmaschine packt“ (Kugler 2012: 21). Männer müssen ihre Männlichkeit beweisen, Frauen ihre Fraulichkeit. Ein Mann, der sich schwach oder passiv zeigt, besitzt ‚falsche‘ Eigenschaften, die nicht zu seiner Geschlechterrolle passen. Frauen, die Raumfahrttechnik studieren wollen, stoßen Kugler zufolge genauso häufig auf Unverständnis, wie Jungen, die anstatt Fußball lieber Balletttanz lernen möchten. Weil Weiblichkeit als unmännlich abgewertet werden muss, werden Männer mit Minirock oder Lippenstift, also Männer, die Geschlechtergrenzen überschreiten, laut Kugler nicht ernst genommen und leben unter Umständen sogar gefährlich (vgl. Kugler 2012: 22).
In diesen Zusammenhang des sozialen Geschlechts lässt sich der Begriff ‚transgender‘, übersetzt ‚transgeschlechtlich‘, verorten, welcher nicht mit Transsexualität verwechselt werden sollte. Transgender wird häufig als Oberbegriff für all jene Personen verstanden, die ihre Geschlechtsidentität jenseits der binären Geschlechterordnung leben und somit die vorherrschende Geschlechterdichotomie in Frage stellen. Somit ist Transgender, im Gegensatz zu Transsexualität, kein medizinischer, sondern ein sozialwissenschaftlicher und politischer Begriff (vgl. Dreier et al. 2012: 48).
3.2 Sexuelle Orientierung
Der Begriff ‚sexuelle Orientierung‘ bezeichnet die am Geschlecht orientierte Wahl der Sexualpartner, also zu welchem Geschlecht sich eine Person hingezogen fühlt, und stellt einen wichtigen Aspekt der sexuellen Identität der Menschen dar. Menschen können das andere Geschlecht, das eigene Geschlecht oder beide Geschlechter begehren. Im ersten Fall spricht man von Heterosexualität, im zweiten Fall von Homosexualität und im dritten Fall von Bisexualität. Diese drei Möglichkeiten stehen laut Kugler keineswegs gleichberechtigt nebeneinander, sondern werden sehr deutlich bewertet. Obwohl sehr viele Menschen sowohl sexuelle Gefühle für Männer und Frauen haben, als auch entsprechende Erfahrungen in ihrem Leben machen, ist Bisexualität kein Thema, über welches offen gesprochen wird (vgl. Kugler 2012: 25). Dies hat mit der starken Abwertung und Ablehnung vieler Menschen gegenüber homosexuellem Begehren zu tun. Oft wird Homosexualität als ‚unnatürlich‘ bezeichnet, meist mit der Begründung, dass sie nicht der Fortpflanzung diene, wobei nicht berücksichtigt wird, dass die menschliche Sexualität noch viele andere Funktionen außer der Fortpflanzung hat (vgl. ebd). Um den Zweck der Fortpflanzung zu erfüllen, würde es laut Kugler auch genügen, „wenn heterosexuelle Paare ein bis zweimal in ihrem Leben miteinander schlafen, um die ein bis zwei durchschnittlichen Kinder zu erzeugen“ (ebd.). Wie Heterosexuelle erleben aber auch Lesben, Schwule und Bisexuelle über ihre Sexualität „Lust und Lebensfreude, Liebe und Geborgenheit, Partnerschaft und Zugehörigkeit, Sinnstiftung und Identität“ (ebd.).