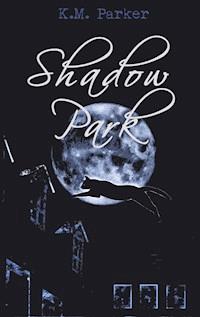Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Shadow Park
- Sprache: Deutsch
Tonja ist Bombenentschärferin. Eines Tages kommt sie bei einem Einsatz ums Leben. Lo, ein sprechender Kater mit mystischen Fähigkeiten, findet und erweckt sie zu neuem Leben, um sie als "Seelenretterin" auszubilden. Fortan soll es Tonjas Aufgabe sein, die niederträchtigen "Seelenfänger" daran zu hindern, die Seelen unschuldiger Menschen und anderer Seelenretter zu absorbieren. Doch schon bald merkt sie, dass man die Welt nicht so einfach in "Gut" und "Böse" einteilen kann und dass sie selbst im Mittelpunkt eines legendären Konfliktes steht, der schon weit vor ihrer Geburt begonnen hat. Als dann auch noch der schweigsame Abel, ein abweisender Bewohner Shadow Parks, ihr in größter Not helfen soll, muss Tonja sich nicht nur mit harten Kämpfen, sondern auch mit ihren eigenen, verwirrten Gefühlen auseinandersetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Erinnerung 1
Erinnerung 2
Erinnerung 3
Erinnerung 4
Erinnerung 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
1
Ich strich mit der Hand über meine Bluse, um sie etwas zu entfalten. Bügeln war nicht unbedingt meine Stärke, weshalb ich nervös rieb und zog, in der Hoffnung, die Falten etwas zu glätten. Ich wusste, was Mum von meiner mangelnden Hausfrauenqualität hielt und konnte mir gut den abschätzigen Blick vorstellen, der in wenigen Sekunden auf mich treffen würde.
»Dafür ist es jetzt etwas zu spät, oder?«
Ich drehte mich um und bestrafte Jim mit einem strengen Blick. Es war einfach unfair, dass er lässig in Hemd und Jeans hier aufschlagen konnte, ohne dafür bewertet zu werden.
Er hob entschuldigend die Hände.
»Ich kann nichts dafür, aber mit meinem Stil hatte Jean noch nie ein Problem. Vielleicht liegt das einfach an meinem unbestechlichen Schwiegersohncharme.«
Ich seufzte, drehte mich wieder zur Haustür und klingelte ein weiteres Mal. Noch bevor ich einmal tief Luft holen konnte, sprang die Tür auf und Mum stand vor mir.
Wie immer war sie von Kopf bis Fuß top gesty lt. Als Marketingstrategin einer großen Kosmetikfirma war es vielleicht auch einfach eine Lebenseinstellung gut auszusehen, aber sie überraschte mich trotzdem immer wieder. Sie trug ein langes, weißes Kleid mit Spitze, darüber eine zarte, cremefarbene Jacke. Ihre blonden Haare steckten in einer dezenten, goldenen Klammer, woraus sich ein paar lockige Strähnen befreit hatten. Es kam nicht selten vor, dass man sie für meine Schwester hielt.
Ich hob die Arme und lief auf sie zu. »Mum, hey, gut siehst du aus.«
Als ich ihren Blick sah, stoppte ich in der Bewegung.
Sie hatte ihre Hände in die Hüften gestemmt und sah mich wütend an.
»Gut siehst du aus? Hey Mum? Von wegen. Weißt du eigentlich, wie lange ich auf einen Anruf von dir gewartet habe? Ich dachte schon, du wärst umgekommen. Irgendwo verscharrt im Wald oder so. Nicht auszudenken, was ich dann getan hätte.«
Sie redete sich in Rage und schien gar nicht mehr mit mir, sondern mehr mit sich selbst zu sprechen.
Ich setzte das einzige Mittel ein, das ich hatte, packte Jim am Arm und zog ihn vor.
Er kam dicht vor ihr zum Stehen und straffte die Schultern.
»Jean, wie schön dich zu sehen.«
Mit einem Mal war alles wieder gut. Ihre Augen weiteten sich vor Freude, sie schlug die Hände zusammen und schloss ihn in eine mütterliche Umarmung.
»Oh, mein Junge, wie schön es ist, dich zu sehen. Du hast schon wieder abgenommen, oder? Toni ist einfach keine gute Köchin, aber dass sie dich gleich verhungern lässt …«
Ich biss die Zähne zusammen und beschloss, meinen Freund seinem Schicksal zu überlassen. Langsam schob ich mich an ihnen vorbei und ging ins Wohnzimmer.
»Hey Dad.«
Mein Vater saß in seinem heiß geliebten Wohnzimmersessel und hatte die Zeitung in der Hand.
»Hallo Liebes, schön, dass ihr da seid.«
Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange und drückte ihn kurz.
Jim und Mum liefen vorbei, wobei sie ihm keine Zeit ließ Dad zu begrüßen.
»Nun, deine Mutter ist wohl beschäftigt. Wollen wir uns schon mal in den Garten setzen?«
Er zwinkerte mir zu und ich musste lachen. Wie immer war ich ihm für seine ruhige und gelassene Art sehr dankbar. Ich suchte mir den schattigsten Platz aus und nippte an dem Wasser, das Dad mir eingeschenkt hatte. Wir saßen still nebeneinander und lauschten den Vögeln, die wild zwitscherten und auf den Ästen hin und her hüpften.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er den Hals streckte und prüfte, ob meine Mutter in der Nähe war. Er war wohl der Meinung, dass sie weit genug entfernt war.
»Und? Wie geht es dir? Wie läuft es bei der Arbeit?«
Ich nickte kurz und stellte das Glas ab. »Alles in Ordnung, ich hab zwar viele Einsätze, aber wir sind immer gut vorbereitet, also alles halb so wild.«
Das schien ihm zu genügen. Er tat es mir gleich und nickte ein paar Mal hintereinander, wobei seine Augen wieder zur Tür huschten.
Ich wollte es dabei belassen, also lenkte ich das Gespräch auf den Garten und all die Blumen, die ich noch nicht kannte und die er zweifelsfrei neu gepflanzt hatte.
Wir wurden unterbrochen, als es an der Tür klingelte. Sekunden später kam meine Schwester Helen in den Garten, an der Hand meine Nichte Susan. Wir umarmten uns herzlich und schnatterten drauflos. Durch meine Arbeit hatte ich nicht viel Zeit und so war es schon wieder Wochen her, dass wir uns gesehen hatten.
»Meine Güte, wie du gewachsen bist seit dem letzten Mal, Susan.« Ich ging in die Knie und umarmte die Kleine, die mich schüchtern beäugte.
Als Mum nach Steve fragte, erklärte Helen, dass er die Wochenendschicht bekommen hatte und das leider so kurzfristig nicht mehr zu ändern war. Wir setzten uns an den großen Holztisch und nach einer Weile band Dad sich die Kochschürze um und schmiss den großen Grill an.
Zu meiner Überraschung hatten wir einen entspannten Abend, selbst Mum war bestens gelaunt und schaufelte sich einen großen Berg Nudelsalat auf den Teller, obwohl das eindeutig ihre Tageskalorien überschritt.
Nach dem Essen ging ich zu Susan, die in dem Sandkasten spielte, den Dad vor zwei Jahren für sie hergerichtet hatte.
Sie saß mit dem Rücken zu mir und als ich näher kam, hörte ich, dass sie etwas sagte. Ich schlich mich weiter heran und sah gerade noch, wie zwei Pfoten im Gebüsch verschwanden.
Eine Katze.
Susan hatte sich erhoben und hielt ihre Schaufel in die Höhe. Sie rief der Katze hinterher: »Miezi!«
»Susi, war das eine Freundin von dir?«
Ihr Blick richtete sich wehleidig auf den Punkt, wo die Pfoten verschwunden waren.
Ich setzte mich neben sie und begann, im Sand zu graben. »Wollen wir eine Burg bauen?«
Keine Reaktion.
»Susi?«
Abrupt drehte sie sich um, sodass ich zusammenzuckte und vor Schreck die Augen aufriss. In dem dunklen Licht wirkte ihr Gesicht kalkweiß.
Sie zeigte mit ihrer Schaufel auf mich und ließ sich auf den Boden plumpsen. »Miezi.«
Ich kniff die Augenbrauen zusammen und beobachtete, wie sie begann, ein Loch zu graben. Kinder konnten schon seltsam sein.
»Buddelt ihr zusammen?«
Helen stand plötzlich hinter mir. »Ganz schön dunkel, Dad sollte hier mehr Lampen aufhängen. Es wundert mich, dass sie gern hier spielt, zu Hause braucht sie immer Licht zum Einschlafen« Sie stapfte durch den Sand und hob Susan auf den Arm. »Lass uns wieder rübergehen. Und du, kleine Maus, gehörst sowieso ins Bettchen.«
Ich folgte den beiden und setzte mich neben Jim, der mich liebevoll anlächelte.
Offenbar war ich mitten in ein Gespräch geplatzt, denn meine Mutter hatte ihre Augen auf mich gerichtet und sah mich fragend an.
»Ähm, wie bitte?«
Sie faltete geduldig die Hände ineinander und seufzte. »Ich hab nur gerade von der neuen Kosmetiklinie erzählt und wir suchen dringend noch eine neue Beraterin. Im Moment herrscht bei uns wirklich Fachkräftemangel, richtig schrecklich. Da können wir jede Hilfe gebrauchen.«
Ich spürte, wie Wut in mir aufstieg. Fast hatte ich daran geglaubt, dieses Thema nicht schon wieder durchkauen zu müssen. Ich hätte es besser wissen müssen. Zu diesem Gespräch kam es immer, es gehörte einfach zu einem Abend mit meiner Mutter dazu.
Jim nahm meine Hand und drückte sie sanft, um mich zu beschwichtigen.
»Ihr werdet sicher bald jemanden finden, es gibt eine Menge fähige Frauen, die sich für Kosmetik interessieren.«
Damit war das Thema für mich beendet, aber nicht für Jean.
»Ach Kind, was soll das Drumherum-Geschwafel. Willst du nicht etwas Vernünftiges machen, etwas UNGEFÄHRLICHES?«
Das letzte Wort hatte sie schrecklich betont und es so lang gezogen, dass man denken konnte, sie sprach mit einer Schwachsinnigen.
»Es ist einfach nicht richtig, dass eine junge Frau tagein tagaus einem Männerberuf nachgeht. Du musst dich doch nicht so furchtbar abmühen. Bei mir hast du angenehme Arbeitszeiten, dir drohen keinerlei Gefahren und du wirst gut bezahlt, was will man mehr als junges Ding? Und Jim wäre dabei bestimmt auch viel wohler.«
Ich spürte, wie mein Freund sich neben mir versteifte.
»Nun Jean, ich denke Toni weiß, was sie tut. Es ist ihre Entscheidung.«
Offenbar enttäuscht von dieser Aussage, lehnte sie sich im Stuhl nach hinten und schmollte.
Die Stille, die darauf folgte, war bedrückend.
»Nun, ich finde es super, eine Polizistin in der Familie zu haben. Vor allem, wenn sie auch noch Sprengstoffmeisterin ist. Was will man mehr?«
Damit hatte niemand gerechnet.
Helen griff lässig nach ihrem Glas, nippte daran und schlug die Beine übereinander. Es sah so aus, als machte sie sich kampfbereit und das nicht ohne Grund.
Im selben Moment richtete sich unsere Mutter mit vor Entrüstung geröteten Wangen in ihrem Stuhl auf und fixierte meine Schwester, wie ein Adler seine Beute.
»Ach komm schon, Mutter. Toni ist glücklich damit und das ist doch die Hauptsache.«
Mir klappte die Kinnlade runter. Das war der Super-GAU. Niemand wagte es, Jean so zu widersprechen. Es war schon immer so gewesen, dass ich über Mutters Kommentare nur kopfschüttelnd vorüberging, während Helen eher offen dagegen rebellierte. Aber noch nie so, in dieser Direktheit.
Mein Blick huschte zu Dad, der entspannt im Stuhl ruhte, sich das Kinn rieb und nicht wirklich anwesend zu sein schien. Von der Seite war also keine Hilfe zu erwarten.
»Achso! Und ich dachte, du würdest mich noch eher verstehen, Helen. Immerhin bist du ja auch Mutter einer Tochter. Ich denke nicht, dass du dir wünschst, dass Susan mit 27 in tausend Stücke gesprengt wird.«
Die Gehässigkeit, die mit Mums Stimme offen ausbrach, hätte Knochen spalten können.
Ich sah, wie Helens Gesicht weiß wurde. Sie saß nur noch auf der Stuhlkante, als würde sie jeden Moment aufspringen und über Mum herfallen.
Ich war Helen unglaublich dankbar und fühlte mich ihr tief verbunden. Es tat weh zu sehen, dass sie verletzt wurde, weil sie mich verteidigen wollte.
Ich dachte, sie würde jeden Moment verkünden, dass sie gehen wolle, doch ich unterschätzte sie.
Ihr Körper entspannte sich und so gelassen es ihr möglich war, stellte sie ihr Glas wieder auf den Tisch.
Helen war stärker geworden und ich wusste auch, woran das lag. Es war eindeutig ihrem Mann Steve zu verdanken, der sie durch seine Seitensprünge viele Tränen und viel Kraft gekostet hatte. Dass sie seit ein paar Monaten alleinerziehend war und sich durch zwei Jobs kämpfte, da Steve keinen Unterhalt zahlen wollte, wussten nur Dad und ich.
Als ich schließlich seufzte und mich aufrichtete, spürte ich sämtliche Blicke der Runde auf mir. »Ich werde nicht in tausend Stücke gesprengt, Mum, also beruhige dich bitte. Ich wurde bestens ausgebildet und weiß, was ich mache. Und jetzt wechseln wir bitte das Thema.«
Es folgte wieder Stille, bis Mum sich schließlich räusperte und sagte: »Na schön, wie du meinst. Aber merk dir meine Worte. Deine Arbeit wird dich noch den Kopf kosten. Und jetzt gibt es Nachtisch.«
Sie verschwand im Haus und servierte uns wenig später Schokopudding mit Vanillesoße.
Die Stimmung war nicht mehr zu retten, also schaufelten wir, so schnell es ging, den Nachtisch hinein und verabschiedeten uns wenig später.
Jim und ich eilten den erleuchteten Steinweg entlang, zu unserem Auto.
Als wir drin saßen, atmete ich vor Erleichterung laut aus.
»Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder?«
Ich drehte meinen Kopf zur Fahrerseite und bedachte meinen Freund mit einem bösen Blick.
Er lachte und startete den Motor. »Ich hoffe übrigens auch, dass du nicht gesprengt wirst, Schatz. Nur um meinen Standpunkt nochmal klarzustellen.«
Ich konnte nicht anders und musste schließlich auch darüber lachen.
Wir schwiegen eine Weile und ich überlegte. Es war nicht selbstverständlich, dass Jim mich in Schutz genommen hatte. Es war tatsächlich so, dass wir uns schon etliche Male über meinen Job unterhalten hatten. Über die Gefahren und auch darüber, dass er glücklich wäre, wenn ich etwas anderes machen würde. Vielleicht mich in den Innendienst versetzen zu lassen. »Hätte ich es sagen sollen?« Ich neigte meinen Kopf leicht zur Seite und sah, dass er mit einem Mal angespannt wirkte. »Naja, ich hätte das ganze sofort beenden können. Aber, weißt du, irgendwie konnte ich es nicht. Meiner Mutter diese Genugtuung zu geben. Sie hätte sich gleich bestätigt gefühlt.«
Zu meiner Überraschung fuhr Jim auf den Standstreifen und hielt an. Er drehte den Schlüssel und stellte den Motor aus. Dann wandte er sich mit ernstem Blick zur Seite und fixierte mich. »Ich möchte das nochmal klarstellen. Ich verlange nichts von dir.«
Ich wollte ihm sofort ins Wort fallen, doch er schüttelte leicht den Kopf.
»Wir halten fest: Morgen ist dein letzter Tag als Sprengmeisterin der Polizei. Danach bist du im Innendienst, sprich, du machst Büroarbeit.«
Er nahm meine Hände und ich spürte ein Kribbeln in der Magengegend. Ich wusste, was jetzt folgen würde. Immer und immer wieder hatten wir dieses Gespräch in den letzten paar Monaten geführt.
»Toni, ich weiß, wie hart du gearbeitet hast, um diesen Job zu bekommen. Und ich weiß, du bist brillant in dem, was du tust. Wenn du irgendwelche Zweifel hast, dann sag es bitte. Das wird nichts ändern. Ich bin nicht wütend oder so.«
Ich sah in die Augen dieses wunderbaren Mannes und musste lächeln.
»Was ist?«
Ich rückte näher an ihn heran und schlang meine Arme um seinen Hals.
»Das ist keine Antwort, Toni.«
Wir küssten uns, wobei ich anfing sein Hemd zu öffnen.
»Du kennst die Antwort.«
Ja, ich würde es tun. Für eine lange und unbeschwerte Zukunft mit Jim. Mehr wollte ich nicht.
Ich blieb auf der obersten Treppenstufe stehen und starrte auf die Eingangstür der Polizeiwache.
Das flaue Gefühl, das ich seit Wochen mit mir rumschleppte, breitete sich schließlich in meinem ganzen Körper aus.
Der letzte Tag.
»Du wirkst heut Morgen ein bisschen unentschlossen, Kollegin.«
Ich erkannte die Stimme sofort. »Morgen, Curtis.«
Er nahm zwei Stufen auf einmal und stellte sich neben mich. »Die Fassade müsste mal wieder gestrichen werden.«
Als ich schließlich seufzte, ertönte aus seiner Kehle das tiefe, brummige Lachen, das ich so mochte.
»Seh ich da Angstschweiß auf deiner Stirn, Kollegin?«
Er öffnete die Tür und bedeutete mir mit einem Kopfnicken, ihm zu folgen.
Wir schritten durch den langen Flur, zu unserem Büro.
Jason saß schon an seinem Schreibtisch, den Kaffeebecher in der Hand und starrte angestrengt auf den Monitor. Als wir reinkamen, blickte er kaum auf.
»Hey Curtis, Morgen Toni.«
Noch bevor wir etwas erwidern konnten, sagte er:
»Toni, die Chefin will dich sprechen. Sofort.«
Curtis ging zu seinem Stuhl und stellte seine Tasche ab. Dann sah er mich an und zog und zerrte an seiner Krawatte, die ihm heute offenbar zu eng war. »Ich halt dir einen Kaffee warm.«
Ich nickte steif. »Danke.«
Die Treppen bis zum Büro der Chefin kamen mir endlos vor.
Ich wusste, was sie wollte. Meine Einwilligung, meine Unterschrift. Danach würde ich nur noch im Büro sein. Tag für Tag, immer.
Als ich sie vor fast einem Jahr darum gebeten hatte, war sie sehr erstaunt und meinte, ich solle doch noch einmal gut über diese Entscheidung nachdenken, denn sie wäre unumkehrbar.
Ich klopfte an die Tür und trat ein.
Die Chefin hielt den Telefonhörer in der Hand, nickte mir aber zu und deutete auf den leeren Stuhl vor ihrem Schreibtisch.
Ich nahm Platz und starrte gedankenverloren durch das Zimmer.
Nach etwa fünf Minuten war ihr Telefonat beendet und sie widmete sich meiner Person. Ohne Umschweife kam sie auf das zu sprechen, was Sache war. Das hatte ich schon immer an ihr gemocht.
Sie schob einen kleinen Stapel Papiere zu mir herüber und hielt mir den Stift hin. »Wenn Sie wirklich immer noch bei Ihrem Entschluss bleiben wollen, setzen Sie dort Ihre Unterschrift. Ich möchte jedoch vorher noch einmal betonen, dass wir Sie gerne weiterhin im Außendienst wüssten.« Ihre hellblauen Augen fixierten mich freundlich.
Meine Hand zitterte leicht, als ich den Stift nahm und schwungvoll meine Unterschrift gab.
Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinunterlief, als ich das Papier wieder über den Tisch schob.
»Schön, dann ist das ja geregelt. Ab morgen sitzen Sie dann im Büro, im zweiten Stock, bei Conny.«
»Danke.«
Ich sprang auf und lief so schnell es meine Beine zuließen wieder die Treppe hinunter.
Ich setzte mich auf die letzte Stufe und atmete tief durch.
Ich war traurig. Traurig und zornig, obwohl ich selbst es so gewollt hatte.
Ich musste mir vor Augen halten, warum ich das getan hatte. Nämlich um etwas noch besseres zu haben als meinen Traumjob.
»Du machst ja ein Gesicht, als hättest du grad dein Todesurteil unterschrieben.«
Curtis stand plötzlich vor mir.
»Vielleicht hab ich das ja. Keine Ahnung.«
Er lachte laut auf und setzte sich neben mich. »Ich denke, du machst alles richtig. Und wer hätte gedacht, dass Tonja Eleanor Cone mal aus Liebe ihren Job hinschmeißt.« Er lachte wieder und warf dabei seinen Kopf in den Nacken.
»Blödmann, das ist nicht witzig. Ich hab hier eine echte Lebenskrise, okay?«
»Oh nein, meine Liebe, eine echte Lebenskrise ist, wenn du 28 bist, keine Frau hast, die es mit dir und deinem Job aushalten könnte und dir auch noch die Haare ausfallen.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf die kahle Stelle auf seinem Kopf.
Curtis wusste einfach, wie er mich aufheitern konnte, nicht umsonst war er seit Schulzeiten mein bester Freund. Gleichzeitig waren wir dem Sprengkommando beigetreten und wussten um die Probleme, die dieser Job mit sich brachte.
Ich musste an Carry denken, Curtis’ Exfrau. Letztendlich hatte er sich aufgrund eines Ultimatums gegen sie und für seine Arbeit entschieden. Ich wusste, dass er das bis heute bereute.
»Weißt du, was richtig super ist?«
Ich sah ihn an und zuckte mit den Schultern.
»Wir haben einen Auftrag für heute. Wenn das mal nicht ein bombastischer letzter Arbeitstag für dich wird.«
Ich sprang hektisch auf und wedelte mit den Armen.
»Und dann betreibst du hier Seelsorge? Wir müssen los!«
Wir schnappten uns unsere Ausrüstung und gingen zum Wagen.
Curtis brachte mich auf den neuesten Stand. »Irgendein Verrückter hat an der Brücke stadtauswärts eine Bombe angebracht. Er fordert zwei Millionen, die Übergabe wird hinausgezögert, sodass wir Zeit haben, das Ding zu entschärfen.«
»Keine Kameras?«
»Nein, offenbar hat der Täter das Ganze nicht im Blick. Die Gegend wurde abgesucht und beschallt. Um ihn zu testen hat die Chefin ihn gebeten, die Bombenentschärfer nicht zu sprengen, sie würden sich sofort zurückziehen. Er stimmte zu, so ein Idiot, dabei war niemand an dem Ding dran. Die Leute werden immer verrückter. Würde mich nicht wundern, wenn das Ding nur eine Attrappe wäre.«
»Und die Presse hält sich zurück? Wenn wir irgendwo im Fernsehen auftauchen, sind wir geliefert.«
Curtis stieß einen Pfiff aus und wedelte mit der Hand. »Du weißt doch, wie die Chefin ist. Sie ist schon vor Ort, da traut sich keiner mehr hin.«
Die Brücke war natürlich abgesperrt, sodass wir lange brauchten, um ans Ziel zu kommen.
Als die Chefin uns sah, kam sie sofort auf uns zu.
»Ich hab gedacht, ihr kommt gar nicht mehr. Zieht eure Schutzanzüge an und macht euch an die Arbeit.« Ich sah sie an und überlegte.
»Wie sicher ist es, dass der Täter wirklich keinen Überblick über die Lage hat? Er könnte den Fernzünder aktivieren. Dann sind wir nur noch Staub. Wir alle.«
Ich ließ meinen Blick schweifen und erkannte viele Polizisten und Feuerwehrleute. Wir waren ein paar Kilometer von der Bombe entfernt, doch da wir keine Informationen über dessen Sprengkraft hatten, empfand ich den Abstand als zu gering.
Die Chefin nickte langsam. »Na schön Toni, wir ziehen uns noch etwas zurück, zufrieden?«
Als Curtis und ich schließlich fertig angezogen waren, machten wir uns auf den Weg. Durch ein im Helm eingearbeitetes Funkgerät, konnten wir mit der Chefin sprechen und eventuelle Neuigkeiten erfahren, weitergeben und uns auch untereinander verständigen. Wir liefen einen Großteil des Weges, um die Brücke nicht mit dem Auto zu erschüttern.
Die Bombe war größer als ich gedacht hatte. Und sie war kompliziert.
Wir schafften es, sie zu öffnen, wodurch wir Zugang zu sämtlichen Kabeln erhielten.
Gerade, als wir das entscheidende Kabel durchtrennt und sie somit unschädlich gemacht hatten, hörte ich die Stimme der Chefin, die mir laut ins Ohr hallte.
»Hört ihr mich? Der Täter ist gefasst. Aber er sagte etwas von einer automatischen Zündung. Also zieht euch zurück. Das ist ein Befehl!«
»Aber wir haben sie grad entschärft, Chefin.«
»Das ist mir egal, Curtis. So lautet mein Befehl!«
»Okay, okay.«
Er sah mich an und nickte mit dem Kopf zur anderen Seite, wo das Auto stand. »Dann lass uns gehen.«
Wir liefen schon eine Weile, als er plötzlich in der Bewegung stoppte. »Ach Kacke, ich hab eines der Messinstrumente vergessen.«
Er rannte los, während ich stehen blieb.
»Curtis, das ist doch jetzt egal. Komm bitte zurück.«
Manchmal war er einfach unvernünftig, dafür würde ich ihm später den Arsch aufreißen.
Er hielt nur den Arm in die Höhe, als wollte er sagen, dass ich mir keine Sorgen machen soll.
In eben diesem Moment, als er vor der Bombe ankam, den Arm zum Himmel erhoben, gab es einen ohrenbetäubenden Knall und sie explodierte.
Ich weiß nicht mehr, ob ich schrie oder nur stumm auf die Feuerwand zurannte, die sich mir mit unglaublicher Geschwindigkeit näherte.
Dass das, was ich tat, dumm war, wäre jedem Zuschauer klar gewesen. Aber auch, dass ich, selbst wenn ich weggerannt wäre, keine Chance gehabt hätte.
Als die glühende Hitze meinen Anzug zerstörte und mir die Haut vom Leib riss, hörte ich die Stimme meiner Mutter.
»In tausend Stücke gesprengt. Du hast dich in tausend Stücke gesprengt, Tonja.«
»Mum, nicht jetzt.«
Ich hatte am ganzen Körper unaussprechliche Schmerzen und wünschte mir nur, dass das alles schnell vorbeigehen möge.
Dass ich auf dem Boden lag, wurde mir erst bewusst, als ich durch die dichten Rauchwolken den Himmel sah.
Ich schrie vor Schmerz, als ich den Kopf anhob.
Ein großer Steintrümmer der zerstörten Brücke lag auf meinem Körper und verdeckte ihn fast ganz.
Ich versuchte immer wieder mich zu bewegen, was jedoch aussichtslos war.
Ich spürte, wie die Tränen mein Gesicht hinunterliefen. Jede von ihnen brannte wie die Hölle.
Und ich weinte. Ich weinte und schrie. Vor Schmerz, vor Kummer, vor Angst. Curtis war tot, mit der letzten verstörenden Geste eines Siegers verschwunden, ausgelöscht.
Das Atmen fiel mir immer schwerer und ich war schrecklich müde.
Ich schloss die Augen. Ruhe, Frieden. Ich sah viele bunte Bilder, Gesichter, Orte, Erinnerungen.
Er war weg, der Schmerz, endlich weg.
»Meine Güte, bist du aber langweilig.«
Ich riss die Augen erschrocken auf und mit dem kräftigen Atemzug, den ich dabei machte, kam alles zurück.
Zwei dunkelbraune Augen sahen belustigt auf mich herab. Dieser Blick war so dunkel und kalt, dass mein Körper zu zittern begann.
Ich stöhnte.
»We—r??«
Sie grinste von einem Ohr zum anderen.
»Ganz schön miese Art abzutreten, denkst du nicht? Ich finde das geschmacklos. Wenn Gott wollte, könnte er alle auch einfach einschlafen lassen. Aber nein, er braucht das volle Programm, das ganze Theater.«
Ich verstand ihre Worte nicht und versuchte wieder, mich zu bewegen, natürlich ohne Erfolg.
Sie kniete sich neben mich und erst jetzt konnte ich ihr Gesicht erkennen.
Ein kleines Mädchen war hier, einfach so. Ihre langen blonden Haare hingen ihr, nun da sie kniete, bis zum Boden.
»Möchtest du dich sehen? Ist echt übel. Ziemlich fleischig die ganze Angelegenheit.«
Sie hielt einen großen silbernen Handspiegel in die Höhe, doch ich konnte die Augen im letzten Moment noch schließen.
Wut überkam mich. Wie konnte sie es wagen, einer Sterbenden so etwas zu sagen?
Ich wollte nur meine Ruhe, das konnte doch nicht zu viel verlangt sein.
»Naja, dann nicht. Aber bevor ichs vergess, ich hab ein Angebot für dich, Toni.«
Ich zuckte zusammen, als sie meinen Namen aussprach.
»Weißt du, du musst hier nicht so elendig verrecken, wenn du nicht willst. Ich kann dich nämlich retten.«
Stolz schlug sie sich mit der Hand auf die Brust.
Ich nahm all meine Kraft zusammen und schrie: »VERSCHWINDE!«
Mit einem Ruck erhob sie sich und schmollend wich sie ein paar Schritte zurück.
Ich spürte, wie sich mit ihrer Stimmung die ganze Atmosphäre änderte. Ich sah meinen eigenen, kalten Atem in der Luft und wie die Umgebung langsam gefror. Wo eben noch dunkler Stein war, war nun glattes Eis.
»Da ist man einmal nett und einfühlsam und wird dann so zurückgewiesen. Aber das lass ich nicht gelten. Deine mickrige, kleine Seele gehört jetzt zu mir, ob du willst oder nicht.«
Sie kam schnellen Schrittes wieder auf mich zu.
Ich bekam Panik und rutschte unter dem Stein hin und her, während sie nur hämisch darüber lachte.
Als sie sich bückte, um mich zu berühren, kniff ich die Augen zusammen und drehte den Kopf weg.
Ihr schmerzerfüllter Schrei durchbrach die Stille.
Ich hatte Angst davor, die Augen wieder zu öffnen, doch ich musste sehen, was passiert war.
Sie war fort, einfach weg. Nichts deutete darauf hin, dass sie jemals überhaupt hier gewesen war.
Wahrscheinlich war sie das auch nicht. Ich hatte geträumt – halluziniert. Das war die Antwort.
Ich drehte meinen Kopf langsam ein Stück nach rechts, dann nach links. Nichts. Kein Mädchen, kein Eis.
Mittlerweile empfand ich das, was von meinem Körper übrig war, nur noch als einzigen Feuerball, dessen Brennen unaufhörlich schmerzhaft und gleichzeitig völlig taub war. Da waren keine Einzelteile mehr spürbar, keine Beine, keine Arme, kein Finger oder Zeh. Nur ein in sich verwobener Schmerz.
Ich hätte dem gern selbst ein Ende bereitet, doch wie?
Ich hustete den Staub aus, der sich immer wieder in meine Lunge schlich und mir die Sicht noch immer erschwerte.
Und dann hörte ich etwas. Nein, ich spürte es.
Oben auf dem Fels, der auf meinem gebrochenen Körper thronte, war etwas.
Ich schluckte schwer und riss die Augen auf, in der Hoffnung, etwas durch das tiefe Grau der staubigen Luft zu erkennen.
Im selben Moment als ich sie sah, spürte ich eine Leichtigkeit, die ich mir niemals hätte vorstellen können.
Die grünen Augen sahen voller Sanftmut auf mich herab und umhüllten meinen Körper mit Wärme und Erleichterung.
Meine Lungen füllten sich mit so viel reiner Luft, dass ich dachte, mein Brustkorb würde vor Freude zerspringen.
Die Ängste waren fort, genauso wie der Schmerz.
Ich starb – endlich.
2
Ich war irgendwo, nirgendwo. Trieb umher, ließ mich treiben. Kein Weg, kein Muss, kein Wird. Diese angenehme Wärme begleitete mich, durchdrang mich, wie ein warmer Sonnenstrahl. Worüber hatte ich mir Gedanken gemacht? Unnütze, grobe Gedanken, die meinen Geist beherrscht hatten. Ich schob alles von mir.
Und dann öffnete ich die Augen.
Mein Körper, den ich verloren geglaubt hatte, war wieder da.
Ich sah auf meine Beine und die Zehen, die ich einknickte, dann wieder locker ließ, um mich zu vergewissern, dass es meine eigenen waren.
Mein Blick wanderte umher, doch hier war nichts, nur das helle Weiß.
Ich drehte mich um und da waren sie. Die grünen Augen, dessen Besitzer dort saß, ruhig und geduldig, die Beine akkurat vor den Körper postiert.
Ich streckte langsam die Hände nach dem flauschigen Kopf aus, der sich weiterhin keinen Zentimeter bewegte und streichelte über das zarte Fell.
Solange ich diese Augen vor mir hatte, fühlte ich mich sicher und geborgen.
Die Katze streckte den Hals aus und kam meiner Hand entgegen, wie zur Bestätigung.
»Weißt du, wo wir sind, Kleine?« Ich drehte den Kopf zur Seite, dann zur anderen, aber da war nichts. Keine Menschenseele, kein Gebäude, geschweige denn ein Ausgang.
Als ich die Hand wieder ausstreckte, fasste ich ins Leere.
Ich sprang auf. »Katze? Wo bist du hin?« Ich bekam Angst und lief einfach los.
»Ich heiße nicht Katze.«
Ich schrie laut auf und ruderte zurück, als das Tier auf einmal neben mir auf Augenhöhe erschien.
Es lag auf einem großen, runden Felsen und sah mich an. »Ich bin Lo.«
Mein Herz pochte immer noch wild in der Brust. »Wie bitte, was hast du gesagt?«
»Ich sagte, mein Name ist Lo. Und ich heiße dich willkommen Seele, genannt Tonja.«
»Toni, nicht Tonja und wo sind wir? Was ist hier eigentlich los? Eben war ich noch, naja, richtig glaub ich. Und jetzt bin ich hier.«
Ich wusste nicht warum, doch die Tatsache, dass ich mich mit einer Katze unterhielt, fand ich kein bisschen merkwürdig, fast so, als hätte ich das schon immer getan.
Ich überlegte. »Warte mal, heißt das, ich bin nicht tot? Das ist es, oder? Ich liege im Koma oder so. Und das hier ist ein Traum.«
Langsam schüttelte er den Kopf, wobei er die Ohren senkte, als habe er etwas angestellt und müsste jetzt besonders niedlich aussehen, um einer Strafe zu entgehen. »Das ist leider eine falsche Annahme. Du bist verstorben und ich habe deine Seele hierher gebracht, weil du auserwählt bist.«
»Auserwählt? Geht es auch etwas genauer?«
Ich ging zum Rand des Felsens und er erhob sich und kam ebenso näher.
»Du hast die Wahl, Toni. Entweder ziehst du weiter oder du kommst mit mir.«
»Das heißt, ich kann weiterleben?« Ich spürte, wie die Freude mich überkam.
Ich würde wieder leben, zusammen mit Jim, für immer.
Meine Mum würde ich in eine feste Umarmung schließen und ihr sagen, dass sie mit allem recht hatte. »Okay und wie mach ich das? Wie kann ich zurück?« Ich trat ungeduldig von einem Bein aufs andere, während die Katze mich behutsam ansah und zu überlegen schien.
»Du folgst mir und wirst leben, aber es gibt drei Bedingungen, die du erfüllen musst. Du wirst an einem Ort leben, der dir vorgegeben wird. Du wirst einer neuen Arbeit nachgehen und du wirst vorerst niemanden sehen können, der dir nahe steht.«
Bei dem letzten Satz stockte mir der Atem. »Ich darf meine Familie nicht sehen? Soll das ein Scherz sein? Alle denken, dass ich tot bin, während ich mich gesund und munter unter ihnen befinde? Das kann ich nicht.«
Die Katze begann damit, sich die Pfoten zu lecken. Immer wieder strich sie sich genüsslich über den Kopf und schien mich völlig zu vergessen.
Ich wurde wütend. »Hast du mich verstanden? Ich akzeptiere NICHT.«
Plötzlich änderte sich die Stimmung.
Majestätischer als ich es jemals bei einer anderen Katze gesehen hatte, erhob sie sich und warf mir ihren glühenden, grünen Blick entgegen. Es war nicht so wie das erste Mal, als ich dieses grüne Leuchten gesehen hatte. Beim ersten Mal war es eine Erlösung, voller Wärme und Liebe. Jetzt spürte ich im ganzen Körper das reine Gift.
Ich wich zurück, doch sie folgte mir.
»Du willst also lieber sterben, als die Gnade zu nutzen, weiterzuleben und Gutes zu tun? Da du mir eine so dumme Antwort gibst, habe ich mich offenbar in dir getäuscht, Seele Tonja. Meine Zeit ist kostbar, daher nehme ich deine Entscheidung entgegen und wandere weiter. Leb wohl« Die Katze drehte sich um und im nächsten Augenblick war sie verschwunden.
Und so schlagartig, wie das Gespräch beendet war, so einschneidend kam mir der Gedanke, dass sie recht hatte. Ich bekam offensichtlich eine Chance, doch ich hatte Angst. Die Bedingung, niemanden sehen zu können, den ich liebte, war hart, doch die Katze hatte gesagt, es ginge VORERST nicht. Also war es nicht unmöglich. Sollte ich dann nicht die Gelegenheit nutzen? Was hatte ich noch zu verlieren, wenn schon alles verloren war? Ich musste an Curtis denken. Er hätte eingewilligt, ohne darüber nachzudenken.
Ich setzte mich im Schneidersitz auf den Boden und wartete. Ich hätte sowieso nicht gewusst wohin, also würde ich hier einfach so lange sitzen, wie es nötig war. Ich schloss die Augen und atmete tief ein, um mich ein wenig zu beruhigen.
Als ich die Augen wieder öffnete, saß ich auf einem Bett. Ich sah mich um und begriff nur sehr langsam, dass ich in einem Zimmer war. In einem richtigen Schlafzimmer, mit Möbeln und Fenstern und Farben. Von draußen hörte ich typische Stadtgeräusche. Autos, Stimmen, Lärm.
Ich sprang auf, rannte zum Fenster und schob es nach oben. Ein Schwall heißer Luft kam mir entgegen. Es war Sommer.
»Freut mich, dass du es dir noch einmal überlegt hast.«
Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass die Katze auf dem Bett lag.
»Genießt du die Aussicht? Wir sind in New York, deinem neuen Zuhause.«
Zuhause. Ich spürte, wie mein Hals sich zuschnürte. Ich fühlte alles Mögliche, nur keine Freude.
Ich ging zu dem Stuhl, der vor dem Holzschreibtisch stand und ließ mich missmutig darauf nieder. »Und was soll ich jetzt tun? Ich soll mir Arbeit suchen, richtig, Katze?«
»Wie schon einmal erwähnt, heiße ich Lo und ich bin ein Kater, keine Katze. Und es ist nicht nötig, dass du auf Jobsuche gehst, denn du hast bereits einen. Aber vorerst hast du ein wenig Zeit, um dich einzugewöhnen. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du es erfahren.«
Dieses ganze In-Rätseln-sprechen ging mir gewaltig auf den Keks. Ich atmete geräuschvoll aus und erhob mich. »Und du wohnst jetzt mit mir hier?«
Er nickte.
Ich schlenderte los, um mir den Rest der Wohnung anzusehen. Neben dem Schlafzimmer war das kleine Bad mit Fenster und Badewanne.
»Hier ist noch Platz für ein Katzenklo.«
Ich hörte Los Pfoten, die um die Ecke huschten.
Er sprang auf den Toilettendeckel. »Es wird dich freuen zu hören, dass ich kein Katzenklo benötige, da ich keine Nahrung zu mir nehme.« Er schien belustigt über meine Annahme, er wäre ein normaler Kater und tatsächlich kam ich mir ein wenig blöd vor.
Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden.
Mir fiel etwas ein. »Moment mal. Wenn du nicht essen musst, wie ist das dann bei mir?«
Er machte eine Bewegung, die wie ein Schulterzucken aussah. »Du benötigst weniger Nahrung als zu Lebzeiten, dennoch musst du deinen Körper ernähren und gesund halten. Es wird noch sehr lange dauern, bis du die Nahrungsaufnahme vollkommen einstellen kannst, so wie ich.«
Ich ging weiter ins Wohnzimmer, in dem eine Couch, ein Schrank und ein Fernseher stand.
Ich ließ mich auf die Couch fallen. »Irgendwie fühl ich mich total erschöpft. Kann ich mich ein bisschen ausruhen?«
Lo tapste durch das Zimmer und legte sich auf die Fensterbank in die Sonne. »Es kostet eine Seele viel Kraft zurückzukehren. Deshalb brauchst du Erholung. Wenn das bedeutet, dass du lange schlafen musst, dann tu das bitte.«
Das, was Lo sagte, war wie ein Startsignal. Eine Einwilligung für einen langen und tiefen Schlaf.
Ich spürte, wie alles wieder verschwand. Es war erschreckend, dass sich das Einschlafen fast genauso anfühlte wie das Sterben. Eine Erlösung.
Meine Träume waren leider weit weniger erholsam. Ich sah Jim und meine Familie, die immer wieder nach mir fragten. Curtis, der auf dem Boden lag und sich vor Schmerz hin und her wand. Seine letzte Geste vor seinem Tod. Diese Siegesgeste hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt, genau wie der Schmerz kurz vor meinem Ableben.
Als ich wieder erwachte, stand mein Körper in Flammen. Ich hatte das Gefühl, wieder an jenem Ort zu sein, in dieser Situation ohne Hoffnung.
Bis ich erkannte, wo ich wirklich war. In New York, in meiner neuen Wohnung. Ich sah auf meinen Körper herab.
Lo saß dicht neben mir.
»Warum brennt mein Körper so?«
Ich rollte mich zusammen wie ein Häufchen Elend.
»Deine Gedanken und Gefühle kreisen immer noch um deinen Tod. Solange du nicht akzeptieren kannst, dass du gestorben bist und dich an deine Erinnerungen klammerst, wirst du den Schmerz nicht los. Sowohl den körperlichen, als auch alles andere.«
»Ich bin grad erst gestorben und soll jetzt alles vergessen? Wie soll das gehen? Das war ein ziemlich einschneidendes Erlebnis.«
Lo legte seine Vorderpfoten auf meine Seite. Er machte einen Satz, blieb einen Moment auf mir stehen, legte sich dann jedoch langsam hin. Ich fühlte, wie seine Wärme sich in mir ausbreitete und wie der Schmerz zurückwich.
»Ich verschließe die Emotionen, doch das wird nicht ewig so bleiben. Irgendwann musst du dich dem stellen. Und dabei kann ich dir leider nicht helfen.«
Er sprang auf den Boden und funkelte mich an.
Ich setzte mich langsam auf. »Danke. Aber ich versteh das alles nicht.«
»Das wirst du. Und du bist genau zur richtigen Zeit wieder aufgewacht. Es gibt Arbeit für uns. Zieh dich an und dann gehen wir in die Stadt. Alles Weitere erkläre ich dir dann.«
Ich ging ins Schlafzimmer und öffnete den Kleiderschrank.
»Lo, hier sind nur Wintersachen drin. Ich kann doch keinen Pullover im Hochsommer anziehen, dann sterbe ich gleich nochmal. Abgesehen davon, dass die Leute dann denken ich wär 'ne Spinnerin.«
»Ich glaube, diese Kleidung ist angemessen, Toni.«
Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Fenster und als ich näher heranging, konnte ich sehen, was er meinte.
Die Straße, die Häuser, alles war mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Ich starrte mit offenem Mund hinaus.
»Ich hab wohl länger geschlafen, als ich dachte.«
»Fast sechs Monate. Deine Seele brauchte einige Zeit, um sich zu erholen. Tatsächlich hatte ich gehofft, du würdest früher wieder aufwachen, denn mir war ziemlich langweilig.«
Ich musterte den braunen Pullover und strich mit der Hand über den glatten Stoff.
»Du bist die ganze Zeit bei mir geblieben?«
»Natürlich, ich bin dein Beschützer.«
Irgendwie freute es mich wahnsinnig, dass Lo sich um mich sorgte. Neben all den schlechten Gefühlen, wie der Einsamkeit und der Angst vor diesem neuen Leben, war er ein Halt, wenn auch nur ein sehr kleiner.
»Außerdem ist es mein Job, dich vor Schaden zu bewahren.«
Er glitt aus dem Zimmer und verschwand im dunklen Flur.
»Toll, danke.« Beleidigt warf ich das Stück Stoff wieder in den Schrank und wühlte weiter.
Offenbar konnte ich mir jegliches Gefühl für dieses Tier sparen. Ich war für ihn Arbeit, ein Job, nichts weiter.
Fragte sich nur, was meine Aufgabe sein würde.
Nach einer weiteren halben Stunde Schrankgewühl und hetzender Katzenkommentare fand ich etwas Brauchbares zum Anziehen.
Ein grauer Pullover, Jeans, eine grüne und eine rote Socke und ein dicker Mantel.
Ich schlüpfte in die braunen Schuhe und setzte widerwillig die Mütze mit Bommel auf.
Lo beobachtete mich mit einem breiten Lächeln. »Wunderbar, aber jetzt wird es auch höchste Zeit.«
Die Kälte draußen war fast unerträglich. Sobald ich einen Fuß vor die Tür gesetzt hatte, begannen meine Zähne wie verrückt zu klappern. Lo hatte sich auf meiner Schulter niedergelassen und mit jedem Schritt fühlte ich, wie sein Gewicht auf und ab hüpfte.
»Sag mal, wieso friere ich eigentlich so? Ich bin tot, hab ich eigentlich gar keine Sonderrechte?«
»Links«
Seine Pfote war in die Höhe geschnellt und wies mir den Weg. »Weil dein Körper wiederhergestellt wurde, genauso wie er vorher war. Er ist ein Geschenk, eine Notwendigkeit, um deine Aufgabe zu erfüllen. «
»Verstehe. Dafür, dass ich dir meine Seele verkauft hab, hab ich meinen Körper wieder.«
»Wenn du das so sehen möchtest, ja.«
Wir liefen eine ganze Weile durch die Straßen und ich fragte mich langsam, ob er überhaupt ein Ziel hatte oder ob er mich aus Langeweile so vorantrieb.
»Ich hab noch jede Menge fragen, Lo. Du hast mir eigentlich noch gar nichts erklärt und … «
Eine Frau lief an uns vorbei. Sie warf mir einen misstrauischen Blick zu und schnellte dann weiter.
»Oh verdammt, ich rede ja mit einer Katze. Die Leute müssen denken ich bin total irre.«
Ich war wirklich peinlich berührt, hatte ich doch vergessen, dass Lo das einzige sprechende Tier war und nur ich das wusste.
Ich spürte, wie sein kleiner Körper bebte, als ich begriff, dass er brummend vor sich hin lachte.
»Was ist so witzig? Du hättest mich ja dran erinnern können.«
Trotzig schlang ich die Arme um meinen noch immer vor Kälte zitternden Körper.
»Die Leute denken nicht du wärst verrückt, weil du mit einer Katze redest. Die Menschen können mich nicht sehen, sie denken wohl eher, du führst Selbstgespräche.«
Ich schüttelte den Kopf über so viel katzische Unverschämtheit und stapfte schneller voran.
Als ich nun sprach, achtete ich darauf, leise zu sein und meinen Mund nicht so sehr zu bewegen.