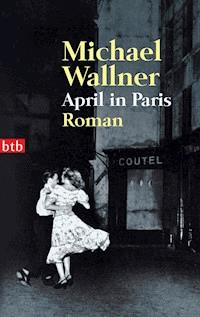9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mit »Shalom Berlin« legt Bestseller-Autor Michael Wallner den Auftaktband zu einer hochspannenden Krimiserie vor. Sein außergewöhnlicher Serien-Ermittler: Alain Liebermann, Leiter einer Berliner Spezialeinheit und Mitglied einer großen jüdischen Familie. Aktuell, aufwühlend, fesselnd präsentiert »Shalom Berlin« einen zeitnahen und brisanten Fall um Antisemitismus, Angst und Gewalt. Nach Veröffentlichung eines Artikels über die Schändung eines jüdischen Berliner Friedhofs wird die Journalistin Hanna Golden per Mail mit dem Tod bedroht. Den Fall übernimmt Alain Liebermann, Mitglied des Mobilen Einsatzkommandos Staatsschutz und Spezialist für Terrorbekämpfung. Erscheint der Tatbestand zunächst beinahe harmlos, eskaliert er doch bald. Aus Worten werden brutale, mysteriöse Taten, die Vernetzung des Falles reicht bis in die Berliner Bundespolitik. Alain kann nicht verhindern, dass seine jüdische Familie in die Sache mit hineingezogen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Shalom Berlin« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Leopold
© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Stephen Mulcahey / arcangel images; RICOWde / getty images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1 Mischpoke
2 Schönhauser Allee
3 St. Hedwig
4 Connecting
5 Auge um Auge
6 Kreuzigung
7 Vielleicht wegen der Hitze
8 Der Dritte Mann
9 Besuchszeit
10 Der Fuchs
11 Gebissen
12 Tempelhof
13 Eichen
14 Shalom
15 Die alte Frau Schmidt
16 Neugeboren
17 Panik um zwei
18 Das klare Licht
19 Im Pavillon
20 Zugriff
21 Über die Liebe
22 Über die Liebe II
23 Drei Köpfe
24 Penélope
25 Der Beamte
26 Der Jahrestag
27 Stern
28 Judenfriedhof
29 Ein großes Staunen
30 Über die Liebe III
31 Unser Staat
1
Mischpoke
»Hör zu, ich habe immer versucht, dir beizubringen, dass du dich früher oder später mit dem Herrn über uns arrangieren musst.«
»Der Herr über uns, wer soll das sein? Hast du etwa mein altes Kinderzimmer vermietet?« Frank nahm sich vom kalten Fisch und streifte mit dem Löffel die Senfsoße ab.
»Versündige dich nicht. Irgendwann zahlst du die Zeche. Dann musst du dich arrangieren mit Gott. Du bist ein verheirateter Mann. Das ist der springende Punkt. Verstehst du? Du kannst nicht zwei Pferde mit einem Hintern reiten. Verstehst du mich? Nimm dir Alain als Beispiel.«
»Ich will mir Alain aber nicht als Beispiel nehmen.« Frank griff in den Brotkorb. »Jedes Mal, wenn ich mir Alain als Beispiel nehme, fühle ich mich hinterher minderwertig. Gegen Alain kommt keiner von uns an. Wenn es nach dir geht, stellt er uns alle in den Schatten.«
Ein strenger Blick durch Helenes Prismenbrille und Frank hielt den Mund. Ohne Brille schielte Helene. Sie hatte nie etwas gegen ihr Schielen unternommen und würde es bis an ihr Lebensende nicht tun. »Ich liebe jeden einzelnen meiner Enkel. Aber Alain hat die Dinge im Griff. Das ist alles. Mehr sage ich nicht. Alain hat die Dinge im Griff.«
Alain stand in der Doppelflügeltür. Das hatte den Vorteil, dass er mit einem einzigen Schritt das Zimmer wechseln konnte, falls er einem Gespräch entgehen wollte.
Alain wechselte das Zimmer. Ihm gefiel es nicht, wenn seine Großmutter so über ihn sprach. Ihm gefiel die Vorstellung nicht, dass überhaupt irgendwer über ihn sprach. Ihm gefiel die Vorstellung, jetzt gleich aus dem vierten Stock zu springen. Helenes Wohnung hatte einen Balkon. Es wäre die einfachste Methode, um ihr zu beweisen, dass er die Dinge nicht im Griff hatte. Lea war nun seit einem Jahr tot, und er hatte noch keinen vernünftigen Grund gefunden weiterzuleben.
Frank, sein Cousin, kam ihm entgegen, den Fischteller in der Hand. Frank war Zahnarzt in Schöneberg. Seine Frau war Lektorin, seine Geliebte lehrte englische Literatur an der Uni. Es ging der Witz um, dass Franks Frau und Franks Geliebte sich miteinander besser verstehen würden als mit Frank.
»Na?«, sagte Frank.
»So«, nickte Alain und ging ins dunkelgrüne Zimmer weiter.
Helenes Wohnung hatte zweihundertvierzig Quadratmeter. Heutzutage hätte kein Mensch eine Wohnung wie diese nahe des Kurfürstendamms bezahlen können. Aber Helenes Mietvertrag stammte aus dem Jahr 1936 und war nie gekündigt worden. Angeblich war das dunkelgrüne Zimmer irgendwann hellgrün gewesen, wahrscheinlich auch 1936. Heute war Helenes fünfundneunzigster Geburtstag. Als sie zur Welt kam, wurde Hindenburg Reichspräsident, man entließ den Gefangenen Hitler aus der Festung Landsberg, und er veröffentlichte Mein Kampf. Kafkas Romanfragment Der Prozess erschien. Hildegard Knef kam zur Welt.
Wenn Helene Geburtstag hatte, waren sie alle da, die Liebermanns, der komplette Clan, sie kamen aus Seattle und Kanada, aus Riga, Kopenhagen und praktisch allen Teilen Deutschlands. Sie kamen zu Ehren der Matriarchin.
Alain trat zur kleinen Gruppe der Künstler in der Familie. Nicht weil er sich mit ihnen lieber unterhielt, sondern weil die Künstler vorwiegend Trübsal bliesen. Sie beklagten sich in einem fort und beschworen die alten Zeiten, als alles noch besser war. In dieser Umgebung fühlte Alain sich wohl.
»Als ich angefangen habe, da gab es die Mauer noch, konnte ich jedes Jahr wenigstens ein- oder zweimal in Berlin auftreten.« Cousin Caspar machte Platz, damit Alain sich zu ihnen stellen konnte. »Nichts Großartiges, kleine Rollen in der Vagantenbühne, mal im Theater unter dem Dach, aber ich habe immerhin in Berlin gespielt. Und heute? Vorigen Monat hatte ich ein Vorsprechen in Cottbus. Davor habe ich Musical in Neustrelitz gespielt. Kann man sich das vorstellen?«
»Mit Neustrelitz hattest du noch Glück«, erwiderte Alains Nichte Anna. »Mein Tiefpunkt, und ich meine den absoluten Tiefpunkt, war Brecht in Gera. Wenn du Brecht in Gera spielst, kannst du genauso gut tot sein.« Nachdenklich betrachtete sie eine Cocktailtomate. »Heutzutage brauchst du gute Nerven, um arbeiten zu können.«
»Und gute Reifen.«
»Gute Nerven und gute Reifen«, bestätigte Anna.
Alain wollte ihr etwas Ermunterndes sagen, aber er hatte weder von Brecht noch von Gera eine Ahnung. Das lila T-Shirt stand Anna nicht, fand er, und mit diesen Beinen sollte sie besser keine Leggins tragen. Chauvi, dachte Alain. Lea hatte ihn manchmal Chauvi genannt, meistens liebevoll. In ihren letzten Wochen hatte Lea behauptet, Alain habe ein gutes Herz und sei ein verdammt süßer Kerl. Er solle um sie trauern, natürlich, aber nicht zu lange. Er solle seinen Humor nicht verlieren. Alle Liebermanns hätten Humor, sie, Lea, könne das beurteilen, weil sie in den Liebermann-Clan nur eingeheiratet hätte. Alain solle sich auf ihrer Leichenfeier amüsieren, trug sie ihm auf. Nach dem Begräbnis hatte Onkel Chaijm tatsächlich eine Party geschmissen. Kaum vorstellbar, aber Alain hatte sogar getanzt. Das hätte Lea gefallen. Hinterher hatte er sich übergeben müssen.
Jetzt trank er Chardonnay und suchte seinen Onkel Chaijm unter den Gästen.
»Hundertfünfzig Euro wollten die haben für ein Zimmer mit Bett. Haben Sie nichts Billigeres?, frage ich. Sagt er, Sie können auch ein Zimmer für fünfzig Euro kriegen, aber da müssen Sie Ihr Bett selbst machen. Das nehm ich, sage ich. Da bringt er mir einen Hammer und ein paar Bretter und Nägel.«
Onkel Chaijm war Rabbiner. Der öffentliche Auftritt vor der Gemeinde gehörte zu seinem Job. Wenn er die Synagoge verließ, vergaß er jedoch häufig, den öffentlichen Chaijm abzulegen. Man hörte ihm einfach gerne zu. Er hatte eine Stimme, die ohne Verstärkung in den hintersten Winkel selbst des größten Raumes drang. Outgoing, so nannte man das wohl, daran erkannte man die Liebermanns, sie waren outgoing.
Warum bin ich so anders als meine Familie?, dachte Alain. Ich bin der langweiligste Liebermann von allen.
»Vegele.« Die Großmutter rief ihn. »Komm her.«
Alains Wein war abgestanden, er holte sich ein frisches Glas.
»Erzähl mir, wie ist es dir ergangen?« Sie legte den Arm um seine Hüfte.
»Es gibt nicht viel Neues, Oma.«
»Traurig bist du, mein Vegele. Du trägst deine Traurigkeit durch die Wohnung wie eine Handvoll tropfender Erdbeeren, die schimmelig geworden sind.«
»Tut mir leid, wenn ich dir die Feier vermiese.«
»Traurig ist gut, hör mir zu. Traurig ist, wenn man im Winter die Saat ausbringt für den nächsten Frühling. Traurig ist Eis und Schnee, und darunter wartet der Same, und im Frühling wird alles grün.«
»Wir haben Sommer, Oma.«
»Du, mach dich nicht lustig über deine Bubbe«, sagte sie mit Blick durch die Prismenbrille.
Er küsste sie auf die Wange. »Happy Birthday, Oma.«
»Hast du mir eine Geburtstagskarte geschrieben?«
»Hab ich. Mein Geschenk liegt dort drüben.«
»Von drei Leuten habe ich die gleiche Geburtstagskarte gekriegt. Gehörst du auch dazu? Kauft ihr etwa alle im selben Papiergeschäft ein?« Helene bedeutete Anna, dass sie noch etwas trinken wollte.
»Das hätte ich dir doch auch bringen können.« Alain setzte sich vor der Großmutter auf den Boden, da neben Helenes Thron, einem Makart-Sessel aus der Vornazizeit, keine andere Sitzgelegenheit stand.
»Was möchtest du trinken?«, fragte Anna.
»Sherry. Nein, warte, lieber Cognac.« Helene beugte sich zu Alain. »Du auch?«
»Lea hat mir Alkohol verboten.« Er zuckte die Schultern.
»Und du hältst dich immer noch daran?«
»Lea sagt, wenn ich trinke, macht das alles nur schlimmer.«
»Eine kluge Frau, deine Lea.«
Anna kam mit dem Cognac und blieb bei den beiden stehen, bis das bleierne Schweigen von Großmutter und Enkel ihr verdeutlichte, dass sie hier nichts verloren hatte.
»So schlimm?«, fragte Helene.
»So schlimm.« Es gefiel ihm, bei ihr zu sitzen, der großartigen alten Frau, die den Liebermann-Clan durch die Jahrzehnte geführt hatte, durch all die dummen und schlechten und hoffnungsvollen Zeiten, bis heute. Er kam sich dann wie der kleine Junge von früher vor. So wie er dasaß, sah er eher wie Helenes Hofnarr aus.
»Es gibt nur einen Weg, wie es mir besser gehen könnte«, sagte er nach einer Weile. »Wenn Lea da wäre. Und das wird nicht passieren. Es ist unmöglich. Warum soll es mir also besser gehen?«
»Was macht deine Arbeit?«
Er sah zu ihr hoch. Wenn man über neunzig war, bekam die Haut eine andere Bedeutung. Die Haut war wie ein Buch, so viele Kapitel, so viele überraschende Wendungen zeichneten sich in diesem Gesicht ab. Ihre Augen lagen tief zwischen den Lidern versteckt, manchmal glaubte man, Helene hätte sie geschlossen. Aber niemand durchschaute mehr als sie. Alles, jeden.
»Ich weiß, du darfst nicht über deine Arbeit sprechen«, antwortete sie sich an seiner Stelle gleich selbst.
»Diese Woche war nichts Besonderes los.« Er nahm ihre Hand, die auf der Armlehne lag. »Aber was das große Ganze betrifft: Es wird mehr. Es wird sogar beängstigend mehr.«
»Geht es um die Unsrigen?«, fragte Helene und erwiderte seinen Händedruck.
»Ja. Meistens. Es geht um die Juden.«
Sie trank ihren Cognac. »Die Juden und die Radfahrer, heißt es nicht so?«
»Wieso die Radfahrer?« Entdeckte Alain da ein winziges Funkeln in Helenes Blick? »Wieso die Radfahrer?«
»Wieso die Juden?« Sie lächelte. Es war der ernsteste Ausdruck, den er in diesem Gesicht kannte.
Alain kam auf die Beine. »Ich muss, Großmutter.«
»Schon gut, Vegele.« Sie streichelte ihn. »Geh nur.«
»Ist besser, bevor ich noch mehr tropfende Erdbeeren durch deine Wohnung trage. Happy Birthday, Oma.«
»Fahr vorsichtig, Vegele.«
An der Garderobe musste er seinen Motorradhelm erst suchen. Irgendeines von den Kindern hatte damit gespielt. Alains Blick fiel in den riesigen Spiegel im Goldrahmen. Weil er so braun gebrannt war, sah man nicht gleich, wie schlecht es ihm ging. Aber die grauen Haare an den Schläfen erkannte man sogar im Dämmerlicht.
Von drinnen ertönte Gelächter.
»Die Leute saßen da wie ein Betonwerk«, rief Onkel Chaijm über das Gelächter hinweg. »Wie ein geschlossenes Betonwerk!«
Alain verließ Helenes Wohnung. Das Lachen folgte ihm ins Treppenhaus.
2
Schönhauser Allee
Sturmtief Leonore hatte gewütet. Linden, Birken, Weiden, uralt allesamt, waren zusammengestürzt wie Mikadostäbchen. Die Kettensägen wüteten. Bei dem Lärm wünschte Hanna, sie hätte sich einen anderen Tag für ihren Besuch ausgesucht. Berliner Forsten stand auf den orangefarbenen Fahrzeugen, die auf dem jüdischen Friedhof parkten. Berliner Forsten – war das Deutsch? Der Forst – die Forste. Sie googelte es und fand sich bestätigt. Hanna berichtete nicht über die Forste(n), nicht über das Sturmtief, sie sollte über die Grabschändung schreiben. Es gefiel ihr nur mäßig, dass sie dabei »geführt« wurde. Unbeobachtet sein, nichts wissen, nur schauen, selbst nachfragen, so recherchierte sie am liebsten.
Der Friedhofsaufseher kannte die bewusste Stelle und zeigte sie dem Beauftragten der jüdischen Kultusgemeinde. Der Beauftragte der jüdischen Kultusgemeinde, ein netter Mann, blass, Brillenträger, hatte einen Lokalaugenschein angesetzt. Hanna schrieb keine Polizeireportage, sie wollte keinen Lokalaugenschein. Die Fakten würde man auch bei den anderen lesen können. Hanna wollte das Phänomen anpacken, die Story hinter der Story. Das war allerdings nicht ihr Auftrag, wenn sie ehrlich war. »Mach was über die Schmiererei in Prenzlberg«, lautete ihr Auftrag. Dafür würde sie in der Printausgabe bestenfalls eine Spalte kriegen. Hanna wollte für die Onlineausgabe schreiben. Antisemitismus, nicht unbedingt ihr cup of tea. Society, Mode, Travel Magazin, solche Sachen hatte sie bisher veröffentlicht. Antisemitismus traute ihr keiner zu.
Nur wenige wussten, dass Hanna verheiratet gewesen war. Mit dem heutigen Auftrag bekam sie die Chance, ihre eigene Erfahrung einzubringen. Bis zu ihrem dreiundzwanzigsten Lebensjahr hatte sie Hanna Grässle geheißen, ein schwäbisches Mädle vom Dorf, dunkelhaarig, glutäugig. Sie war nach Berlin gezogen, hatte Elias Golden kennengelernt und bald darauf geheiratet. Von diesem Tag an hatte sie Hanna Golden geheißen, dunkelhaarig, glutäugig. Es war, als ob sie mit dem Namen auch die Hautfarbe gewechselt hätte. Man behandelte Hanna Golden anders, als man Hanna Grässle behandelt hatte. Auch heute noch, achtzig Jahre danach. Nein, heute schon wieder. Heute sogar auf eine Weise, die sie nicht für möglich gehalten hätte.
»Ich kenne gar keine Juden«, sagte ihr Vater, der Polizist aus Nürtingen, manchmal.
»Natürlich nicht«, war Hannas Antwort. »Weil dein Großvater dabei geholfen hat, sie alle umzubringen.«
Die Sache mit Elias war nicht gut gegangen. Das Judentum hatte nichts damit zu tun. Sie trafen sich noch manchmal, jedes Mal fragte sich Hanna, wieso und warum sie geglaubt hatte, dass Elias ihr Mann fürs Leben sei. Schwamm drüber. Sie war neunundzwanzig, Berlin war ihre Stadt.
Seit Elias hatte sie zwei Affären gehabt, auch hier: Schwamm drüber.
Und Leon? Wollte sie die Beziehung mit Leon überhaupt? Er war ichbezogen, ungezogen, neigte zu Depressionen, er legte ein Mega-Ego an den Tag, war tief drin ängstlich und deshalb ungerecht. Leon war einer, der glänzen konnte. Leon war einer, der wehtun konnte.
Der Beauftragte der jüdischen Kultusgemeinde redete gleichmäßig in einem fort, das fiel Hanna auf. Es fanden sich keinerlei Amplituden in seinen Sätzen, stetig floss sein Vortrag dahin, wessen Grab da geschändet worden sei und welche Botschaft er dahinter vermute. Hanna wollte die Botschaft nicht hören, sie wollte die Sache selbst entschlüsseln. Sie war froh, dass die Kettensägen so laut waren, dass sie nur Bruchstücke seiner Rede verstand. Sie hatte sich über den Friedhof kundig gemacht. Beeindruckend, wer hier alles lag, beeindruckend, wie die Menschen im 19. Jahrhundert ihre Gräber gestaltet hatten, wohlhabende Leute zumeist. Die letzte Ruhestätte von Giacomo Meyerbeer lag unweit der zertrümmerten Grabplatte. Am erstaunlichsten fand Hanna, dass der Friedhof keine drei Kilometer von jenem Punkt entfernt lag, wo der Zerstörer des jüdischen Lebens in seinem Bunker gehockt hatte, bevor er sich eine Kugel in den Kopf jagte. Die Gräber seiner Erzfeinde hatten den Holocaust unbeschadet überstanden. Man hatte damals keine Zeit für jüdische Grabsteine gehabt. Heute zertrümmerten anonyme Täter Marmor und Granit mit dem Vorschlaghammer, um ein Zeichen zu setzen.
Hanna beobachtete zwei Touristen. Die Frau im roten luftdurchlässigen Anorak, der Mann im blauen luftdurchlässigen Anorak. Zwei Anoraks im Hochsommer. Bisher war das noch kein richtiger Sommer, eher einer, der den Leugnern des Klimawandels in die Hände spielte. Fünfzehn Grad und Dauerregen. Der Mann fotografierte nicht so sehr den Friedhof, sondern das Chaos der umgekippten Stämme, die der Sturm in die Kronen anderer Bäume geschleudert hatte. Die Männer der Berliner Forste(n) mussten die Sturmschäden vorsichtig heraussägen und abtransportieren. Kein Grab sollte Schaden nehmen, kein weiteres Grab.
Hanna betrachtete den Marmor. Rau und kantig sahen die Bruchstellen aus, wo der Stein unter der Gewalt des Hammers zersprungen war, spiegelnd glatt war die Oberfläche. Die goldenen Buchstaben konnte man noch gut lesen: Joel, Sohn des Herrn Me’ir, dann brach es ab. Vom Beauftragten der Kultusgemeinde erfuhr Hanna, dass dieser Sohn des Herrn Me’ir ein Frommer der Priesterschaft gewesen sei und sein Grab mit dem Ehrentitel Pflanzstätte von Märtyrern bedacht worden war. Ein enormer Hammer musste nötig gewesen sein, um diesen Stein zu zertrümmern. Wie schaffte man einen Vorschlaghammer auf einen Friedhof? Das Haupttor war nachts geschlossen, die Mauer schwer überwindlich, da sie zur Schönhauser Allee hin lag, wo auch nachts Passanten und Autos unterwegs waren. Mit seiner Ostseite grenzte der Friedhof allerdings an den Judengang, eine schmale Schneise zwischen der Friedhofsmauer und den Wohnhäusern der Kollwitzstraße. Die Mauer war an manchen Stellen so niedrig, dass eine Gartenleiter genügte, um sie zu überwinden.
»Danke, das war wirklich sehr aufschlussreich«, schrie Hanna über die Kettensägen hinweg.
»Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen noch …«
Naturgemäß verstand sie nicht, was er ihr zeigen wollte, verabschiedete sich so höflich wie nötig und machte sich auf den Weg zum Judengang. Der Grund, weshalb dieser Pfad angelegt werden musste, war bezeichnend. König Friedrich Wilhelm III. hatte auf seinen Fahrten zum Lustschloss Schönhausen keinem Leichenzug begegnen wollen, darum hatten die jüdischen Toten zum Hintereingang ausweichen müssen.
Ja, die Eitelkeit, dachte Hanna, die Eitelkeit war eigentlich ihre liebste Todsünde. Bis heute verdankten die Medien es vor allem der Eitelkeit des Menschen, dass sie überhaupt existierten.
***
Die Stimme des Direktors brach weg. Warum war er nicht zu Hause geblieben, wenn es ihm so schlecht ging?, überlegte Alain. Der Vize hätte die Statistik genauso gut herunterleiern können. Dreifach gecheckt, sauber gebunden, zum Sterben langweilig, das »Weißbuch Staatsschutz« lag auf dem Schoß der meisten Journalisten im Saal. Manche blätterten darin, die wenigsten machten sich die Mühe. Manche schrieben mit, die Schlaueren hatten ihre Handys erhoben und zeichneten die Worte des Direktors auf. Mithilfe des Spracherkennungsprogramms würden sie den Vortrag später in eine Datei umwandeln. Wenn ihr euch da mal nicht geschnitten habt, dachte Alain. Bei dem Gekrächze dürfte euch die Technik im Stich lassen. Verstärkt durch das Mikro klang der Vortrag zum Erbarmen. Alain war drauf und dran, seinem Chef das Wasserglas näher zu schieben, damit er seine Kehle benetzen konnte, aber er ließ es bleiben. Nur nicht in den Fokus der Medien geraten, lautete Alains Mantra.
Der Direktor räusperte sich. »In Berlin wurden im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes insgesamt 4380 Fälle von politisch motivierter Kriminalität registriert. Damit ist das Fallaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 387 Fälle gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 13,7 Prozent. Während sich bei Propagandadelikten der rückläufige Trend fortsetzt, stiegen die Fallzahlen bei den Gewaltdelikten um 18 Prozent. In den Deliktbereichen Beleidigung / Verleumdung / Volksverhetzung ist der Anstieg eklatant, nämlich um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommt, dass der Zustrom geflüchteter und asylbegehrender Menschen in der Bundeshauptstadt …«
Und das war’s. Weiter kam der Direktor nicht, die Stimme ließ ihn endgültig im Stich. Er entschuldigte sich und reichte das Papier an den Vize weiter.
Alain saß so weit außen am Tisch der Pressekonferenz, dass er kaum befürchten musste, irgendetwas gefragt zu werden. Zu einem Termin wie diesem wurden die Presseleute gewöhnlich abkommandiert. Keiner von ihnen war freiwillig hier. Bestimmt zählten sie die Minuten, bis es vorbei sein würde. Unbehelligt lehnte Alain sich zurück.
Statistik schön und gut, aber es waren ja nicht nur die Pöbler und Drangsalierer, die Hakenkreuzschmierer und die besoffenen Nazis. Inzwischen kamen die Cybertäter dazu, schwer zu verfolgen, feige tauchten sie in der Anonymität des Internets unter.
Und dann gab es die kleinen Vorkommnisse, die in keiner Statistik vermerkt wurden. Alains Cousin Frank, der Zahnarzt, hatte ihm erzählt, wie zwei alte Damen einmal in die Praxis gekommen waren. Ein freundlicher Senior half ihnen aus den Mänteln. Den Frauen fiel dessen Davidsternkette auf, sie fragten ihn nach deren Bedeutung. Nach seiner Erklärung sahen sie ihn verächtlich an und sagten: »Ach, hat man Sie damals vergessen?« Alains Cousin hörte die Szene durch die offene Tür des Behandlungsraumes. Das Wartezimmer sei voll gewesen. Sämtliche Anwesenden hätten geschwiegen und so getan, als sei nichts passiert. Schließlich war Frank ins Wartezimmer gegangen und hatte die alten Schachteln hinausgeworfen. Sie waren schockiert, sonst sei der Doktor doch so nett zu ihnen. Die Praxis lief nicht unter dem Namen Liebermann, Frank war Teilhaber von Frau Dr. Schmitz. Hinter dem Praxisnamen Schmitz hatten die Antisemitinnen keinen jüdischen Zahnarzt vermutet.
»Herr Liebermann?«
Alain zuckte zusammen. Hatte er etwas verpasst? Hatte er eine Frage überhört?
»Ja?«
»Wenn Sie als Jude im Jahr 2020 vor einem Hakenkreuz stehen, vor einem Graffiti, auf dem Juden karikiert werden, wenn Sie Drohanrufen nachgehen oder U-Bahn-Randalen, bei denen Israel muss brennen geschrien wird, was fühlen Sie dann?«
Die gefürchtete Was-fühlen-Sie-Frage. Alain versuchte, sich der Was-fühlen-Sie-Frage zu entziehen, so oft er konnte. Eigentlich sollte die Frage nicht lauten, was er als Jude fühlte, sondern wie jedermann sich fühlen müsste, wenn er mit solchen Vorfällen konfrontiert war. Alain wusste, welche Antwort die sympathische Journalistin hören wollte. War sie wirklich sympathisch? War sie nicht eher berechnend? Wollte sie von ihm nicht nur die Headline für ihre Reportage geliefert bekommen?
»Betroffener Ermittler – fühle mich als Jude gedemütigt.«
So oder so ähnlich würde es dann da stehen. Aber den Gefallen tat er ihr nicht.
»Eine Berlinerin hat neulich einen Telefonanruf bekommen«, erwiderte er, als sei die Was-fühlen-Sie-Frage nicht gestellt worden. »Der Anrufer sagte: Hier spricht Gauleiter Hansen, machen Sie sich für Ihre Deportation bereit. Der Mann hatte offenbar schlecht recherchiert, denn die Frau war gar keine Jüdin.«
»Was unternehmen Sie in solchen Fällen, Herr Liebermann?«, fragte die Journalistin.
»Ich habe der Frau eine Trillerpfeife besorgt. Die liegt jetzt griffbereit neben ihrem Telefon. Gauleiter Hansen hat bald darauf wieder angerufen. Danach dürfte er allerdings einen guten HNO gebraucht haben.«
Zu flapsig, zu cool, zu abgebrüht, dachte Alain. Er brauchte gar nicht hinzusehen, um den tadelnden Blick seines Direktors zu spüren. So redete man nicht mit der Presse. Die Presse wollte Betroffenheitsrhetorik hören, weil Betroffenheitsrhetorik sich am besten verkaufte. Ein cooler Jude mit Dreitagebart, der abgebrühte Antworten gab, kam in den Medien nicht gut an. Bei jedem anderen Thema vielleicht, nicht bei Antisemitismus. Über Antisemitismus durfte nicht einmal ein Jude coole Dinge sagen.
Ich bin kein cooler Jude, dachte Alain, ich vermisse Lea. Warum kann Lea nicht hier sein? Sie hätte mich verstanden.
Unter dem Tisch öffnete er sein Handy und tippte Leas Foto an, dieses süße Foto, auf dem sie vor ihrem eigenen Schatten erschrocken war.
Am meisten erschrecken wir vor unseren Schatten – so ein Satz hätte der unsympathischen Journalistin gefallen. Aber er würde sich hüten, ihr solches Futter zu geben.
3
St. Hedwig
Hanna wollte mit Leon etwas unternehmen. Leon dagegen wollte arbeiten. Das nannte man einen Konflikt.
Leon studierte Kunst und Design. Den halben Tag lang arbeitete er jetzt schon an seinem neuen Projekt. Hanna hatte sich nicht beklagt. Einmal war er kurz aus dem Zimmer gekommen, um sich einen Kaffee zu holen, und war wieder verschwunden. Hanna hatte sich nicht beklagt. Mittlerweile verzog sich die Sonne hinter dem Haus. Hanna wollte mit Leon im Sonnenschein essen und hatte deshalb auf dem Balkon gedeckt.
Jetzt reichte es. Sie ging in ihr Arbeitszimmer, das Leon als sein Arbeitszimmer annektierte. Leon hatte eine eigene Wohnung in Berlin, aber wenn er da war, wohnte er bei Hanna. Leon besaß Geld. Seine Mutter besaß Geld. Leon studierte Kunst in London. Er war nur ein Jahr jünger als Hanna, aber er studierte immer noch. Zunächst hatte er Grafikdesign in Barcelona belegt, es gefiel ihm nicht. Er wollte lieber Komponist werden, doch dafür fehlte ihm das nötige Talent. Mittlerweile versuchte er sich als bildender Künstler. Seine derzeitige Leidenschaft waren Collagen, übermalte Fotos, verzerrte Gesichter und Körper, in grelle Farben getaucht. Leon brauchte viel Verständnis, er forderte Verständnis, und Hanna war jemand, der eine Menge Verständnis für jemanden aufbrachte, in den sie verliebt war.
»So ein schöner Tag«, sagte sie in der Tür zu ihrem Arbeitszimmer. »Hast du nicht allmählich genug gearbeitet? Lass uns rausgehen.« Ganz lieb trug sie das vor, mit Heiterkeit in der Stimme, ohne Druck aufzubauen.
Leon sog die Luft ein, ein hartes, scharfes Geräusch. Es war sein Zeichen, dass Hanna ihn zur Unzeit störte.
»Ich mag nicht den ganzen Tag auf dich warten«, hakte sie trotzdem nach.
»Den ganzen Tag? Es ist grade mal drei.«
»Die Sonne verschwindet gleich. Übermorgen musst du wieder zurück nach London. Wir haben gar nichts voneinander.«
Hörte sich das weinerlich an oder flehentlich? Klammerte Hanna etwa? Hatte es etwas Bedürftiges, wenn sie ihn anbettelte, bei ihr zu sein, bevor er wieder ins tolle kreative London entschwinden würde?
»Ich habe nämlich auch noch einiges zu tun«, setzte sie hinzu, um ihren Stolz zu wahren. Hannas Artikel über die Schändung des jüdischen Friedhofs hatte Aufsehen erregt, was ihre Redaktion aber nicht veranlasste, sie weiterhin mit ähnlich herausfordernden Aufgaben zu betrauen. Ihr derzeitiges Feature, kalorienarme Sommerrezepte mit Fenchel, konnte warten, bis Leon abgereist war. Das brauchte er allerdings nicht zu wissen.
»Gib mir noch zwanzig Minuten.« Er wandte den Blick nicht von der Fotocollage.
»Deine zwanzig Minuten bedeuten mindestens eine Stunde.«
»Schau auf die Uhr. Um Viertel vor mache ich die Klappe zu, versprochen.«
»Viertel vor. Ich nehm dich beim Wort.«
Sie lächelte, froh, dass sie bei ihm etwas erreicht hatte. Sie kehrte in die Küche zurück und gab dem Hund sein Fressen. Während sie die Dose öffnete, drehte sich die Spanieldame aufgeregt im Kreis.
»Ja, du bist auch ein Mädchen, das zu wenig Beachtung kriegt, stimmt’s?« Hanna streichelte Ramona. »Du bist ein braves Mädchen.«
Ramona winselte und fraß. Hanna freute sich darauf, nach dem Essen mit Leon und Ramona einen langen Spaziergang zu machen, zur Museumsinsel und an der Spree entlang. Sie setzte sich an den Küchentisch und holte ihren Laptop aus dem Ruhezustand. Fünf E-Mails waren eingegangen, sie kamen von ein und demselben Absender. Die Adresse war ihr unbekannt. Trotzdem waren die Nachrichten nicht im Spam gelandet. Hanna öffnete die erste E-Mail. Die Betreffzeile klang vielversprechend: Die Quelle des Rassismus.
***
»Alain?«
»Ja.«
»Wann kommst du?«
»So schnell ich kann.«
»Du hättest vor einer Viertelstunde hier sein sollen«, sagte Velkan am Telefon.
»Mir ist etwas dazwischengekommen.« Alain bedeutete der Frau, die vor ihm auf dem Pflaster lag, sich nicht vom Fleck zu rühren.
»Mir ist doch gar nichts passiert«, flüsterte die Frau auf dem Pflaster, um Alains Telefonat nicht zu stören. Sie kam auf die Knie hoch.
Er hielt das Handy zu. »Bitte laufen Sie nicht weg.«
»Ich habe einen Termin.«
»Ich auch.«
»Warum können wir nicht einfach sagen, es sei nichts passiert?« Die Frau untersuchte den Riss an ihrem Blusenärmel.
»Weil ich die Dinge so nicht regeln darf«, antwortete er. »Ich darf Sie nicht einfach weitergehen lassen, verstehen Sie? Ich bin von der Polizei.«
»Wirklich?« Die Frau, die gerade von Alain angefahren worden war, lächelte. »Na, ich hab ja vielleicht ein Glück.«
Alains Motorrad lag auf der Seite. Benzin trat aus. Seine Jeans war voll Öl, er blutete am Oberschenkel. Die rechte Socke war angesengt, weil der heiße Auspuff auf seinem Fuß gelandet war. Im letzten Moment hatte er die Maschine herumgerissen und durch seinen Sturz verhindert, dass er die Passantin überfuhr.
»Hallo?«, machte Velkan am anderen Ende auf sich aufmerksam. »Hier ist eine Frau für dich.«
»Hier ist auch eine Frau.« Alain biss die Zähne zusammen. Sein Knöchel tat weh.
»Aber die Frau hier hat einen Termin mit dir.«
»Wie heißt sie?«
»Wie heißen Sie?«, fragte Velkan jemanden am anderen Ende. »Sie sagt, sie heißt Hanna Golden.«
»Ja, richtig, ich weiß. Sag ihr, ich komme so schnell, wie ich kann. Sie soll warten. Oder noch besser, jemand vom Team soll mit ihr reden.«
»Das will sie nicht. Sie sagt, sie hat dich im Fernsehen gesehen und will mit dir sprechen.«
»Okay, ja, okay«, brach es aus Alain hervor. Sein dummes Statement auf der Pressekonferenz war im Ersten und im Zweiten gesendet worden. Er hätte besser die Klappe gehalten. »Ich bin gleich da.«
Alain unterbrach die Leitung, wählte die Nummer der Polizeiwachstube Brunnenstraße und informierte die Kollegen, dass ein Notarzt gebraucht werde. Danach trat er zu der Frau auf dem Pflaster. »Wie geht es Ihnen?« Er musterte ihre zerrissene Bluse.
»Halb so schlimm.« Vorsichtig kam sie auf die Beine. Als sie sich bückte, um ihre Handtasche aufzuheben, wurde ihr schwindlig. Sie machte ein paar unbeholfene Schritte und setzte sich zitternd wieder auf den Boden. Alain bettete ihren Kopf auf seine Lederjacke und legte ihre Beine auf seinen Motorradhelm. »Nicht bewegen.« Sein Blick fiel auf die Schaulustigen, die in der schwach befahrenen Straße stehen geblieben waren.
»Soll ich einen Krankenwagen rufen?«, fragte einer.
»Ist schon unterwegs.« Er beugte sich zu der Frau. »Wir bringen Sie ins Krankenhaus.« Als sie protestierte, drückte er sie sanft zu Boden.
Aus außergewöhnlich blauen Augen sah sie ihn an. »Was sind denn Sie für ein seltener Samariter?«
Alain bemerkte, dass die dunkle Lache um sein Motorrad größer wurde.
Der Krankenwagen brachte die verunglückte Frau nicht in die Charité, sondern in das kleinere St.-Hedwig-Spital. Versteckt lag es in der Großen Hamburger Straße und wirkte von außen wie ein Stiftskloster mitten in der Stadt. Es war das älteste katholische Krankenhaus Berlins. Hier gab es keine Pförtner, sondern Nonnen, keine Krankenschwestern, sondern Ordensschwestern.
Dieser Ort hatte Alain damals sofort für sich eingenommen. »Hier ist es gut«, hatte er zu Lea gesagt. Es war Leas letzte Station gewesen. Sie und er wurden zusammen in St. Hedwig heimisch. Die Nonnen erlaubten, dass Alain blieb. Ein Feldbett, der Blick ins Grüne, vier Wochen lang verließ er das Spital nicht. Bis zuletzt.
Während Alain darauf wartete, dass die Frau, die er angefahren hatte, vom Röntgen kam, lief er telefonierend durch die Gänge von St. Hedwig und war dabei, seine Termine zu verschieben. Er hatte Leas Zimmer nicht gesucht, das Zimmer fand ihn. Eine andere Erklärung gab es nicht. Dort war die Ärztetoilette, wie immer verschlossen, hier die Holzbank für Besucher, mit Blick auf die Birke im Innenhof. Das Handy in seiner Hand sank herab, mitten im Satz, mitten im Wort. Gerade hatte er noch einen Auftrag erteilt, gerade war er noch unter den Lebenden gewesen. Jetzt nicht mehr. Alain stand vor Leas Sterbezimmer.
Er trat näher, drückte die Klinke, trat ein. Lea, dachte er. Das Zimmer war leer, die Matratze aufgerollt. Nichts erinnerte an Lea. Alles erinnerte ihn an sie. Dort in der Ecke hatte seine Notliege gestanden. Über dem Krankenbett baumelte der Galgen. An diesem Plastikgriff hatte sie sich hochgezogen. In der letzten Woche besaß sie kaum noch die Kraft, ihre Hand zu heben. Alain umfasste den kalten grauen Kunststoff. Die Tränen kamen so schnell, dass er nicht wusste, mit welcher Hand er sie abwischen sollte. Links das Handy, rechts der Galgen.
»Was machen Sie hier?« Sie stand in der Tür. Im Krankenhaus trugen die Nonnen Weiß.
»Das ist Leas Zimmer.« Er drehte sich um.