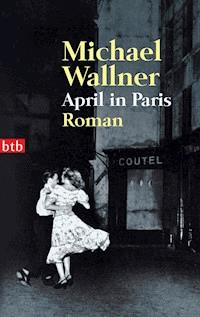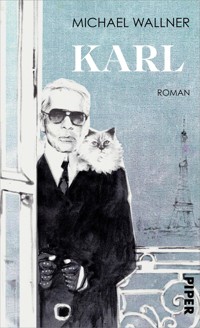6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebe in den Zeiten der Revolution
München im Winter 1918/1919. Der Krieg ist verloren, der bayerische König ist gestürzt, und Arbeiter- und Soldatenräte versuchen die Macht zu ergreifen, während konservative und deutschnationale Kräfte zur Gegenwehr ansetzen.
Am Schwabinger Krankenhaus operiert die junge Ärztin Julie Landauer Tag und Nacht Kriegsverletzte und Invaliden, die von den Schlachtfeldern in die Heimat zurückgebracht wurden. Julie hat in ihrer Kindheit nie erfahren, was echte Zuneigung und Geborgenheit bedeuten. Deshalb vertraut sie der Liebe nicht und kann sich allenfalls auf flüchtige, gefühlsleere Affären einlassen. Bis sie dem liberalen Zeitungsredakteur Karl Kupfer begegnet, dessen unheilbar an Diabetes erkrankte Frau Nina sie behandelt. Den Mann einer Patientin zu lieben, ist absolut tabu für Julie – und doch kann sie ihre Gefühle ebenso wenig ersticken wie Karl Kupfer dies vermag, der sich von der jungen Ärztin magisch angezogen fühlt.
Als sich Nina Kupfers Zustand dramatisch verschlechtert, gibt es für sie nur eine Rettung: Sie muss nach Marseille gebracht werden, wo gerade eine revolutionäre Therapie gegen Diabetes entwickelt wurde. Wider alle politischen Hindernisse kann Nina nach Südfrankreich ausgeflogen werden, wo sich ihr Gesundheitszustand rasch bessert. Karl indessen, der Sorgen um seine Frau enthoben, wird von einer verzehrenden Sehnsucht nach Julie ergriffen. Unter einem Vorwand reist er Hals über Kopf zurück nach München. Für einen Augenblick scheint es, als ob Julies und Karls heimliche Liebe Erfüllung finden könnte – doch dann reißt das Schicksal die beiden grausam auseinander …
»Der Flug nach Marseille« entwirft gleichsam im Cinemascope-Format die Geschichte einer großen Liebe vor dem Hintergrund der Münchner Räterepublik. Klug, vielschichtig, historisch fundiert und extrem bewegend erzählt, ist Michael Wallners neuer Roman eine einfach mitreißende Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
München im Winter 1918/1919. Der Krieg ist verloren, der bayerische König ist gestürzt, und Arbeiter- und Soldatenräte versuchen die Macht zu ergreifen, während konservative und deutschnationale Kräfte zur Gegenwehr ansetzen.
Am Schwabinger Krankenhaus operiert die junge Ärztin Julie Landauer Tag und Nacht Kriegsverletzte und Invaliden, die von den Schlachtfeldern in die Heimat zurückgebracht wurden. Julie hat in ihrer Kindheit nie erfahren, was echte Zuneigung und Geborgenheit bedeuten. Deshalb vertraut sie der Liebe nicht und kann sich allenfalls auf flüchtige, gefühlsleere Affären einlassen. Bis sie dem liberalen Zeitungsredakteur Karl Kupfer begegnet, dessen unheilbar an Diabetes erkrankte Frau Nina sie behandelt. Den Mann einer Patientin zu lieben ist absolut tabu für Julie – und doch kann sie ihre Gefühle ebenso wenig ersticken wie Karl Kupfer dies vermag, der sich von der jungen Ärztin magisch angezogen fühlt.
Als sich Nina Kupfers Zustand dramatisch verschlechtert, gibt es für sie nur eine Rettung: Sie muss nach Marseille gebracht werden, wo gerade eine revolutionäre Therapie gegen Diabetes entwickelt wurde. Wider alle politischen Hindernisse kann Nina nach Südfrankreich ausgeflogen werden, wo sich ihr Gesundheitszustand rasch bessert. Karl indessen, der Sorgen um seine Frau enthoben, wird von einer verzehrenden Sehnsucht nach Julie ergriffen. Unter einem Vorwand reist er Hals über Kopf zurück nach München. Für einen Augenblick scheint es, als ob Julies und Karls heimliche Liebe Erfüllung finden könnte – doch dann reißt das Schicksal die beiden grausam auseinander …
»Der Flug nach Marseille« entwirft gleichsam im Cinemascope-Format die Geschichte einer großen Liebe vor dem Hintergrund der Münchner Räterepublik. Klug, vielschichtig, historisch fundiert und extrem bewegend erzählt, ist Michael Wallners neuer Roman eine einfach mitreißende Lektüre.
Autor
Michael Wallner wurde 1958 in Graz geboren. Er lebt seit 1997 als Roman- und Drehbuchautor sowie als Regisseur in Berlin. Seine Inszenierung von »Willy Brandt – Die ersten 100 Jahre« am Theater Lübeck wurde 2013 in der Kritikerumfrage der WELT unter die zehn besten deutschsprachigen Theateraufführungen des Jahres gewählt. International bekannt wurde Michael Wallner als Autor durch den in über 20 Ländern erschienenen Roman »April in Paris«. Zuletzt veröffentlichte Michael Wallner bei Luchterhand die Romane »Die russische Affäre« (2009), »Kälps Himmelfahrt« (2011) und »Die Frau des Gouverneurs« (2014).
Michael Wallner
Der Flug nach Marseille
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2016 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München unterVerwendung eines Motivs von © ClassicStock/Corbis
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-16043-2V001www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Dank an K. für ein Jahr voll Inspiration
Erster Teil
1
Es war Herbst, und der Krieg war verloren. Vier Jahre währte das Sterben schon, Entbehrung, Erschöpfung und Trauer gingen durchs Land. Dabei waren die jungen Männer im Sommer 1914 voll Zuversicht und Begeisterung ins Feld gezogen, zugleich erfüllt von einem unheimlichen Hochmut. Der Sieg schien eine Sache von Wochen, schlimmstenfalls Monaten zu sein. Rasch hatte sich jedoch abgezeichnet, dass das große Schlachten so bald kein Ende nehmen würde. Aber es musste enden, wenn nicht alles zugrunde gehen sollte. Da weder die Regierung noch das Militär fähig waren, diesen Krieg zu verkürzen, musste das Volk selbst die Sache in die Hand nehmen. Es musste aufbegehren und sich verweigern.
Im November 1918 wurde ausgerechnet das beschauliche München besonders heftig von den Stürmen der Zeit gepackt. Man hatte König Ludwig III. abgesetzt und verjagt. Am 7. November verkündete eine Proklamation: »Bewohner von München, unter dem fürchterlichen Druck innerer und äußerer Verhältnisse hat das Proletariat die Fesseln mit gewaltiger Anstrengung zerrissen und sich jubelnd befreit. Ein Arbeiter- und Soldatenrat ist gegründet, der die Regierung in sicherer Hand hat. Es lebe der Frieden! Nieder mit der Dynastie!«
Eine neue Zeit war angebrochen.
Es dämmerte schon, als Julie Landauer von der Ludwigstraße kommend Richtung Innenstadt lief. An der Feldherrnhalle sprach ein Matrose und rief dazu auf, alle Kriegshandlungen einzustellen. Vom Hofgarten zogen bewaffnete Revolutionäre vorbei, in ihrer Mitte Zivilisten; man zwang sie, die Hände über dem Kopf zusammenzulegen. Julie lief weiter. Dort stand eine Gruppe von Wartenden, eine Versammlung war einberufen worden, die Leute wirkten unruhig und ängstlich, dabei aggressiv. Julie blieb nicht stehen. Sie hatte gerade eine Patientin verloren, eine Frau Anfang dreißig. Typhus, so lautete die Befürchtung des Stationsarztes. In München gab es offiziell keinen Typhus. In Wirklichkeit war diese Frau einsam und lautlos an einer Krankheit gestorben, die es in Bayern angeblich auch nicht gab: Hunger.
Julie Landauer lief schneller. Sie war neunundzwanzig Jahre alt, hatte helles Haar, das sie wegen der Locken meistens zu einem Knoten zusammenfasste. Ihre grünen Augen konnte man fröhlich nennen, vielleicht auch frech. Ihr ungeschminkter Mund war zu breit, ihre Stimme ein wenig heiser. Ihr Gang hatte etwas Selbstverständliches. Julies Figur war weiblich, selbst im Ärztemantel fiel das auf. Sie liebte Ehrlichkeit und war überrascht, wie oft sie in ihrem Beruf lügen musste. Sie weinte um Tiere und durfte nicht weinen, wenn Menschen unter ihrer Hand starben. In den vier Kriegsjahren hatte sie diejenigen, die mit dem Leben davongekommen waren, nicht immer als die Glücklicheren empfunden. Julie hatte gelobt, zum Wohl der Kranken zu wirken, und schämte sich, wie hemmungslos sie ihre eigene Lust auslebte. Julie war unterwegs zu ihrem Geliebten.
Sie war fast bei der Frauenkirche angelangt, als plötzlich die Glocken zu läuten begannen. Es war nicht die volle Stunde, es war kein gewöhnlicher Glockenschlag, das war ein Dröhnen aus dem Himmel. Wer missbrauchte die Glocken für seine Zwecke? Julie wechselte ihre Tasche in die andere Hand. Eine Gruppe von Männern näherte sich, auch sie schauten zu den Türmen hinauf. Gigantisch war das Lärmen, finster drückten die Zwiebeltürme des Doms auf das Kirchenschiff. Die Männer gerieten ins Licht einer Laterne, Julie bemerkte einen mit schwarzweißem Haupt. Ascheflocken hatten sich in sein dunkles Haar gesetzt. »Wer läutet Sturm?«, rief er über das Dröhnen hinweg.
Julie war bereits an der Kirche vorüber, als von der Löwengrube her Schüsse fielen. Ein Haustor sprang auf, aber keiner rannte heraus. Darauf eine unheimliche Stille. Die Gruppe der Männer wusste nicht, was zu tun sei, hilflos standen sie vor dem dunklen Tor; es mutete an wie das Unheil selbst. Julie wollte fort, da hörte sie von drinnen die Schreie. Schreie, die nicht gleich wieder enden würden, Schreie der Todesangst.
Sie schaute an sich hinunter, ihre Jacke, die alten festen Schuhe, sie hörte ihren Atem ein- und ausströmen und ballte die Faust. Jeder, der jetzt dort hineingehen würde, war verrückt. Die Schreie wurden verzweifelter. Julie tat die ersten Schritte auf das Tor zu. »Kommen Sie«, sagte sie zu den Männern. Als diese stehenblieben, hob sie ihre Tasche. »Helfen Sie mir. Ich bin Ärztin.«
Der mit dem schwarzweißen Kopf rührte sich als Erster. Im Gaslicht blitzte etwas auf, das war nicht der Verschluss eines Gewehres, Julie erkannte die Spitze eines Regenschirmes. Wer lief mit Regenschirm durch das revoltierende München, wer wappnete sich damit, wenn Kirchenglocken Volkssturm läuteten? Wider Willen musste sie lächeln.
»Gehen Sie wirklich da hinein?« Er hatte ein feines Gesicht, ähnlich einem jungen Russen, hohe Wangenknochen, helle, kluge Augen. Er trug einen guten Anzug, anders als die schweren Jacken, die man heute überall sah. »Haben Sie keine Angst?«, fragte er. »Das könnte blutig werden.«
»Das ist es schon«, antwortete sie.
Er hob den Schirm wie eine Lanze. »Lassen Sie mich wenigstens vorgehen.«
Ein düsterer Innenhof, ein Schuppen zur Linken, viele verschlossene Türen. Julie und der Mann liefen dicht nebeneinander. Das Schreien war einem trostlosen Weinen gewichen. Julie zeigte auf eine eisenbeschlagene Tür, von dort kam es. Der Mann drehte sich nach seinen Begleitern um, keiner war ihnen gefolgt.
»Vorsicht«, sagte Julie, als er frontal vor die Tür trat. »Bücken Sie sich, falls die von drinnen schießen.« Sie ging seitlich in Deckung und begutachtete das Schloss. Die Tür war nur verriegelt. »Geben Sie mir Ihren Schirm.«
Der Mann sank auf die Knie und bemühte sich, den Riegel zurückzuschieben. Kaum war das geringste Geräusch zu hören, ging drinnen das Geschrei von neuem los. Der Riegel klemmte, Julie kam dem Knienden zu Hilfe, bis die Tür nachgab. Als hätte ein Säbelhieb es durchschlagen, verstummte das Schreien. Nicht das geringste Licht fiel in den Raum. Julie hörte etwas knistern, der Mann holte Streichhölzer hervor. Zwei fielen zischend zu Boden, das dritte zündete. Im flackernden Schein sahen sie die unheimlichen Gestalten. Sie hockten in den Ecken, verkrochen sich in den letzten Winkel, es waren vier.
»Nicht mich«, flüsterte einer, die erloschene Zigarette im Mundwinkel. »Nicht mich.«
Eine Frau lag wie leblos da, zwei Soldaten in abgetragenen Uniformen kauerten nebeneinander. Ein alter Mann trug die Jacke eines Dienstmannes. »Ich habe nur ein Plakat abgerissen«, rief er, als Julie mit dem Regenschirm eintrat. »Ich weiß überhaupt nicht, was draufstand. Es hat geregnet, da wollte ich mit dem Plakat meinen Wagen zudecken.«
»Nicht erschießen«, sagte die liegende Frau.
»Es ist keiner mehr da, der Sie erschießen könnte«, sagte Julie. »Stehen Sie auf.«
»Er kann nicht.« Der eine Soldat zeigte auf den anderen. Der hatte den Kopf abgewandt.
Julie kannte Hiebe von Gewehrkolben. Es war eine schlimme Metzgerei, so einen zerschundenen Kopf wieder zusammenzuflicken. Diesem Mann hatten sie mit dem Kolben das halbe Gesicht eingeschlagen.
»Wann werden die Menschen aufhören, einander zu quälen, zu martern, zu morden?«, sagte der Mann an ihrer Seite. Er stand dicht bei Julie, seine Augen waren geweitet, und wenn sie sich nicht täuschte, waren sie feucht.
»Wahrscheinlich nie«, antwortete sie mit müder Stimme.
Plötzlich setzte draußen das Dröhnen aus. Das Geläute endete nicht schlagartig, wie es begonnen hatte, die ausschwingenden Glocken verklangen wie der Donner eines abziehenden Gewitters. Langsam und unsicher, als ob sie ihre Bewahrung vor dem sicheren Tod noch nicht glauben könnten, kamen die Menschen hoch.
»Helfen Sie ihm«, sagte Julie zu dem Mann, dessen Regenschirm sie immer noch in der Hand hielt. Der Soldat stellte seinen Kameraden auf die Beine, der Kopf des Verwundeten pendelte hin und her. »Er muss ins Krankenhaus.« Julie trat ins Freie.
Inzwischen waren die übrigen aus der Gruppe von der Straße ebenfalls auf den Hof gekommen. Sie hatten den Schuppen geöffnet und die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Die Toten waren offenbar dort hineingestoßen und exekutiert worden.
»Wer hat den Befehl zur Erschießung gegeben?«, fragte der Mann neben Julie.
»Nicht die Roten«, sagte einer der Befreiten, die von den anderen Männern umringt wurden.
Von der Straße hörte man betrunkenes Grölen. »Nieder mit den Wittelsbachern!«, rief einer. »Nieder! Hoch! Hoch die Wittelsbacher! Nieder mit den Hohenzollern!« Seine Schmährufe verwirrten sich, während er sich entfernte.
Unterdessen erwartete Julie das Eintreffen der Polizei.
»Ich heiße Kupfer«, sagte der Mann mit dem schwarzweißen Haar.
Auch sie nannte ihm ihren Namen und gab ihm den Regenschirm zurück.
2
Die bemalten Holzklötze stellten einen Wagen dar. Karl Kupfer beobachtete, wie sein kleiner Sohn ihn über den Boden bewegte. Dabei benutzte er die Rillen der Dielen als Schienen. Das Holzmännchen, das er daraufgesetzt hatte, trug weder Pickelhaube noch Uniform, sondern Zivil. Karl ermunterte den Buben, mit Dingen zu spielen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatten, also nichts mit dem Krieg. Dieser Wagen fuhr in Friedenszeiten.
»Ich setze jetzt eine Frau darauf«, sagte Moritz.
Karl streichelte den rotblonden Schopf. Der Junge hatte das Haar seiner Mutter geerbt. Die Linie der pechschwarzen Mähnen, wie sie in Karls Familie häufig waren, wurde mit Moritz durchbrochen.
»Einverstanden. Aber dann geht es ab ins Bett. Es ist schon spät.«
»Die Mama hat mich aufbleiben lassen, bis du zurückkommst.«
»Schon recht.« Karl war müde bis in die Knochen. Er wollte nicht mehr denken und konnte doch nicht anders. Er dachte an die Frau in der Löwengrube und wie furchtlos sie sich auf den Hof gewagt hatte, wo zwei Menschen erschossen worden waren. Sie hatte den Schwerverletzten notdürftig verarztet und die Leichen untersucht. Sie hatte auch mit der Polizei gesprochen. Keiner von Karls Begleitern hatte eine klare Aussage machen können. In der allgemeinen Verwirrung war nur sie sachlich geblieben und ohne jede Furcht. Wie konnte man in Zeiten wie diesen so wenig Angst zeigen? Wie konnte man sich so ungezwungen in die Nähe des Todes begeben? Ihr Verhalten war das Gegenteil von Tollkühnheit, dachte Karl, zeigte aber auch keine Abgestumpftheit, sondern etwas anderes, etwas, das er nach einiger Überlegung für Verzweiflung hielt. Ein unerklärliches Unglück schien über dem Wesen dieser Frau zu liegen. War das allgemeine Elend nach vier Jahren Krieg schuld daran, die Zeitenwende, von der jeder herumgewirbelt wurde? Oder war es ihr persönliches Unglück, eine Wunde, die ihr ganz allein geschlagen worden war? Zugleich war diese Frau voller Humor gewesen; sie hatte sogar, nachdem die Verletzten versorgt waren, einen Witz über Karl gemacht, weil er nur mit einem Regenschirm bewaffnet in die Revolution zog. An ihren Nachnamen konnte er sich nicht erinnern, doch sie hatte ihm gesagt, dass sie Julie heiße. Er hatte den Namen französisch ausgesprochen.
»Nicht Jülie«, hatte sie ihn korrigiert, »man spricht es wie den Sommermonat aus.«
»Juli«, hatte Karl gesagt. »Julie.«
Er wandte sich zu seinem Jungen. »So, mein Großer, jetzt werden die Zähne geputzt.«
Er lockte Moritz von den Spielsachen weg, goss Wasser in das Porzellanbecken und öffnete das Zahnpulver. Moritz zog sich selbständig aus, Karl half ihm nur bei den Hosenknöpfen und ließ schließlich das Nachthemd über den schmalen Körper gleiten. Er breitete das rosa Tuch über die Nachttischlampe, was den Raum in ein heimeliges Zauberreich verwandelte. Hier drohte keine Gefahr, in diesem Zimmer gab es keine Angst vor dem Morgen.
Sie beteten zusammen, die kurze Formel, wonach Gott sie sicher durch die Nacht bringen und sich Moritz’ Mutter annehmen sollte. Karl las ihm das Märchen von den drei goldenen Haaren des Teufels vor und blieb noch eine Weile bei seinem Sohn, auch als er schon dessen gleichmäßige Atemzüge hörte. Karl wollte seine Traurigkeit bezwingen, er fühlte sich heute Nacht schrecklich allein. Er drückte den Kleinen und küsste ihn. An der Decke des Kinderzimmers bewegte sich ein gelber Papierfalter, den Moritz seinen französischen Schmetterling nannte. Karl hatte nie herausgefunden, was es mit diesem Namen auf sich hatte.
Plötzlich war die Nacht durchdrungen von der Erinnerung an Frankreich. Im herbstlich nebeligen München fühlte Karl die Hitze von damals, er sah sich mit dem riesigen Sonnenschirm hinter Nina herlaufen. Trotz ihrer blassen Haut, die sich beim kleinsten Sonnenstrahl rötete, hatten sie an einem Ort gelebt, wo das ganze Jahr die Sonne schien. Nina musste schallend lachen, als er den Sonnenschirm von der Hotelterrasse stahl und wie ein Page hinter ihr herlief. Sie schlug absichtlich Haken, um ihn abzuschütteln. Karl in weißen Shorts, heiß brannte der Sand unter seinen Sohlen, Nina im bodenlangen flaschengrünen Kleid, das so wunderbar zu ihrem Haar passte. Seit der Zeit in Antibes hatte er sie nie mehr in diesem Kleid gesehen. Damals war Frieden gewesen, dachte er, kaum jemand hatte das Verhängnis kommen sehen, nicht so bald und nicht so endgültig.
Sie waren auf Einladung von Dumarchellier, Ninas früherem Lehrer, nach Antibes gefahren. Sein Haus lag in den Hügeln über der Halbinsel, ein zweihundert Jahre altes Bauernhaus, von violetter Bougainvillea überwachsen. Dumarchellier galt in Frankreich als bedeutender Maler, Karl hatte jedoch bald herausgefunden, dass der braungebrannte Franzose seit Jahren nichts mehr geschaffen hatte. Er gab Meisterklassen, genoss die Bewunderung seiner vorwiegend weiblichen Schüler. Nina und er verstanden sich wie Vater und Tochter. Das Cap am Mittelmeer, Handelsstation der Antike, später frühchristlicher Bischofssitz, von den Grimaldi an Frankreich verkauft, vom französischen König zur Festung ausgebaut – an diesem Ort, in diesem Haus, hatte Karl arbeiten können, wie es ihm in München nie gelungen wäre. Er schrieb an seinen Texten wie im Rausch.
Sie kannten sich damals erst ein paar Monate, Nina studierte in München Malerei bei Habermann, brannte für den Blauen Reiter und schwärmte für Kandinsky. Bei der Ausstellung in der Galerie Thannhäuser begegneten sie einander zum ersten Mal. Ninas künstlerische Helden waren sämtlich anwesend: Klee, Macke, Marianne von Werefkin; ein Wunder, dass Nina Karl überhaupt bemerkt hatte. Während er sich mit Kandinsky unterhielt, hatte sie sich dazu gestellt und mitgeredet. Sie merkte, dass Karl sich Notizen machte, und fragte, für welche Zeitung er schreibe.
Nina war pures Feuer. Sie war aus dem langweiligen Düsseldorf davongelaufen, weil sie dazugehören wollte – München, die Kunststadt, München, der Brennpunkt. Das war 1913 gewesen.
Es war so leicht, sich in Nina zu verlieben. Die Maler, denen sie Akt stand, die Studenten, mit denen sie sich die Nächte um die Ohren schlug, jeder liebte Nina. Merkwürdigerweise entschied sie sich für Karl. Weil es ihr bei ihm die Rede verschlagen habe, wie sie sagte, bei ihm brächte sie keinen einzigen geraden Satz heraus, das sei ihr noch nie passiert, also müsse es Liebe sein. Die Heirat fand überstürzt statt. Karls Vater war schuld daran, er hatte sich noch heftiger in die schöne Rheinländerin verliebt als sein Sohn. Der Vater wollte entweder diese Schwiegertochter oder keine.
Im Schein der Nachttischlampe lächelte Karl. Damals war Frieden gewesen, das Leben hatte weit ausgebreitet vor ihnen gelegen. Bis zu dem Vorfall mit dem französischen Jungen hatte er nicht verstanden, weshalb Nina die Einladung Dumarchelliers zunächst ausgeschlagen und später nur zögerlich angenommen hatte. Wie konnte man einen Besuch im Paradies ablehnen? Im Norden von Dumarchelliers Besitz erhoben sich die Alpen, tief unten sah man die Küste, die jedes malerische Klischee in den Schatten stellte. Farben wie aus einem Traum, ihre Spaziergänge durch das Kastell, die Abende, wenn die Sonne sich mit dem Untergehen lange zierte, bis sie plötzlich ins Meer stürzte. Dumarchellier war eitel und gönnerhaft, die Schläfen grau, der Körper, den er im offenen Hemd gern zur Schau stellte, kräftig. Er kochte gut und war trinkfest. Junge Frauen kamen zu ihm, um etwas zu lernen. Auch Nina war früher als seine Studentin an einer dieser Staffeleien gestanden. Oft blieben er und Nina als Letzte am Tisch, während die anderen und Karl sich schon zu Bett legten.
Ein Junge aus dem Dorf arbeitete manchmal im Haus, sie nannten ihn Pip. Er lud Einkäufe vom Wagen ab, brachte Weinflaschen in den Keller. An jenem Morgen war Karl, seinen ersten Kaffee in der Hand, durch das Atelier geschlendert und hatte die halbfertigen Bilder von Dumarchelliers Schülerinnen betrachtet. Eine Skizze fiel ihm auf, ein umschlungenes Paar am Strand, die Details wurden schicklich von einem wehenden Tuch verdeckt.
»Das ist genau wie bei Monsieur Dumarchellier und Madame Nina«, sagte Pip hinter ihm. Der Junge hatte frisches Brot geholt und wollte in die Küche.
Karl betrachtete die Skizze und versuchte sich vorzustellen, was Pip zusammenfantasierte. »Unsinn. Wir waren seit Tagen nicht mehr am Strand«, antwortete er.
»Nicht am Strand. Im Zimmer von Monsieur.«
Dumarchellier wohnte in einem riesigen Raum unter dem Dach, in der Mitte führte der Schornstein nach oben, um den sich eine Treppe zur Schlafempore wand. »Was sagst du da?«
»Ich habe sie gesehen. So.« Arglos zeigte Pip auf das Bild der nackten Liebenden. Ich habe auf dem Hang hinterm Haus Holz gesammelt. Das Fenster zu Dumarchelliers Zimmer lag direkt vor mir. Da habe ich hineingesehen.«
»Wann?«
»Gestern Nachmittag.«
Karl ließ ihn gehen und stellte den kalt gewordenen Kaffee auf das Fensterbrett. Nachmittags zogen sich die meisten Gäste im Haus zur Siesta zurück, nur Nina lief währenddessen gern in den Wald und machte Skizzen. Der Junge könnte alles Mögliche gesehen haben oder unterschiedliche Ereignisse durcheinanderbringen, dachte Karl. Warum sollte Nina so etwas tun? Sie liebten einander, nicht die kleinste Wolke trübte ihr Glück. Dumarchellier mochte ein Faun sein, dem die bewundernden Blicke seiner Schülerinnen schmeichelten, aber war er ein Lüstling?
An jenem frühen Morgen in Antibes kehrte Karl in ihr gemeinsames Zimmer zurück und legte sich zu der schlafenden Nina. Als sie erwachte, liebten sie einander. Er suchte nach Anzeichen einer Veränderung und schämte sich zugleich dafür, dass er die Bemerkung eines Jungen und das Bild der beiden umschlungenen Körper nicht aus dem Kopf bekam. Bald darauf reisten sie ab. Daheim angekommen, waren sie einander fremder als vor der Zeit in Frankreich. Karl hätte seine Zweifel aussprechen, die bohrenden Fragen stellen müssen, stattdessen legte er die am Mittelmeer geschriebenen Texte beiseite, als ob ihnen ein Makel anhaften würde. Nina dagegen stürzte sich in die Arbeit, sie malte Tag und Nacht, ihre violette Serie von Landschaftsbildern entstand. Sie schien nicht einmal zu merken, dass ihre Ehe mehr und mehr zerbröckelte.
Mit der großen Neuigkeit änderte sich alles: Moritz war unterwegs. Moritz zog Ninas Gedanken und Gefühle auf sich, das Jahr der Schwangerschaft war ihre schönste gemeinsame Zeit. Das Glück kehrte zurück, Moritz wurde geboren.
Karl stand von dem schmalen Bett auf, deckte den Jungen zu, hauchte noch einen Kuss auf seine Wange und löschte die Lampe.
Im Wohnzimmer saß Nina an der Staffelei, der Pinsel hing schlaff in ihrer Hand, als ob sie ihn gleich fallen lassen würde.
»Wie geht es voran?«
Ninas Backenknochen stachen aus dem Gesicht hervor, ihre Lippen erinnerten an die breite Liebenswürdigkeit von früher, doch sie waren bleich. Graue Fäden durchzogen das rotblonde Haar, trotz ihrer Magerkeit wirkte der Körper aufgeschwemmt. Auch das halbfertige Bild spiegelte Ninas Zustand wider. Nächtliche Brücke, von einem milchigen Mond beschienen, die Farben weiß, grau und dunkles Blau. Im Vordergrund ein Gesicht, halb dem Betrachter zugewandt, ein Mund, sprachlos in Verzweiflung. Die Nina von früher, die feurige Nina, war seit langem verschwunden.
Sie legte den Pinsel auf die Staffelei. »Schläft Moritz schon?« Ihre Stimme hatte fast jeden Klang verloren.
»Er ist während des Märchens eingeschlafen.« Karl ging vor ihr in die Knie und nahm ihre Hände. Sie waren eiskalt. »Wie geht es dir?«
»Heute Mittag war es schlimm.« Als ob sie gerade aufgewacht wäre, kam ihr Blick von scheinbar weit her.
»Deine Finger …?« Er betrachtete die vielen kleinen Risse, die ihr Gesicht durchzogen wie ein Renaissancebild.
»Vormittags waren sie wie taub. Jetzt spüre ich wieder ein Kribbeln.« Sie entzog ihm ihre Hände.
»Was hast du gegessen?«
»Alles streng nach Plan. Ich hatte ohnehin keinen Appetit.«
»Soll ich uns etwas zu essen machen?«
»Wenn du hungrig bist. Ich kann nicht.«
Er half ihr auf. Groß und schlank überragte Nina Karl ein wenig. Er brachte sie in die Küche. Sie ließ sich auf den Stuhl sinken. Die Gasbeleuchtung vor dem Fenster gab ihrem Gesicht einen blassgelben Teint.
Karl nahm einen Topf aus dem Schrank. »Ich war heute an der Feldherrnhalle. Es wurden Reden gehalten. Das waren keine geschulten Revolutionäre, die dort sprachen, sondern einfache Leute, die allmählich zu verstehen beginnen, dass ihre Stimme Gewicht hat. Unsere Zeit ist reif, so reif, dass man sie kneten kann.«
»Bist du deshalb so spät gekommen?«, fragte sie vorwurfsvoll. »Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Entschuldige. Die Elektrische war schon wieder unterbrochen. Ich musste laufen.«
»Ach Gott, diese Zeiten.« Mit gebeugten Schultern ließ Nina sich über den Tisch sinken.
Wir sind zwischen die Zeiten gesetzt wie zwischen zwei Stühle, dachte Karl. Wir sind mit dem Feudalen, dem Monarchistischen aufgewachsen, jetzt sollen wir losstürmen ins Republikanische, ohne zu wissen, wo wir ankommen werden.
Er wärmte die Roten Rüben auf. Ihm war elend zumute: weil er Nina nicht helfen konnte, weil ihr Arzt immer die gleiche verschwommene Diagnose stellte. Als Karl sich zu ihr umdrehte, erschrak er über die schwarzen Ränder unter Ninas Augen. Ginge es nach den Augen, hätte man Nina für viel älter gehalten. Wir sollten den Arzt wechseln oder noch besser: so bald wie möglich nach Frankreich aufbrechen, dachte er, dort waren die Ärzte angeblich weiter. Karl hielt im Rühren inne – das war unmöglich. Der Krieg hatte alles verändert; sie konnten nicht mehr ins Land der Feinde reisen. Gewiss, das Kriegsende war nur noch eine Frage von Tagen. Österreich-Ungarn war bereits zusammengebrochen, die bayerischen Truppen versuchten noch, die südlichen Grenzen vor dem Nachrücken der Entente zu schützen.
Karl spürte, wie es Nina ums Herz war: Am liebsten hätte sie den Strom der Zeit umgelenkt und außerhalb ihrer vier Wände vorbeifließen lassen. Sie wollte nichts hören vom Aufbruch, von einem neuen Kapitel, das angeblich aufgeschlagen wurde, während in Wirklichkeit alles zusammenbrach. Die Zeit floss nur noch in eine Richtung, auf den Abgrund zu. Was gerade geschah, bedeutete die vollständige Auflösung all dessen, was gestern noch gegolten hatte – und es ging so rasend schnell! Jeder Tag brachte Veränderungen, die sonst in Jahrzehnten nicht bewältigt worden waren.
Karl setzte sich an den Tisch. Er erzählte Nina nichts von dem Vorfall auf dem Hinterhof, nichts von den Leichen, nichts von der Ärztin, die ihn so sonderbar beeindruckt hatte. Karl griff zum Löffel und begann zu essen. Das Gemüse stammte aus dem Garten seiner Mutter. Auf der Küchenkommode reihte sich eine Batterie von Kompottgläsern. Wenn die Eltern ihnen nicht aushelfen würden, wüsste er manchmal nicht, wie sie durchkommen sollten. Karl stand auf und holte die Weinflasche; es war die letzte von dem guten Französischen.
3
Julies Haar fiel weich über die nackten Schultern. Ihre Sachen lagen auf dem Sessel. Es gab nichts, womit sie sich zudecken konnte. Nur eine Kerze brannte.
Warum war ihr so schwer ums Herz? Weil sie süchtig war nach dem Rausch, in den er sie versetzte, nach der Auslieferung ihrer selbst? War sie bedrückt, weil ihr Geliebter ihr Sünde bot, statt Zuneigung? Liebe war in ihrem Verhältnis ein Wort, das Julie nur in wollüstig verwirrten Augenblicken hervorstieß. Und doch waren die Tage, an denen er sie nicht hatte sehen wollen, schwer zu ertragen gewesen.
»Was hattest du überhaupt dort zu suchen?«, fragte der Mann, während er sich anzog. Die Stimme war jung, sein Gesicht hatte die harmlose Schönheit eines Knaben. Die Nase war etwas zu kurz, der Mund erinnerte an ein Lebkuchenherz. Auch wenn man auf den ersten Blick meinte, einen unschuldigen Cupido vor sich zu haben, verrieten seine Augen Erfahrung, Wollust und Düsternis. Der Leutnant war in Zivil gekommen, Unauffälligkeit war in diesen Tagen die sicherste Uniform. Der Frack saß meisterlich und schmeichelte seiner sportlichen Figur.