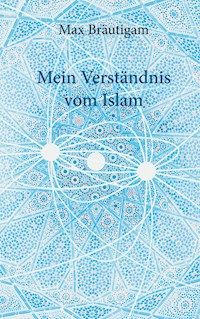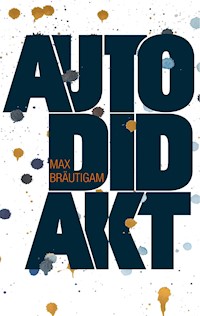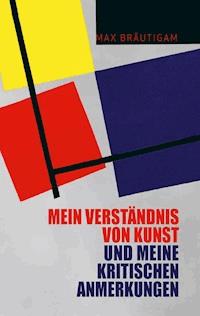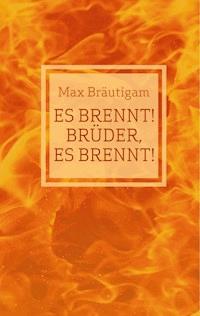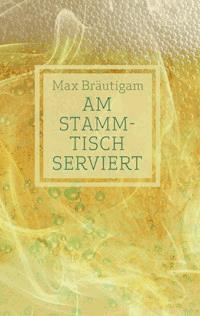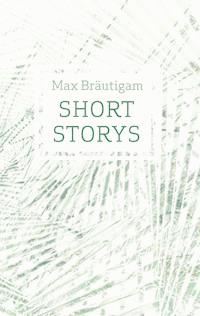
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählungen basieren auf Beobachtungen. Spannender und überzeugender sind Geschichten, wenn der Akteur selbst davon spricht oder wenn das Opfer die Geschichte schildert, sofern diese Person das Geschehen überlebt hat. Max Bräutigam, noch vor dem 2. Weltkrieg im Zentrum der Stadt München geboren. Nach Volksschule, Handwerkerlehre, zweitem Bildungsweg in der gleichen Stadt Maschinenbau studiert. Neugierde und Interesse waren von Anbeginn die treibende Kraft. Max Bräutigam lebt im Chiemgau und in München.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erzählungen basieren auf Beobachtungen. Spannender und überzeugender sind Geschichten, wenn der Akteur selbst davon spricht oder wenn das Opfer die Geschichte schildert, sofern diese Person das Geschehen überlebt hat.
Inhalt
Einleitung
Ein Hakawati
Der Eremit von Gauting (1758–1862)
Graf von Pocci (1807–1876)
Graf Rumford (1753–1814)
Chaos in der Staatsoper
Auf dem Weg nach Paris – Zu Besuch bei den Sch’tis
Paris in der Zeit der zweiten Revolution
Kibo – die Krone auf dem Haupt Afrikas
Mit dem Fahrrad unterwegs
Gute Bekannte
Eine Reparatur
Mein Garten
Einleitung
Liebe Zuhörer (und Leser), noch bevor ich mit meinen Erzählungen beginne, möchte ich mich kurz vorstellen, Sie etwas mit meiner Umgebung vertraut machen und Sie dabei auch zum Zuhören einstimmen. Hierzu darf ich Sie in mein sommerliches Wohnzimmer, in meinen Garten führen.
Als gebürtiger Städter lebe ich nun überwiegend auf dem Lande, in einem bescheidenen Haus mit einem Garten, der auch diesen Namen verdient, irgendwo zwischen München und Salzburg, am Rande der vielen Seen, die vor langer Zeit von den Gletschern der Alpen ausgeschoben wurden, am Chiemsee, der von vielen Profiurlaubern, Hektikern und Fernreisenden mit ihren Zielen im asiatischen Pazifik nur als überschwemmte Wiese eingestuft wird. An den Sommertagen, wenn das Thermometer über 25 °C im Schatten ansteigt, kommen die noch musisch Ansprechbaren ans Wasser, Menschen, manchmal in Begleitung von Mädchen und Mücken.
An dieser Wohnstätte ließ ich bei der Errichtung des Hauses – etwas ungewöhnlich – auf der Nordseite eine Terrasse und – noch ungewöhnlicher – an einem nach Norden gerichtetem Mauervorsprung einen offenen Kamin bauen. Der Ausblick ist von dort nach Nordwest ungestört, weit und frei. Bis in den späten Nachmittag ist es angenehm, im Schatten zu sitzen. Die untergehende Sonne leuchtet diesen Winkel aus, erwärmt ihn und verabschiedet sich dann hinter den Baumkronen auf einen fernen Hügel.
In dieser Ecke bin ich frei von gesellschaftlichen Zwängen und fühle mich wie ein Eremit, den ich auch sehr gerne spiele. Nicht so voller Entbehrungen, ich genieße das Essen und hierzu auch das passende Getränk. So sitze ich, wenn es nicht stürmt oder regnet, bis in die Nacht am Kaminfeuer, und dann laufen wie auf der Leinwand im Kino Geschichten ab. Auch an Geselligkeit fehlt es nicht, wenn Freunde in Stille und Ruhe die Runde formen und Geschichten erzählt werden. Es werden Stimmungen, Träume, Sehnsüchte und eigene Erinnerungen geweckt.
Geschichten aus der Geschichte und Gegenwärtiges, Erzählungen zum Weitersagen. Einer Tradition folgend kommen ohne Ankündigungen oder gelegentlich anlässlich einer aktuellen Nachricht auch neue Themen in den Gesprächskreis. Themen wie Krankheiten, Geldsorgen und Leut’ ausrichten sind tabu. Die Wiedergabe und Zitate aus Katalogen und Lexika, auch das übliche Schulwissen, führen meist zu keinem Gedankenaustausch, sie verstummen, und das Ganze dauert dann nicht länger als ein Gähnen. Wobei über Personen zu sprechen, sei es aus der Geschichte oder aus der Gegenwart, etwas abseits der bekannten Darstellungen, sehr belebend sind. Meist sind es Exoten, von denen nur der Name bekannt ist – vielleicht ein Straßenname.
Ich versuche bei einigen Geschichten, nicht die heroischen Taten darzustellen und diese dabei noch zu übertreiben. Nein – vielmehr geht es mir darum, die Mentalität der Akteure zu jener Zeit lebendig zu halten.
In der arabischen Tradition sind Erzähler Botschafter, die Geschichte und die Gegenwart ergänzend zu den offiziellen Nachrichten im kulturellen Zusammenhang authentisch wiedergeben. Sie führen einen eigenen Berufsstand und bezeichnen sich als „Hakawati“.
Ein guter Hakawati kann sich der Aufmerksamkeit seines Publikums sicher sein, wenn er seine Geschichten mit eigenen Erfahrungen vortragen kann.
Oft sind es Alltäglichkeiten, Situationen aus dem Alltag mit einem ungewöhnlichen, oft heiteren Ausgang einer zunächst verworrenen Gegebenheit. Menschliches, allzu Menschliches, und hierzu erlebte Lösungen führen zur Leichtigkeit des Seins. Und aus Erfahrung kann ich hinzufügen, dass die Geschichten immer ein gutes Ende nehmen.
In der Natur, in einem Garten, kann man bei diesen Erzählungen die Seele baumeln lassen.
Ein Hakawati
Bis vor ein oder zwei Generationen konnte man am nördlichen Rand Afrikas, im Maghreb, entlang der Mittelmeerküste, von Marrakesch bis Kairo, aber auch in der nördlichen Fortsetzung in Syrien und im Libanon, vorwiegend im ländlichen Raum, wenn sich der Abend abzeichnete, eine sehr eigene Kulturszene beobachten, wie es am Kaminfeuer oder zur kalten Jahreszeit am Kachelofen auch bei uns sich ergeben kann.
In den nordafrikanischen Ländern gibt es in den Sommermonaten keine Dämmerung, sondern einen relativ abrupten Wechsel von Tag und Nacht. Es wird angenehm kühl und mild. Ein leichtes Lüftchen schwingt. Die Anwohner, vorwiegend Männer, sammeln sich entlang der Straßen und Gassen bei den Teestuben. Etwas ungeordnet am Häuserrand aufgestellte Stühle mit gedrechselten Beinen, die Sitzfläche ein Holzrahmen mit Korbgeflecht. Auf den kleinen Tischen ähnlicher Konstruktion stehen Gläser und kleine Tassen. Es werden Tschaj und starker Mocca serviert.
In den frühen Nachtstunden wechselt das Publikum schleichend in den offenen Raum, der von einer einzelnen Glühlampe erhellt wird. Ein Hakawati – ein Erzähler – kommt unauffällig hinzu und belegt einen für ihn reservierten Stuhl, der etwas erhöht positioniert ist. Keine Ankündigung, kein Programm, kein Name, kein Ticket. Hakawatis sind vermutlich nebenberuflich tätig, untertags sind sie Taxifahrer oder Friseure. Letzteres ist die bevorzugte Tätigkeit, denn dem Erzähler werden Geschichten zugetragen – im Stundentakt.
Hakawatis absolvieren keine besondere Ausbildung, vielmehr könnte es sein, dass die Kunden beim Friseur während der Behandlung ihres Haupthaars sich für einen künftigen Hakawati schulen. Glatzköpfige können ihre Chance zur Ausbildung beim Psychiater versuchen.
In sogenannten besseren Wohngegenden könnte sich aus dieser Situation bei entsprechender Pflege aus einem Friseurladen ein Salon „Coiffeur & Literatur“ entwickeln. Die bequemen Sessel im Salon vor dem Spiegel sind wie für eine Literaturstunde designed.
Es wird ruhig, still. Der Hakawati beginnt unauffällig.
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, da war noch …
Dann wird eine von 100 Geschichten – aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart in freier Wiedergabe, als wäre es ein persönliches Erlebnis –, in einer sanften Stimme, nicht theatralisch, in der üblichen Sprachfärbung erzählt – nicht vorgetragen.
Nach einer halben, maximal einer Stunde geht die Geschichte zu Ende. Es wird nur sanft, aber mit Gefühl applaudiert. Der Applaus soll die Stimmung nicht stören. So unauffällig, wie sich die Gesellschaft formiert hat, so löst sie sich wieder auf. Die Bezahlung des Hakawati ist ebenfalls unauffällig – es wird ein Teller bei den Gästen herumgereicht.
Ein Hakawati der besonderen Art in unserem Kulturkreis, dem ich über Stunden zuhören konnte, war Luis Trenker mit seinen Geschichten, er aus einem Dorf in Südtirol, unverfälscht in der Art, im Dialekt, voller Begeisterung, ein Bergfreund. Wenn man selbst in den Bergen, in den Alpen versucht hat, seine Kräfte und seinen Charakter in Grenzsituationen zu bewerten, so ist es eine Freude, dies gekonnt in Sprache, Gestik und Bild, wie in einem Spiegel, zu erleben.
Eine seiner unvergesslichen Schilderungen, die nur ein Bergsteiger mit ähnlichen erlebten Stimmungen nachempfinden kann, ist wie folgt: Eine Seilschaft, drei oder vier gleichwertige Bergsteiger, traf sich zur frühen Stunde am Fuß eines Berges, um denselbigen zu besteigen. Eine von vielen Bergtouren, das Wetter war nicht ideal, dennoch, so argumentierten sie – dann wird es nicht so heiß. Sie stiegen los, durch den Wald, dann über Matten und Almen. Die Wolkendecke senkte sich. Sie stiegen ohne ein Wort zu sprechen. Eine kurze Rast, dann wieder weiter im Schritt, in Reihe.
Der Pfad wird schmäler, das erste Geröllfeld zeigt sich. Es geht in Serpentinen höher und höher, die Bergkameradschaft, sie ist geschlossen und standhaft, zeigt keine Schwächen.
Es begann zu nieseln. Nebelschwaden zogen vorbei. Es ging höher und höher, und noch über eine Felsrippe, es wurde weglos, für Geübte noch kein Problem. Wortlos und dennoch in bester Übereinstimmung ging es weiter nach oben, und dann plötzlich lichtete sich der Himmel. Die Bergwelt zeigte sich in ihrer ganzen Pracht. Und – oh Wunder – der gesuchte Gipfel – 300 Meter unter uns.
Auch Stadtstreicher haben gute Voraussetzungen, sich als Erzähler darzustellen, zu agieren. Es ist die Beobachtung und die Wahrnehmung – und dazu noch etwas Phantasie, so lässt sich wieder eine interessante Geschichte formulieren.
Auch im Dickicht der Stadt München fand sich einer, der dieses Handwerk verstand, dessen Beobachtungen in der Stadt und seine Wiedergaben, bei einbrechender Sommernacht unter freiem Himmel, im Biergarten unter Kastanienbäumen erzählt Zuhörer bannte. Seine Geschichten konnten am nachfolgenden Tag in der Tageszeitung nachgelesen werden. Es war Sigi Sommer. Beobachtungen sind die eine Seite, die Wiedergabe die andere. Bleibt das gesprochene Wort ein Unikat?
Für einen Erzähler wird kein Tondokument erstellt. In der klassischen Musik sind Tonaufnahmen üblich. Es gab eine große Ausnahme. Die Münchner Philharmoniker unter ihrem Dirigenten Sergiu Celibidachi – er verlangte das „Original“.
Ein Erzähler beschreibt einen ähnlichen Weg – er liest nicht vor – er erzählt. Wenn seine Erzählung beendet ist, so ist es, als würde der Text gelöscht werden. – Aber es scheint nur so. Man kann nicht in die Köpfe sehen. In einer ausgeglichenen Stimmung sind die Zuhörer sehr aufnahmefähig. Und noch nach Jahren heißt es: „Weißt noch?“
Geschichten sind wie Leuchtpunkte am Sternenhimmel. Erzählungen, wenn diese niedergeschrieben sind, werden zu Novellen. Hemingways Erzählungen wurden als Short Storys bekannt. Manche dieser Geschichten findet man als Gute-Nacht-Lektüre am Bettrand.
Ein „Hakawati“, ein arabischer Geschichtenerzähler, hatte zu einer Zeit, als das Fernsehen noch nicht so verbreitet war wie heute, auch eine kulturelle Aufgabe zu erfüllen. Es war nicht nur die allabendliche Unterhaltung, es war auch die Aufgabe, die nicht auf Papier fixierten Geschichten über Generationen weiterzugeben. Die Bandbreite der Themen dieser Hakawati betraf sowohl Ereignisse aus der Nachbarschaft bis hin zu den Kreuzzügen. Bei den Geschichtenerzählern entsteht natürlich schleichend das Problem der Verfälschung, denn nach Generationen gleicht es im Ergebnis der Flüsterpost. Ein Kinderspiel, bei den in Reihe aufgestellten Kindern flüstert das erste Kind ein Wort seinem Nachbarn ins Ohr und dieser gibt die verstandene Botschaft weiter, usw. Das Ergebnis führt zur großen Heiterkeit aller Beteiligten, wenn der Letzte das Ergebnis bekannt gibt.
Im Alltag ist diese Informationsübertragung ein gefährliches Spiel. Seit biblischer Zeit treten immer wieder Prediger und Propheten auf, die aus ihrer Kultur das Heil verkünden, deren Aussagen nicht dokumentiert sind. Und wenn deren Aussagen von den Nachfolgern ohne einer Textvorlage des Originals zur Religionslehre stilisiert werden, so führt dies zu Diskussionen, Auseinandersetzungen bis hin zu Religionskriegen. (Nur der Prophet Mohammed hat seine Lehre schriftlich hinterlassen, dabei wurde jedoch von ihm versäumt, einen Nachfolger zu benennen. Seither streiten sich diese Glaubensbrüder um die rechtmäßige Nachfolge.)
War Jesus ein Hakawati? Seine Geschichten vom guten Samariter, seine Begegnung mit der liebenswerten Magdalena, die Hochzeit zu Kana mit der wunderbaren Weinvermehrung sind auch für einen Hakawati reizvoll, diese Szenen mit Phantasie und in einer blumigen Sprache den Hörern zu präsentieren. Letztere Geschichte ist ähnlich der von Luis Trenker mit seiner Bergtour, bei der die Bergkameraden sich plötzlich 300 Meter über dem Gipfel befanden.
Hakawatis sind keine Prediger, keine Politiker und auch keine Kabarettisten.
Der Eremit von Gauting (1758–1862)
Eremiten geben den Bürgerlichen viel Gesprächsstoff. Themen wie Krankheiten, Nachbarschaft oder solche aus dem üblichen „Unterhaltungskatalog“ finden bei den Zuhörern keine Aufmerksamkeit mehr – diese Themen sind abgehandelt.
Eremiten haben ihre eigene Geschichte. Eremiten im Gespräch sind interessant, denn sie sind frei vom gesellschaftlichen Ballast. Diese Personen werden in der Bevölkerung als eigensinnig, schrullig oder als bunte Vögel eingestuft. Manche von ihnen haben Geschichte geschrieben. Von ihnen gibt es nicht nur Unterhaltsames, Amüsantes, sondern auch Handwerkliches und wissenschaftlich Hervorragendes zu berichten. Ihre Geschichten werden farbig und lebendig, wenn zudem deren soziale Situation, deren Rahmenbedingungen und ihre viele Hindernisse geschildert werden. Eremiten sind große oder kleine, in jedem Fall aber Persönlichkeiten, die sich den Herausforderungen und Hindernissen stellen, diese annehmen und dabei auch das Verlieren lernen. Eremiten sind nicht erpressbar.