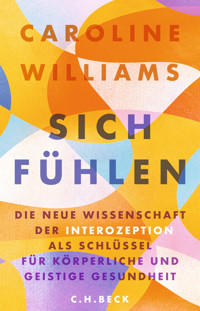
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Im Alltag zwischen Stress und ständigen Reizen fällt es uns oft schwer, auf unseren Körper zu hören. Dabei birgt unser „innerer Sinn“ ein ungeahntes Potenzial für unsere physische und psychische Gesundheit. Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Caroline Williams wendet den Blick bewusst nach innen und zeigt in ihrem unterhaltsamen und zugänglichen Buch, wie die neue Wissenschaft der Interozeption uns dabei helfen kann, uns selbst und andere besser zu verstehen, uns „zu fühlen“ – und dabei unsere psychische und physische Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen.
Wir entscheiden Dinge instinktiv, folgen unserem „sechsten Sinn“ und entschließen uns spontan zu diesem oder jenem – einfach, weil wir spüren, dass es richtig ist –, während wir anderes intuitiv ablehnen. Es sind Eindrücke aus unserem Innersten, die uns dabei leiten: Der Körper zeigt uns, wann wir hungrig sind, wann uns kalt ist oder wie wir uns in Situationen verhalten sollen, auf die wir mit Panik oder Stress reagieren. All das ist Interozeption: Die Wahrnehmung und Interpretation von Signalen aus unserem Körperinneren durch unser Nervensystem. Caroline Williams gibt einen Einblick in dieses faszinierende neue Forschungsfeld, das die Rolle unserer Selbstwahrnehmung für ein glückliches und gesundes Leben untersucht. Dabei fördert sie erstaunliche Erkenntnisse zutage: Der innere Sinn ist Grundlage unserer Fähigkeit zur Empathie, kann unser körperliches Wohlbefinden und Stressmanagement auf ein neues Level heben und ermöglicht einen neuen Zugang zu unserem Körper und Geist. Das Beste daran: Man kann ihn trainieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025





























