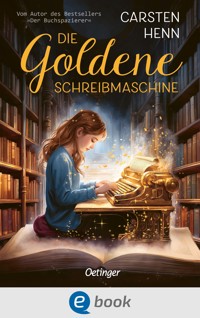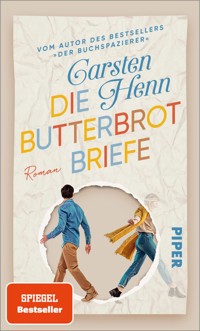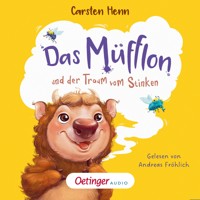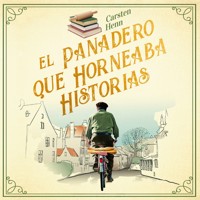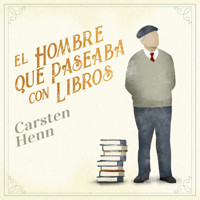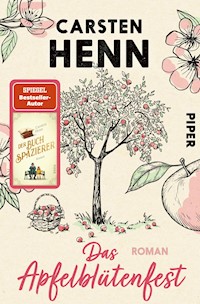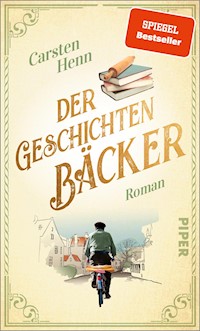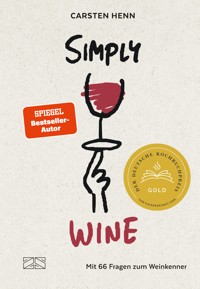
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Carsten Henn kann nicht nur kulinarische Kriminalromane, er schreibt auch kriminell gut über Wein: In seinem neuen Weinbuch schenkt der renommierte Weinjournalist und Weinbauer sein fundiertes fachliches Know-how einzigartig praktisch und unterhaltsam ein: Mit 66 wohldosierten und klug ausgewählten Fragen nimmt er uns mit in die Welt des Weins. Sie wollen bei der nächsten Dinnerparty mit Freunden oder beim nächsten Restaurantbesuch alle mit Ihrem neu erworbenen Weinwissen beeindrucken? Kurzweiliger und genussvoller können Sie nicht zum Weinkenner werden. Maische, Tannine, Gerbstoffe, Oxidation, Mäuseln, Brett u.v.m – alles, was man über Wein wissen muss, wird mit viel Witz und Scharfsinn erklärt. Von Rebsorten und Weinbereitung über die Lagerung bis hin zum richtigen Trinken, das Buch ist eine kurzweilige Lektüre und ein handlicher Guide, der sowohl bei der Weinauswahl in der Weinhandlung und im Supermarkt hilft wie bei der Weinbestellung im Restaurant oder einer Weinverkostung. Die charmanten Illustrationen von Leo Leowald machen das Buch auch optisch zum Genuss. Der perfekte Einstieg in die Weinwelt für alle, die es nicht nur nach Weingenuss, sondern auch nach mehr Wissen über die guten Tropfen dürstet. Ob für Weinliebhaber oder Fans von Carsten Henns Schreibstil – Simply Wine ist Genuss pur: einfach, gut und ein bisschen berauschend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das kleine Wein-mal-eins
1. Was ist Wein?
2. Wieso prickelt mancher Wein?
3. Wie lange gibt es Wein schon?
4. In wie vielen Farben gibt es Wein?
5. Wie viele Beeren braucht man für eine Flasche Wein?
6. Was steht auf einem WeinEtikett?
7. Schmeckt BioWein besser?
8. Kann ich Eiswein im Tiefkühler machen?
9. Schmeckt alkoholfreier Wein?
10. Wie setzt sich der Preis einer Flasche Wein zusammen?
Ganz praktisch
11. Wie viele Arten Gläser brauche ich?
12. Welche Utensilien sind wirklich nützlich?
13. Wie öffne ich eine Flasche ohne Korkenzieher?
14. Muss ich mir einen Weinkeller bauen?
15. Wie lange kann Wein reifen?
16. Bei welcher Temperatur sollte ich Wein trinken?
17. Was stelle ich mit halb vollen Flaschen an?
18. Was ist besser: Korken oder Schraubverschluss?
In Weinberg und Keller
19. Was passiert im Weinberg?
20. Werden Rebstöcke wirklich „erzogen“?
21. Was bedeutet Terroir?
22. Wie wichtig ist der Boden für den Wein?
23. Was ist ein Gemischter Satz?
24. Worin reift Wein?
25. Was hat Wein mit Toast zu tun?
26. Haben Weine Zusatzstoffe?
27. Gibt es veganen Wein?
28. Wie viel Natur steckt in Naturwein?
Die Welt des Weins
29. Welche Rebsorten sollte ich kennen?
30. Besitzen nur Aroma-Rebsorten Aroma?
31. Gibt es beim Wein auch Trends?
32. Was sind die berühmtesten Weinbaugebiete?
33. Was muss ich über das Weinland Deutschland wissen?
34. Was muss ich über das Weinland Frankreich wissen?
35. Was muss ich über das Weinland Spanien wissen?
36. Was muss ich über das Weinland Italien wissen?
37. Welche anderen Weinländer sollte ich noch kennen?
38. Lohnen sich exotische Weinländer?
39. Ist Champagner sein Geld wert?
Wein richtig kaufen
40. Ab wie viel Euro schmeckt ein Wein?
41. Gibt es guten Wein beim Discounter?
42. Kann ich mit Wein Geld verdienen?
43. Helfen Medaillen und Bewertungen bei der Auswahl?
Schöner trinken
44. Welche Weine sollte ich unbedingt mal probieren?
45. Wein auf Bier, das rat ich dir?
46. Welcher Wein passt zu welcher Gelegenheit?
47. Wie mache ich eine Weinprobe bei mir mit Freunden?
48. Wie verkoste ich einen Wein richtig?
49. Wie beschreibe ich einen Wein?
50. Was sind die häufigsten Weinfehler?
Schöner trinken … und essen
51. Was sind die Grundregeln fürs Wine-Food-Pairing?
52. Welche Weine passen zu Fast Food?
53. Was trinkt man zu Deutschlands beliebtesten Speisen?
54. Was sind die absolut besten Wine-Food-Pairings?
Wein unterwegs
55. Wie läuft ein Besuch beim Weingut ab?
56. Wie blamiere ich mich nicht im Restaurant bei der Weinbestellung?
57. Was hat es mit der Weinbegleitung auf sich?
58. Wie sage ich es meinem Sommelier?
59. Lohnen Reisen in Weinbaugebiete?
InsiderWissen
60. Schmeckt man den Klimawandel im Glas?
61. Was ist Pét Nat?
62. Wie gut sind die Weine von VIPs?
63. Welche Filme über Wein lohnen sich?
64. Welche Bücher und Magazine über Wein lohnen sich?
65. Was ist mit meinem Traum vom eigenen Weingut?
66. Ist Wein gleich Wein? Und was kann man noch alles daraus machen?
Impressum
Hinweis zur Barrierefreiheit
Dieses eBook wurde barrierefrei gestaltet, um Leserinnen und Lesern mit Seh- oder Lesebeeinträchtigung den Zugang zu erleichtern. Symbole und strukturgebende Elemente sind für Screenreader optimiert, bedeutungstragende Bilder mit Alternativtexten versehen. Visuelle Nutzererlebnisse bleiben davon unberührt.
Vorwort
Liebe Weingenießerin, lieber Weingenießer,
Sie fragen sich sicher: Nur 66 Fragen? Die sollen reichen, um Wein zu verstehen?
Ja!
Eigentlich müssen Sie zu Beginn sogar nur eine einzige Frage beantworten: Schmeckt mir Wein? Falls die Antwort „Ja“ lautet, möchten Sie natürlich wissen: Warum schmeckt er mir so gut? Und welcher schmeckt mir am besten? Was muss ich dafür ausgeben? Wo bekomme ich einen Zwölferkarton davon?
So werden aus einer Antwort vier neue Fragen. Das ist typisch in der Welt des Weins, es gibt Tausende Fragen, ach was, Zehntausende. Und aus jeder Antwort ergeben sich unzählige neue. Das Wunderbare daran ist: Die meisten lassen sich mit dem Genuss eines Schluckes Wein beantworten. Denn wenn man sich in der Welt des Weins besser auskennen möchte, muss man vor allem viel probieren. Sich auf eine Reise des Geschmacks einlassen, die einen in entfernteste Winkel der Welt und vergangene Zeiten führt. Es ist eine faszinierende und wirklich glücklich machende Reise. Denn Wein ist nicht irgendein Getränk, Wein ist eine Lebensart, eine Weise, das Leben an sich zu genießen.
Und im Kern ist Wein ganz unkompliziert, ein Alltagsgetränk, das sich jeder leisten und jeder trinken kann. Angst vor Wein ist völlig unnötig – Angst vor Weinkennern dagegen manchmal angebracht. Doch ist das nicht überall so? Es gibt immer Menschen, die auf dicke Hose machen, mit ihrem Wissen angeben und dafür sorgen, dass andere sich minderwertig vorkommen. Aber ganz ehrlich: Das sind genau die Snobs, über die echte Weinfreunde sich lustig machen. Schließlich hat jeder mal mit einfachen Tropfen angefangen, ob mit halbtrockenem Dornfelder aus dem untersten Supermarktregal oder einem Tetrapack französischem Tafelwein. Willkommen im Club! Jemand in Ihrem Freundeskreis hat schon die teuersten Weine der Welt getrunken? So what? Heißt das automatisch, dass er auch mehr Freude am Weintrinken hat oder die Weine mehr zu schätzen weiß?
Es gibt etliche Klischees und moderne Mythen über das Weintrinken, mit denen dieses Buch aufräumt. Sie wurden allesamt von denen errichtet, die nicht wollen, dass jeder einfach ihren schönen Spielplatz betritt. Aber dieser Spielplatz ist öffentlich und er hat Ecken für jeden!
Sie erfahren in diesem handlichen Buch das Wichtigste, was Sie für den Anfang brauchen. Alles in kleinen Happen, damit noch genug Zeit fürs Weintrinken bleibt. Denn so viel muss Ihnen klar sein: Dieses Buch will mit einem schönen Glas Wein in der Hand gelesen werden! Wenn Sie wollen, auch ein Glas pro Frage, hier zählt keiner mit. Das Wichtigste beim Wein ist ohnehin, neugierig zu bleiben – neugierig auf das nächste Glas, den neuen Jahrgang, eine wiederentdeckte Rebsorte. Die Welt des Weins hat so viel zu bieten, dass man nie alles erkundet hat und ständig spannende, neue Entdeckungen macht. Was für ein Geschenk!
Ganz viel Genuss wünscht
Das kleine Wein-mal-eins
1. Was ist Wein?
In Kurzform? Wein ist vergorener Traubensaft.
Die etwas längere Fassung: Aus Traubensaft wird mittels Hefezellen, die den Zucker in Alkohol umwandeln, Wein. Da Hefe sich auch auf den Beerenhäuten befindet, wird Traubensaft, wenn man ihn nur lange genug herumstehen lässt, automatisch zu Wein – es sei denn, Essigbakterien sind schneller, dann wird er zu Essig. Der Name ͵Weinʹ, englisch ͵wineʹ, französisch ͵vinʹ, italienisch und spanisch ͵vinoʹ, stammt vom lateinischen ͵vinumʹ. Grundsätzlich kann man aus jeder Traube Wein herstellen, für das, was wir in der Flasche aber in der Regel vorfinden, ist die Edle Weinrebe (Vitis vinifera, wörtlich: Wein tragende Rebe) verantwortlich und keine ihrer wilden Verwandten.
Eigentlich lässt sich alles vergären
Es muss nur Zucker vorhanden sein. Weintrauben sind bei Weitem nicht das einzige Obst, das auf diese Art veredelt wird. Es gibt Stachelbeerwein, Rhabarberwein, Brombeerwein, Kirschwein, ja sogar Birkenwein, wenn der Birkensaft mit Hefen versetzt und vergoren wird. Bier ist vergorener Gerstensaft, Sake ist vergorener Reis – hier muss die im Gersten- bzw. Reiskorn enthaltene Stärke allerdings zunächst in Zucker umgewandelt werden. Kefir ist vergorene Milch (der Alkoholgehalt liegt aber nur zwischen 0,2–2 %). Hat das Ausgangsmaterial zu wenig Zucker, wird einfach etwas hinzugegeben.
Warum wird gerade aus Trauben so viel Wein hergestellt?
Anstatt, zum Beispiel, aus Erdbeeren? Das ist eine naheliegende Frage. Zum einen gibt es dafür kulturelle Gründe. Zum anderen aber, und das dürfte der Hauptgrund sein, ist kein anderes Obst zu so komplexen Aromen fähig, geschweige denn aromatisch so feinfühlig, auf seinen Boden oder das Wetter im Jahr seines Entstehens zu reagieren. Bei einem Traubenwein kann man deshalb schmecken, woher er stammt und in welchem Jahr die Trauben gewachsen sind – bei einem Apfelwein eher nicht. Wer weiß, ob sich das in Zukunft noch ändert, aber momentan ist Wein in dieser Hinsicht ziemlich uneinholbar vorn. Dazu kommen die verschiedenen Rebsorten, die perfekt an das jeweilige Klima oder die Böden angepasst sind. Wein aus Trauben hat einfach Jahrtausende im Kreuz. Eine beeindruckende Lernkurve.
Eins habe ich eben bewusst unterschlagen: Bei der Gärung entsteht nicht nur Alkohol, sondern noch etwas anderes. Kohlensäure. Dazu mehr im nächsten Kapitel.
2. Wieso prickelt mancher Wein?
Jeder Formel-1-Fan kennt den Moment, wenn auf dem Siegertreppchen eine große Flasche Champagner geöffnet wird, der Korken heraus knallt und das edle Gesöff in hohem Bogen herausspritzt. Die Geschwindigkeit des Korkens kommt zwar nicht an die Formel-1-Boliden heran, ist aber mit 40 km/h schon beeindruckend. Vor allem, da die Beschleunigung rasend schnell geht. Das liegt am Druck in der Flasche, der ungefähr 3–4 Bar beträgt. Der Druck in einem Autoreifen? 2–3 Bar! Also zielen Sie beim Öffnen besser weg von sich selbst oder anderen Menschen. Es könnte sonst schmerzhaft werden.
Champagner ist allerdings nur eine bestimmte Art dieses Weintyps, der Oberbegriff lautet Schaumwein. Davon gibt es noch viele andere, zum Beispiel Cava (Spanien), Franciacorta (Italien), Sekt (Deutschland und Österreich) oder Crémant (Frankreich). Champagner stammt aus einer bestimmten Region Frankreichs und wird gern als Synonym für Schaumwein verwendet.
Herstellung
Bei der Gärung wandelt die Hefe den Zucker im Traubenmost oder – bei Rotwein – in der Traubenmaische in Alkohol und Kohlensäure um. Letztere lässt man aus dem Fass oder Tank entweichen. Um einen Schaumwein herzustellen, gibt man nach der Gärung nochmals Zucker und Hefe in den Wein, füllt diesen in einen Tank oder in Flaschen (die traditionelle und qualitativ bessere Methode) und hindert die Kohlensäure diesmal daran zu entweichen. Es entsteht beachtlich viel Kohlensäure: Aus 100 Litern Traubenmost werden bei der Gärung 40 Liter Kohlensäure freigesetzt! Ein Qualitätsmerkmal ist, wie lange Wein und Hefe zusammenbleiben – man spricht davon, dass der Schaumwein „auf der Hefe“ liegt. Drei Jahre gelten für viele Bläschen-Fans als Minimum, aber es gibt Schaumweine, die viel länger auf der Hefe reifen.
Perlweine und andere Varianten
Allerdings ist nicht jeder Wein mit Bläschen ein Schaumwein. Es gibt auch noch Perlwein (in Frankreich Vin pétillant, in Italien Vino frizzante, in der Schweiz Sternliwein), der nur 1–2,5 Bar Druck aufweist. Zudem ist die Herstellungsmethode hier eine andere, denn die Kohlensäure wird häufig einfach hineingepumpt – was viel billiger ist. Das Perlen und Sprudeln dieser Weine ist dafür bei Weitem nicht so fein. Der bekannteste Perlwein ist sicher der Prosecco. Dazu gibt es in Frage 36 mehr.
Eine wichtige Info braucht man noch, um grundsätzlich zum richtigen Prickler zu greifen: die Geschmacksrichtung. Bei Frage 6 finden sich Informationen zum Restzuckergehalt in den verschiedenen Stufen – es geht von brut nature bis süß. Und falls Sie sich fragen, ob es auch roten Schaumwein gibt: Ja, gibt es. Am bekanntesten war früher der süße Prickler Lambrusco aus Italien. Auch Rosé-Schaumwein gibt es, manchmal aus Roséwein hergestellt, manchmal, indem man etwas Rotwein in Weißen gibt. Sie haben einen besonderen Charme.
Die Urform des Schaumweins ist der Pét Nat. Und weil er gerade Trend ist, hat er sich eine eigene Frage (Nr. 61) verdient.
3. Wie lange gibt es Wein schon?
Lange.
Sehr lange.
Es gibt ihn schon seit dem Neolithikum, der Jungsteinzeit. In Zahlen: seit gut 8.000 Jahren. Damals wurden die nomadischen Jäger- und Sammler-Gesellschaften sesshaft und entwickelten mit der Landwirtschaft auch den Weinbau. Auch die ersten komplexen Kulturen entstanden. Kein Wunder, dass man Wein als ältestes Kulturgetränk der Menschheit bezeichnet.
Armenier und Georgier, Perser und Ägypter
Als Ursprung gilt Vorderasien, vor allem die Gebiete des heutigen Armenien und Georgien.
Eine Legende aus Persien handelt von einer verbannten Prinzessin, die aus lauter Verzweiflung vergorenen Traubensaft aus einem als giftig markierten Krug trank. Sie starb nicht davon, sondern fühlte sich gestärkt. Und was machte König Jamshid? Er befahl, ab jetzt alle Trauben in Wein zu verwandeln.
Der Weinbau verbreitete sich unter anderem in den heutigen Libanon und den heutigen Iran sowie nach Ägypten. In Pharaonengräbern aus der Zeit um 3.000 v. Chr. wurden Weinkrüge entdeckt, auf denen Jahrgang, Qualität und Winzer vermerkt waren. Getrunken wurde dieser Wein allerdings vor allem von Geistlichen und der herrschenden Klasse. Dem Rotwein sagte man wegen seiner blutroten Farbe nach, er verleihe besondere Kraft.
Phönizier, Griechen und Römer
Für die Verbreitung des Weins nach Europa waren die seefahrenden Phönizier von besonderer Bedeutung. Sie verschifften Wein in Tonkrügen, aber auch Rebstöcke – unter anderem auf die Iberische Halbinsel, nach Nordafrika sowie nach Griechenland.
Und die antiken Griechen verfielen dem Wein geradezu, verehrten später mit Dionysos sogar einen Gott des Weins und zelebrierten Trinkgelage. Außerdem brachten sie den Weinbau unter anderem in den Süden Frankreichs und Italiens.
In Rom wurde Wein zum Alltagsgetränk für jedermann. Besonders beliebt war roter und süßer Wein. Getrunken wurde er gewürzt mit Kräutern, nachgesüßt mit Honig oder verdünnt mit Wasser. Legionäre bekamen eine tägliche Ration.
Mit dem Römischen Reich breitete sich auch der Wein bis in den Norden nach England aus. Nahezu sämtliche Weinregionen Europas, die heute berühmt sind, haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Die Römer erkannten genau, wo Rebstöcke am besten wuchsen.
Klöster
Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert n. Chr. wurde die Kirche zur Bewahrerin der Weintradition. Besonders die Benediktiner- und der Zisterzienser-Orden machten sich um den Messwein verdient. Die Mönche in den Klöstern entwickelten den Weinbau und die Kellertechnik auch weiter – wie auch der berühmte Dom Pérignon in der Champagne.
4. In wie vielen Farben gibt es Wein?
Klingt nach einer einfachen Antwort, oder? Viele würden sagen: Zwei, nämlich Rot und Weiß, und wenn man sie mischt, bekommt man auch noch Rosé. Aber es sind tatsächlich vier – und selbst das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Herkunft der Farbe
Fangen wir damit an, woher die Farbe kommt. Sie steckt nämlich nicht im Saft, sondern in den Beerenhäuten. Es gibt nur sehr wenige Rebsorten, deren Saft ebenfalls Farbe besitzt, und sie sind für die Weinproduktion völlig unerheblich. Gelöst wird die Farbe aus den Beerenhäuten bei der Maischegärung (Maische nennt man die Mischung aus Saft, Schalen und Kernen). Je länger diese andauert, desto intensiver wird die Farbe. Wobei es Rebsorten gibt, die grundsätzlich mehr Farbstoffe aufweisen als andere. Trennt man gleich zu Beginn den Most vom Fruchtfleisch und den Beerenhäuten oder macht nur eine sehr kurze Maischegärung, erhält man Weißwein, egal ob man rote oder weiße Trauben verwendet. Läuft die Maischegärung – mit roten Trauben – etwas länger ab, erhält man einen Rosé. Nur wenn die Maischegärung längere Zeit anhält, wird ein Rotwein daraus.
Es gibt auch Rosés, die durch Mischen von Rot- und Weißwein zustande kommen. Das ist in einigen Ländern üblicher als in anderen. In der EU ist es nicht erlaubt (außer bei Rosé-Schaumwein), außerhalb der EU zumeist schon. Rund 10–20 % Rotweinanteil reichen in diesen Fällen für die gewünschte Farbe.
Was ist mit der vierten Farbe?
Man kann, wie gesagt, einen Weißwein aus roten Beeren herstellen, er wird dann Blanc de Noirs genannt („Weißer aus Dunklen“). Man kann aber auch weiße Trauben so verarbeiten, als würde man einen Rotwein erzeugen: Man führt eine Maischegärung in Kontakt mit den Beerenhäuten aus, wodurch sich Farbstoffe aus diesen lösen. Das Ergebnis liegt dann – je nach Dauer der Maischestandzeit – farblich irgendwo zwischen dunklem Gelb und Orange. Diese Tropfen nennt man Orange Wine. Sie unterscheiden sich nicht nur was die Farbe betrifft von Weißwein, sondern auch geschmacklich. Zusammen mit der Farbe werden bei der Maischegärung nämlich auch Tannine, also Gerbstoffe herausgelöst. Orange Wine erlebt gerade einen Hype, die Technik ist jedoch nicht neu, sondern im Gegenteil uralt: Georgien gilt als eine der Wiegen des Weinbaus. Der traditionell dort erzeugte Wein ist maischevergorener Weißer, der in Amphoren reift, den sogenannten Quevri.
Und noch eine Variante
Es gibt auch weiße Rebsorten, aus denen sich roséfarbener Wein herstellen lässt. Die Beerenhäute von Grauburgunder und Gewürztraminer können sich im Herbst rötlich färben. Vinifiziert man sie nun wie einen Rotwein, bekommt man einen Rosé. Den man – das Weingesetz ist da unerbittlich – aber unter Umständen nicht so bezeichnen darf. Sprich: Sieht aus wie ein Rosé, ist aber offiziell ein Weißer. Das Auge mag sich täuschen lassen, das Weingesetz nie …
5. Wie viele Beeren braucht man für eine Flasche Wein?
In der Regel sind es 600 bis 800 Beeren. In Kilogramm umgerechnet reden wir pro Rebstock von 1,5–2,5 Kilogramm Trauben – bei einem qualitativ guten Wein. Man kann diese Menge nicht 1:1 in Liter umrechnen, denn die Trauben werden gepresst, wonach der Trester zurückbleibt (also Kerne, Stängel, Beerenhäute). Aus 100 Kilogramm Trauben erhält man 55–75 Liter Most. Bedeutend weniger ist es bei edelsüßen Weinen, die aus verschrumpelten Beeren gewonnen werden.
Das heißt, ein Rebstock erbringt in der Regel die Menge für ein bis zwei Flaschen à 0,75 Liter.
Weingüter geben aber nicht die Flaschen- oder Kilozahl pro Rebstock an, sondern die von Hektolitern (hl) Wein pro Hektar (ha) Rebfläche. Ein Hektoliter sind 100 Liter, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter (zum Beispiel eine Fläche von 100 Χ 100 Metern). Ein Fußballfeld hat in der Regel 0,7 Hektar.
Dieser Wert heißt Hektarertrag.
In Deutschland liegen die Ertragshöchstgrenzen meist zwischen 80 und 110 hl/ha. Im spanischen Priorat – einer kargen, trockenen Gegend – sind es gerade einmal 10 hl/ha, im italienischen Soave dagegen 140 hl/ha. Die absolute Zahl verrät einem also wenig, man muss sie im Verhältnis zu anderen in der Region sehen.
Weingüter werben manchmal damit, dass sie mit niedrigen Erträgen arbeiten – im Sinne von Qualität statt Quantität. Denn jeder Rebstock kann nur eine bestimmte Menge an Mineralien, Nährstoffen und Wasser über die Wurzeln aus dem Boden ziehen, die sich die Trauben dann teilen müssen. Hängen nur drei am Stock, erhalten sie mehr, als wenn es zehn sind.
Nicht nur Klima und Wetter haben massiven Einfluss auf den Hektarertrag, sondern auch die Rebsorte selbst. Manche bringen von Natur aus viele Trauben hervor – sie werden Massenträger genannt. Darunter fallen Sorten wie Chenin Blanc, Müller-Thurgau, Elbling, Airén oder auch Tempranillo. Massenträger stehen im Ruf, zwar viel Quantität, aber keine Qualität beim Wein zu ergeben. Am Beispiel von Tempranillo oder Chenin Blanc zeigt sich jedoch, dass man durch Ertragsreduzierung sehr komplexe Weine aus ihnen erzeugen kann.
6. Was steht auf einem WeinEtikett?
Ein ganzes Buch könnte man mit den unterschiedlichen Deklarationsvorschriften für Weinetiketten füllen – lesen würde das niemand wollen. Gerade in Frankreich treibt der Individualismus der Regionen faszinierende Blüten.
Name
Was sich finden lässt, meist im oberen Teil eines Etiketts: der Name des Weinguts, der Genossenschaft oder der Kellerei. Manchmal steht davor „Weingut“, „Winzergenossenschaft“, „Château“, „Domaine“, „Tenuta“, „Bodega“ oder Ähnliches, häufig jedoch nur der Name. Im Kleingedruckten findet sich aber stets die gesamte Bezeichnung des produzierenden Betriebs.
Jahrgang
Mit der Ausnahme von Schaumweinen (Frage 2) und gespriteten Weinen (Frage 66) wird in der Regel der Jahrgang der Traubenlese auf dem Weinetikett angegeben. Er kann auch auf dem Rückenetikett versteckt sein. Wenn gar kein Jahrgang vermerkt ist, hat man es in der Regel mit einem äußerst miesen Wein zu tun – in sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen allerdings mit einem ausgesprochen guten und entsprechend teuren.
Rebsorte
Häufig findet sich die Rebsorte auf dem Etikett, also zum Beispiel Riesling oder Spätburgunder. Manchmal auch mehrere, zum Beispiel Weißburgunder-Auxerrois, wenn es sich um eine „Cuvée“, also um einen Verschnitt (Mischung) der beiden Rebsorten handelt. Auch der Ausdruck „Assemblage“ ist dafür üblich. Verschnitten (man sagt auch cuvéetiert) werden hier in fast allen Fällen (die Weinwelt liebt Ausnahmen sehr!) die fertigen Weine, also nicht die Moste.
Bei Cuvées ist es allerdings üblicher, einen Namen zu wählen, statt die Rebsorten anzugeben. Von kryptischen Namen wie „X“ über numerische bis hin zu poetischen wie „Herbst im Park“ ist alles möglich. Manchmal klingen die Cuvéenamen auch wie Weingutsnamen, es ist ein Spiel für Insider.
Region und Lage
Kommen wir zur wunderbaren Welt der Ortsbezeichnungen. Es gibt solche für das Land, die Region – zum Beispiel „Nahe“, „Piemont“ oder „Loire“ – oder die Lage, also den Weinberg. Manchmal (die Begriffe „manchmal“ und „häufig“ fallen sehr oft in diesem Abschnitt!) klingt die Ortsangabe wie der Name einer Cuvée.
In der Weinwelt gilt die Regel: Je spezifischer die regionale Eingrenzung, desto höher die Qualität. Bedeutet: Ist nur ein Land („Frankreich“, „Italien“) verzeichnet, können die Trauben von überall aus diesem Land stammen und auch solche aus dem Süden mit denen aus dem Norden verschnitten werden. Steht der Name einer Region da, dürfen die Trauben nur aus dieser kommen. Das Gleiche gilt für einen Ort, eine Lage oder sogar eine kleine Parzelle innerhalb eines Weinbergs. Manchmal (da ist das Wort schon wieder!) stehen sowohl Region als auch Ort und Lage auf einem Etikett. Zum Beispiel „Ahr“ sowie „Dernauer Pfarrwingert“.
Handelt es sich also immer um einen guten Wein, wenn der Name einer Lage angegeben ist? Nein, denn viele Lagen sind nichts Besonderes. Eigentlich sind die meisten Lagen nichts Besonderes, auf Etiketten werden sie trotzdem abgedruckt. Das ist das Kreuz mit den Etiketten, sie helfen einem weniger bei der Kaufentscheidung, als man hofft.
Alkohol und Schwefel
Die Alkoholangabe findet sich stets auf dem Etikett, wobei Winzer hier auf- und abrunden dürfen (im Bereich 0,5 % vol., also bei 12,01 % darf man 12,5 % notieren, bei 12,99 % dafür auch 12,5 %).
Ein Hinweis zu Schwefel – also Sulfiten – ist mittlerweile Pflicht. Der findet sich in fast allen Weinen, ausgenommen wenige Naturweine (dazu mehr in Frage 28), und ist kein Grund zur Sorge. Er dient dazu, dass der Wein nicht oxidiert.
Von trocken bis süß
Nun zum Thema Geschmack – und hier wird es, man ahnt es, kompliziert. Mit Geschmack sind Bezeichnungen wie „trocken“, „feinherb“, „sweet“, „doux“ oder Ähnliches gemeint.
Weltweit ist die Regel, dass, wenn kein Hinweis auf den Geschmack vermerkt ist, es sich um einen trockenen Wein handelt. „Trocken“ bedeutet, dass nur wenig Restzucker vorhanden ist, wobei die genauen Grenzwerte von Land zu Land und teils von Region zu Region unterschiedlich sind.
Eine der wenigen Ausnahmen war Deutschland, wo nur ein Wein trocken war, auf dem auch „trocken“ stand, alle anderen waren halbtrocken, süß oder mild. Das hat sich größtenteils geändert. Steht aber eine Angabe wie „Kabinett“, „Spätlese“, „Auslese“, „Beerenauslese“, „Trockenbeerenauslese“ oder „Eiswein“ auf dem Etikett, kann man davon ausgehen, dass der Wein halbtrocken bis süß ist – es sei denn, es ist anders vermerkt (bei den letzten Bezeichnungen ist der Wein immer süß). Sehr süße Weine werden zumeist in kleineren Flaschen verkauft; bei trockenen Weinen ist das eher selten.
Fast zu 100 % sicher kann man bei Rotweinen sein: Sie sind in der Regel trocken. Es gibt ohnehin nur wenige mit mehr Restsüße, und bei diesen wird es vermerkt. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, nämlich berühmte Weintypen, bei denen davon ausgegangen wird, dass jeder weiß, wie süß sie schmecken. Ein Beispiel ist der italienische Recioto, der aus getrockneten Trauben hergestellt wird.
Offiziell gelten in Europa folgende Grenzwerte:
Trockene Weine (sec/secco/dry) dürfen im Prinzip höchstens 4 g/l (Gramm pro Liter) Restzucker aufweisen – es sei denn, sie weisen eine hohe Säure auf, dann sind bis zu 9 g/l erlaubt. (In diesem Fall darf die Säure höchsten 2 g/l weniger betragen als der Restzuckergehalt.) Rund die Hälfte aller in Deutschland erzeugten Weine sind trocken.Halbtrockene