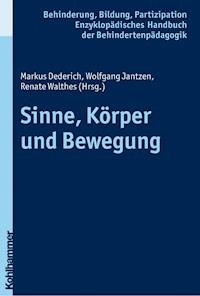
Sinne, Körper und Bewegung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Der Band erörtert die für eine synthetische Humanwissenschaft wie die Behindertenpädagogik zentralen Fragen der Zusammenhänge von Körper, Sinne und Bewegung. Abgesteckt wird ein weites Spektrum von Themen, das allgemeine Fragen des "beseelten" Körpers in der Welt (wie z.B. Psychosomatik, Organismus und Umwelt, Körper und Geschlecht) ebenso aufgreift wie die soziale und psychische Entwicklung im Kontext höchst komplexer körperlicher Einschränkungen (z.B. chronische Krankheit, Koma, Anencephalie u.a.m.). Neben der körperlichen Beeinflussung durch gesellschaftliche, kulturelle, therapeutische und pädagogische Faktoren stehen vor allem unterschiedliche Aspekte der individuellen Entwicklung und Identitätsbildung im Mittelpunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Band erörtert die für eine synthetische Humanwissenschaft wie die Behindertenpädagogik zentralen Fragen der Zusammenhänge von Körper, Sinne und Bewegung. Abgesteckt wird ein weites Spektrum von Themen, das allgemeine Fragen des 'beseelten' Körpers in der Welt (wie z.B. Psychosomatik, Organismus und Umwelt, Körper und Geschlecht) ebenso aufgreift wie die soziale und psychische Entwicklung im Kontext höchst komplexer körperlicher Einschränkungen (z.B. chronische Krankheit, Koma, Anencephalie u.a.m.). Neben der körperlichen Beeinflussung durch gesellschaftliche, kulturelle, therapeutische und pädagogische Faktoren stehen vor allem unterschiedliche Aspekte der individuellen Entwicklung und Identitätsbildung im Mittelpunkt.
Prof. Dr. Markus Dederich und Prof. Dr. Renate Walthes lehren an der Technischen Universität Dortmund. Prof. Dr. Wolfgang Jantzen lehrte an der Universität Bremen.
Behinderung, Bildung, Partizipation Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik
Herausgegeben von Iris Beck, Georg Feuser, Wolfgang Jantzen, Peter Wachtel
Gesamtherausgeber: Wolfgang Jantzen
Redaktion: Birger Siebert
Band 9
Markus Dederich/Wolfgang Jantzen/Renate Walthes (Hrsg.)
Sinne, Körper und Bewegung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Alle Rechte vorbehalten © 2011 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-019638-4
E-Book-Formatepdf:978-3-17-022908-2epub:978-3-17-027718-2mobi:978-3-17-027719-9Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Gesamtherausgeber
Vorwort
Teil I Grundlegung
Körper, Selbst und (Ich-)Identität (Wolfgang Jantzen)
Sinnlichkeit (Markus Dederich, Wolfgang Jantzen & Renate Walthes)
Teil II
Zentrale Fragestellungen
Frühe emotionale und kommunikative Entwicklung (Bodo Frank, Maya Gratier & Ulrike Lüdtke)
Sinne und Wahrnehmungstätigkeit (Michael Stadler)
Bewegung und Handlung (Wolfgang Praschak)
Organismus und Welt (Timo Järvilehto, Alan D. M. Rayner & Lauri Järvilehto
Psychosomatik (Paul L. Janssen)
Habitus (Kerstin Ziemen)
Körper und Geschlecht (Anke Langner)
Ästhetik (Hans Heinz Holz)
Spiel (Pentti Hakkarainen & Milda Bredikyte)
Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung (Wolfgang Jantzen)
Teil III Einzelprobleme
Neuropsychologie I: Wahrnehmung und Bewegung (Michael Niedeggen)
Neuropsychologie II: Körperselbstbild (Jörg Bauer)
Funktionelles System (Wolfgang Jantzen)
Psychomotorik und Sensomotorik (Jürgen Seewald)
Die Entwicklung der Körperidentität (Wolfgang Praschak)
Die Entwicklung der Bewegung (Josef Feigenberg)
Koordination und Können (Bewegungen als funktionelle Organe) (Rilo Pöhlmann)
Die Selbstorganisation von Bewegungen (Theo Rhodes & Michael T. Turvey)
Rhythmus – Rhythmometrie – Rhythmik (Rilo Pöhlmann)
Körper und Ideelles (Beate Blanke)
Sehen und Blindheit (Sven Degenhardt)
Die orale Methode bei Gehörlosigkeit (Klaus-B. Günther)
Sensorische Integration (André Frank Zimpel)
Schmerz, Leid und Trauer (Helmut Däuker)
Lust und Freude (Bernulf Kanitscheider)
Liebe und Sexualität (Bernulf Kanitscheider)
Geschmack (Bernulf Kanitscheider)
Cerebrale Paresen (Annett Thiele)
Zerebral bedingte Sehstörungen (Renate Walthes)
Epilepsie (Wolfgang Jantzen & Gerda Mardones)
Chronisch kranke Kinder (Gerhard Lebherz)
Anenzephalie (Harald Goll)
Koma, Apallisches Syndrom, Locked-in-Syndrom (Andreas Zieger)
Abbauprozesse und degenerative Prozesse: Alzheimer-Krankheit, Morbus Parkinson, Chorea Huntington (Andreas Zieger)
Therapien für den Bereich Bewegung und Wahrnehmung (Sabine Siegert)
Frühförderung: Milani Comparetti, Pikler, Petö, Aly (Hans von Lüpke)
Basale Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung: Kooperative Pädagogik und Dialog (Wolfgang Praschak)
Neuropragmatik (Paul Walter Schönle)
Rehabilitatives Handeln bei Abbauprozessen (Barbara Romero)
Behinderung und Pflege (Patrizia Tolle)
Stichwortverzeichnis
Die Autoren
Vorwort der Gesamtherausgeber
Das Enzyklopädische Handbuch der Behindertenpädagogik „Behinderung, Bildung, Partizipation“ ist ein Lexikon in Stichwörtern, die jedoch nicht alphabetisch, sondern thematisch in 10 Bänden strukturiert wurden. Insgesamt wurden ca. 20 Haupt-, 100 mittlere und 300 kleine Stichwörter erarbeitet. Sie suchen zum einen in ihrer Gesamtheit einen Zusammenhang des Fachwissens herzustellen, in dem jedes Stichwort und zugleich jeder Band verortet ist. Zum anderen aber bilden die Einzelbände aufeinander bezogene thematische Einheiten. Somit ist das Gesamtwerk in zwei Richtungen lesbar und muss zugleich auch so gelesen werden: als Bestand aufeinander verweisender zentraler Begriffe des Fachs zum einen und als thematischer Zusammenhang in den Einzelbänden zum anderen, der aber jeweils auf die weiteren Bände verweist und mit ihnen in engstem Zusammenhang steht. Dementsprechend wurden Verweise sowohl innerhalb der Einzelbände als auch zwischen den Bänden vorgenommen, wobei einzelne Überschneidungen unvermeidbar waren.
Der Anspruch, das Gesamtgebiet der Behindertenpädagogik darzustellen, kann angesichts der Differenzierung und Spezialisierung der Einzelgebiete und ihrer schon je komplexen Wissensbestände nicht ohne Einschränkung vorgenommen werden. So ging es uns nicht darum, diese Komplexität aller Theorien, Methoden, Handlungsansätze und Einzelprobleme in Theorie und Praxis einzufangen, sondern den Wirklichkeits- als Gegenstandsbereich der wissenschaftlichen Behindertenpädagogik hinsichtlich seiner konstitutiven Begriffe, Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen. Dabei sollte der grundlegende, auf aktuellen Wissensbeständen beruhende und der zugleich erwartbar zukunftsträchtige nationale und internationale Forschungs- und Entwicklungstand im Sinne einer synthetischen Human- und Sozialwissenschaft berücksichtigt werden. Reflexives Wissen bereit zu stellen ist also die wesentliche Intention. Dies gelingt nur, wenn aus anderen Wissenschaften resultierende Forschungsstände und Erkenntnisse möglichst breit und grundlegend verfügbar gemacht werden. Aufgrund der komplexen biopsychosozialen Zusammenhänge sowohl von Behinderung als auch von Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation müssen das gesamte humanwissenschaftliche Spektrum Berücksichtigung finden und insbesondere Philosophie, Psychologie und Soziologie, aber auch Medizin und Neurowissenschaften einbezogen werden. Gerade der neurowissenschaftliche Bezug, der selbstverständlich äußerst kritisch betrachtet wird, ist notwendig, um gegen neue Formen der Biologisierung die entsprechenden Argumente für Vielfalt und Differenz auf jeder Wissenschaftsebene, also auch auf der neurowissenschaftlichen, in die Debatte führen zu können. Vorrangig mit Blick auf die disziplinäre Verortung ist jedoch die Erziehungswissenschaft, Behindertenpädagogik ist eines ihrer Teilgebiete.
Für die Konzeption ist ein Bildungsverständnis tragend, das Bildung als Möglichkeit zur selbst bestimmten Lebensführung, zur umfassenden Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Teilhabe betrachtet; mit Wolfgang Klafki: Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität, entwicklungspsychologisch mit Wolfgang Stegemann als Entwicklung auf höheres und auf höherem Niveau. Die erziehungswissenschaftliche Begründung von Bildungs- und Erziehungszielen muss über gesellschaftliche Erwartungen, wie sie sich in Forderungen nach einem Wissenskanon als Zurüstung auf die berufliche Eingliederung niederschlagen können, notwendigerweise hinausreichen und die Lebensbewältigung insgesamt umfassen. Bildung und Erziehung eröffnen Optionen für die Lebensgestaltung, und das bedeutet, die eigene Identität nicht nur schicksalhaft oder einzig von außen determiniert zu erleben, sondern auch über Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und der Auswahl von Handlungsmöglichkeiten zu verfügen, Zwänge und Grenzen ebenso wie Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten erkennen und nutzen zu können. Nicht in jedem Fall, in dem diese Möglichkeiten nicht per se aufscheinen, ist diese Problematik begrifflich quasi automatisch mit Behinderung zu fassen. Umgekehrt heißt Bildung aber auch, solche Strukturen und Prozesse zu gestalten, die „Bildung für alle, im Medium des Allgemeinen“, unabhängig von Kriterien, ermöglichen. Behinderungen im pädagogischen Sinn liegen dort vor, wo die Teilhabe an Bildung und Erziehung gefährdet oder erschwert ist oder wo Ausgrenzungsprozesse drohen oder erfolgt sind, und zwar aufgrund eines Wechselspiels individueller, sozialer und ökonomischer Bedingungen. Hier tritt die Frage der Ermöglichung von Partizipation in den Vordergrund. „Wo Menschen aus ihren Lebenszusammenhängen herausgestoßen werden, da wird lernender und wissender Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität zur Lebensfrage“ (Oskar Negt) und ebenso die Ermöglichung von Lebenschancen. Damit werden zugleich eine Abgrenzung zu sozial- oder bildungsrechtlichen Definitionen und eine weite Begriffsbestimmung von Behinderung vorgenommen, im Bewusstsein der Problematik, die diese mit sich bringt. Doch fasst auch der schulrechtliche Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der wiederum nur partiell deckungsgleich mit dem sozialrechtlichen Behinderungsbegriff ist, äußerst heterogene, darunter auch rein sozial bedingte Benachteiligungsprozesse zusammen. Pädagogik heißt für uns somit auch nicht einseitige und ständige Förderung. Emil E. Kobi hat dies in der Gegenüberstellung einer ‚Pädagogik des Bewerkstelligens‘, der es immer um den Fortschritt geht, die sich nur auf den Defekt richtet und das So-Sein nicht anzuerkennen in der Lage ist, und einer ‚Pädagogik der Daseinsgestaltung‘ beschrieben, die anerkannte Lebensbedingungen zwischen gleichberechtigten und als gleichwertig anerkannten Subjekten und eine befriedigende Lebensführung auch bei fortbestehenden Beeinträchtigungen zu schaffen vermag. In diesem pädagogischen Verständnis von Behinderung liegt eine Begründung für die Beibehaltung des Begriffes der Behindertenpädagogik. Wir respektieren Benennungen wie Förder-, Rehabilitations-, Sonder-, Heil-, Integrations- und Inklusionspädagogik; der Begriff der Behinderung hebt jedoch wie kein anderer nicht nur die intransitive Sicht des behindert Seins, sondern auch die transitive Sicht des behindert Werdens hervor und lässt sich pädagogisch sinnvoll begründen. Ebenso entgeht er Verengungen mit Blick auf den Gegenstandsbereich; behindertenpädagogisches Handeln greift weit über den Bereich der institutionalisierten Erziehung und Bildung hinaus und findet lebensphasen- und lebensbereichsübergreifend statt; auch innerhalb des schulischen Bereiches ist das Handeln weitaus vielfältiger als allein unterrichtsbezogene Tätigkeiten; gleichwohl bleiben diese prominente Aufgaben. Behindertenpädagogik, in diesem weiten Sinne intransitiv verstanden, ist zwar einerseits Teilgebiet der Erziehungswissenschaft, andererseits trägt sie in transitiver Hinsicht zu deren Grundlagen bei. Denn behindert werden und eingeschränkt zu sein sind alltäglich und schlagen sich keineswegs nur in der sozialen Zuschreibung von Behinderung nieder. Entgegen der noch vorfindbaren Gliederung nach Arten von Beeinträchtigungen bzw. schulischen Förderschwerpunkten und einer institutionellen Orientierung ist für uns ein an den Lebenslagen und an der Lebenswirklichkeit der Adressaten von Bildungs- und Erziehungsangeboten orientiertes Verständnis pädagogischen Handelns leitend. Diese Perspektive auf den individuellen Bedarf an Unterstützung für eine möglichst selbst bestimmte Lebensführung ist der Bezugspunkt der personalen Orientierung, aber dieser Bedarf impliziert immer auch den Bedarf an Überwindung der sozialen Folgen, also der behindernden Bedingungen des Umfeldes. Traditionell wird der Lebenslauf- und Lebenslagenbezug der Pädagogik durch die Gegenstandsbezeichnungen der einzelnen Teildisziplinen angezeigt (Pädagogik, Andragogik, Geragogik einerseits; Sozial-, Berufs-, Freizeitpädagogik usw. andererseits). Hiermit können aber auch Abgrenzungen und Abschottungen einhergehen, so dass der Bezug zur Lebenslage als Ganzer und zum Lebenslauf in seiner biographischen Gewordenheit verloren geht. Lebenslagen- und Lebenslauforientierung stellen demgegenüber die notwendige Gesamtsicht her, die allerdings in ihrer Bezugnahme auf die Chancen und Grenzen selbstbestimmter Lebensführung einer Pädagogisierung im Sinne der andauernden intentionalen Erziehung entgehen muss. Sie hebt die spezifischen Gegenstandsbestimmungen und Handlungskonzepte der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen nicht auf, sondern wird als konzeptionelle und methodische Leitperspektive tragend. Ebenso hat jedes Verständnis von individueller Teilhabe- und Bildungsplanung die Deutungshoheit der auf Unterstützung und pädagogisches Handeln angewiesenen Menschen zu respektieren und zentral von politischer Mitwirkung und der Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte auszugehen. Dies verlangt die Demokratisierung und Humanisierung der Handlungsprozesse und Strukturen in Theorie und Praxis sowie die Auseinandersetzung mit Ethik, Moral und Professionalität.
Die aus diesem Verständnis von Bildung, Behinderung und Partizipation resultierenden Fragen lassen sich zusammenfassen in die nach dem Verhältnis von Ausschluss und Anerkennung, Vielfalt und Differenz, Individuum und Gesellschaft, Entwicklung und Sozialisation, System und Lebenswelt, Institution und Organisation, über die Lebensspanne hinweg und immer bezogen auf die Grundfrage nach Bildung und Partizipation angesichts behindernder Bedingungen.
Von diesen Grundgedanken ausgehend wurde die Konzeption und Anlage der Stichwörter von Iris Beck und Wolfgang Jantzen erarbeitet und dann durch das Team der Bandherausgeber kritisch überprüft und ergänzt. Es ergibt sich folgende Gesamtanlage: die Bände 1 und 2 dienen der wissenschaftlichen Konstitutionsproblematik mit Blick auf die wissenschaftstheoretische Begründung des Faches einschließlich der erziehungswissenschaftlichen Verortung und dem Verhältnis von Behinderung und Anerkennung. Die Bände 3 bis 6 repräsentieren Aufgaben und Probleme der Bildung und Erziehung im Lebenslauf mit den Kernfragen nach Bildung, Erziehung, Didaktik und Unterricht zum einen, Lebensbewältigung und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gemeinde zum anderen. Die Bände 7 bis 10 behandeln Entwicklung und Lernen, Sprache und Kommunikation, Sinne, Körper und Bewegung sowie Emotion und Persönlichkeit. Sie stellen grundlegende pädagogische Auseinandersetzungen über Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation angesichts behindernder und benachteiligender Bedingungen dar, und zwar in übergreifender Sicht, die zugleich die notwendigen speziellen und spezifischen Aspekte zur Geltung bringt. Allgemeines und Besonderes sind insgesamt, über alle Bände hinweg, vielfach aufeinander bezogen und haben gleichsam ihre Bewegung aneinander. Dort, wo sich gemeinsame Probleme quer zu speziellen Gebieten stellen, sind diese auch allgemein und mit der Absicht der Grundlegung behandelt, auch um Redundanzen zu vermeiden. Dort, wo ohne Spezifizierung zu grobe Verallgemeinerungen und damit unzulässige Reduktionen erfolgt wären, sind die Besonderheiten aufgenommen. Angesichts der zahlreichen Publikationen, die spezielle und spezifische Fragen en detail und mit Blick auf Einzelprobleme behandeln, ist diese Entscheidung auch vor dem Hintergrund einer ansonsten nicht zu gewährleistenden Systematik getroffen worden.
Wir sind uns bewusst, dass dieser Versuch der Systematik nicht ohne Lücken, Widersprüche und Redundanzen auskommt. Die allfällige Kritik hieran verstehen wir im Sinne des „Runden Tisches“, als den wir die Zusammenarbeit unter den Herausgebern und Autoren verstehen, als Motivation zu neuen Fragen und neuer Forschung.
Wir danken allen Bandherausgebern und Autoren für ihre konstruktive Arbeit, die in Zeiten der Arbeitsverdichtung und Effizienzsteigerung nicht mehr selbstverständlich erwartet werden kann.
Iris Beck
Georg Feuser
Wolfgang Jantzen
Peter Wachtel
Vorwort
Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen die für eine synthetische Humanwissenschaft wie die Behindertenpädagogik zentralen Fragen körperlicher Zusammenhänge. Jedes grundsätzliche Neuverständnis von Entwicklung im Allgemeinen wie von Entwicklung im Kontext einer Behinderung im Besonderen bedarf einer tiefgehenden, sowohl einzelwissenschaftlichen als auch inter- und transdisziplinären Klärung der Zusammenhänge von Körper, Sinne und Bewegung einschließlich des Aufgreifens der damit verbundenen erkenntnistheoretischen Fragestellungen. Dies ist insbesondere erforderlich, da nach wie vor das soziale Feld von Behinderung und Behindertenpädagogik von defektbezogenem Denken durchzogen ist, das Behinderung als Eigenschaft eines Individuums substantialisiert und dieses selbst als Fall von Natur oder Schicksal verobjektiviert. Ebenso wie die Neurowissenschaft unterdessen unser Gehirn als soziales Organ bzw. als Beziehungsorgan hervorhebt, gilt dieses Bezogen-Sein auf eine soziale und humane Welt für alle Aspekte unserer Körperlichkeit. Die erforderliche sozialwissenschaftliche Öffnung jener Teile der Behindertenpädagogik, die aufgrund nichthinwegdiskutierbarer körperlicher Einschränkungen hartnäckig der Naturalisierung verhaftet sind, setzt keineswegs das sorgfältige Nachdenken über Körper und Leiblichkeit außer Kraft, im Gegenteil, es verlangt nach komplexerer Betrachtungsweise und Theoriebildung. Hierbei kommen vielfältige Fragen von Sinnen und Sinnlichkeit, Körper und Leib, Wahrnehmung und Bewegung ins Spiel, die von der Klärung grundsätzlicher Fragen bis zum Handeln in spezifischen Handlungsfeldern reichen.
Zwei Hauptstichwörter, einerseits zu „Identität, Körper und Selbst“, andererseits zu „Sinnlichkeit“, umreißen den Rahmen, in dem sich die anderen Stichwörter bewegen.
Ein entsprechend breites Spektrum von Themen greift ebenso allgemeine Fragen des „beseelten“ Körpers in der Welt auf (z. B. Fragen der Psychosomatik, die Bestimmung des Verhältnisses von Organismus und Umwelt oder Körper und Geschlecht) wie die soziale und psychische Entwicklung im Kontext höchst komplexer körperlicher Einschränkungen (z. B. Epilepsie, chronische Krankheit, Koma, Anencephalie u. a. m.) und in unterschiedlichen Lebensbereichen unter Einschluss von Ästhetik, Spiel und Arbeit u. a. m. Aspekte der Entwicklung allgemein wie unter durch körperliche Einschränkungen erschwerten Lern- und Lebensbedingungen im Besonderen werden ebenso erörtert wie neurowissenchaftliche Grundfragen. Entsprechend den Denkstrukturen der UN-Konvention zu den Rechten behinderter Menschen verfolgen wir ein Verständnis von Behinderung als sozialer Konstruktion. Daher stehen die Möglichkeiten von gesellschaftlicher Teilhabe und von Entwicklungsfähigkeit durchgängig im Mittelpunkt.
Wir haben versucht, mit der Auswahl der Stichwörter und Autorinnen und Autoren diesem weit gefassten Spektrum gerecht zu werden. Nicht alles, was wir realisieren wollten, konnten wir realisieren. Und sicherlich – das kann kaum ausbleiben – wird der/die eine oder andere Leser/in das Eine oder Andere vermissen.
Hervorheben möchten wir die methodische und wissenschaftstheoretische Vielfalt, die den Diskurs über Behinderung in diesem Band wie auch in den anderen Bänden der Enzyklopädie kennzeichnet. Dies zeigt sich in den unterschiedlichen methodologischen und philosophischen Ausrichtungen der verschiedenen Beiträge; hier reicht das Spektrum von materialistischen bis hin zu phänomenologischen Zugängen, von der Psychoanalyse bis zur kulturhistorischen Psychologie, von Piaget bis zur modernen Entwicklungspsychologie, um nur einige zu erwähnen.
Unabhängig von wissenschaftlichen Kontroversen, die es in der Behindertenpädagogik ebenso wie in allen andere Wissenschaftsbereichen gibt und geben muss, sind wir der Überzeugung, dass allein eine Pluralität der Perspektiven und Zugänge der außerordentlichen Mehrdimensionalität, Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas gerecht werden kann. Wissenschaft muss zwar nach den ihr entsprechenden methodologischen Regeln, aber zugleich in demokratischen Diskursen ohne Ausgrenzung betrieben werden.
Wir hoffen, mit diesem Band einen Beitrag zu leisten, die interdisziplinäre Diskussion der Behindertenpädagogik in neuer Weise zu öffnen, indem wir die hohe Interdisziplinarität dieses Faches, u. a. auch durch die Auswahl der Beiträge und Autorinnen und Autoren, in den Mittelpunkt gestellt haben.
Markus Dederich
Wolfgang Jantzen
Renate Walthes
Teil IGrundlegung
Körper, Selbst und (Ich-)Identität
Wolfgang Jantzen
1 Definitionen
Körper (engl.: body, franz.: corps) wird als ‚beseelter Körper‘ auch mit dem Begriff ‚Leib‘ bezeichnet. Im Unterschied zur cartesianischen Annahme eines beseelten Körpers bloß auf menschlichem Niveau sind beide Begriffe auf allen Lebensniveaus anzuwenden, da Leben grundsätzlich nicht als unbeseelt, als bloße Maschinenkonstruktion betrachtet werden kann.
Selbst ist die Reflexivität von Lebewesen auf ihre körperliche Existenz, die sich bereits bei Einzellern in ihrer Fähigkeit zeigt, aktiv „in ihrem Sein zu verharren“ (Spinoza 1989, III, LS 6–8). Sie ist vom Standpunkt des äußeren Beobachters über Appetenz- oder Vermeidungsverhalten zu erschließen. Dies entspricht der allgemeinen Definition von Lebewesen als autopoietische Konstruktionen, die fern vom thermodynamischen Gleichgewicht ihrer Umgebung existieren, an diese durch Wahrnehmung und Bewegung strukturell gekoppelt sind und ihren kognitiven Bereich in der Bewältigung von Fluktuationen/Perturbationen an ihrer Körperperipherie herausbilden (Maturana & Varela 1986). Die Entwicklung höherer Formen des Selbst bei verschiedenen Tiergattungen sowie eines vorrangig bewussten Selbst beim Menschen erweisen sich als Resultate der Hierarchisierung psychischer Funktionen. Höhere Formen des Selbst sind in zunehmendem Maße sozial vermittelt. Hierauf verweisen Bindung, Prägungslernen, instrumentelles und soziales Lernen bei höheren Wirbeltieren. Beim Menschen sind alle Formen des Selbst gesellschaftlich, kulturell und symbolisch vermittelt.
Identität bezieht sich auf die Abstimmung von Organisation (Realisierung stammesgeschichtlicher Voraussetzungen) und Strukturbildung (ontogenetische Variation durch Aktivität des Lebewesens, Lernen, Gedächtnis) der psychosomatischen Prozesse. Auf deren Hintergrund ist zu jedem Augenblick eine Rückkoppelung des Verhaltens an bisherige Erfahrungen gegeben. Ich-Identität bezieht sich auf ein Reflexionsniveau des eigenen Selbst, das es ermöglicht (1) den eigenen Körper als getrennten Körper zu erkennen (z. B. im Spiegelbild), (2) das erwartete Verhalten von anderen Individuen der eigenen Art reflexiv zu erkennen und zu berücksichtigen (theory of mind) bzw. das eigene Verhalten als Werkzeug einzusetzen, um andere zu beeinflussen (role-taking-ability) sowie (3) die Kontinuität des Selbst in diesen Prozessen symbolisch zu identifizieren (mit dem Wort oder der Geste ‚Ich‘). Die beiden ersten Formen sind auch bei höheren Tieren zu finden, die dritte bisher nur bei den Menschen. Hier sind nochmals (1) die Selbstbenennung mit ‚Ich‘ im Übergang vom Kleinkind- zum Vorschulalter von (2) der Selbstbenennung der inneren psychischen Prozesse in der in Pubertät und Adoleszenz entwickelten inneren Position des Erwachsenen zu unterscheiden (= ‚reflexives Ich‘, das sich in der innerpsychischen Differenz von ‚I‘ und ‚Me‘, zwischen ‚Ich‘ und ‚Ich als Du‘ realisiert).
2 Begriffs- und Gegenstandsgeschichte
Körper (Leib), Selbst und (Ich-)Identität sind zentrale Begriffe anthropologischer Reflexion. Sie bilden mit den Begriffen Ich, Person und Persönlichkeit ein zentrales Feld humanwissenschaftlicher Forschung und Diskussion. Diese erfolgt zwischen verschiedenen ontologischen und erkenntnistheoretischen Polen und schlägt sich in unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich des Körper-Geist- bzw. Leib-Seele-Problems nieder. Wasserscheide der Debatte ist die cartesianische Trennung des sich selbst reflektierenden Geistes („Ich denke, also bin ich“) und des als bloßen Automaten gedachten ausgedehnten Körpers in zwei auf immer voneinander getrennte Substanzen (‚res cogitans‘/denkende Substanz und ‚res extensa‘/ausgedehnte Substanz).
Der Versuch von Descartes, diesen Dualismus durch die Setzung der Emotionen als vermittelndes Glied monistisch zu überwinden, scheitert. Die Emotionen, nur dem Menschen eigentümlich, unterliegen nach Descartes selbst einer Trennung in niedere, körperliche und höhere, geistige Emotionen (Vygotskij 1996).
Ein Versuch der Lösung in der Lehre von der ‚dritten Substanz‘ als ‚einfache Reizbarkeit‘ scheitert ebenfalls. Im Gegensatz zur Annahme des Körpers als seelenlosen Automaten zwang die Feststellung der Kontraktilität der Muskelfaser und Sensibilität der Nervenfaser als spezifische Eigenschaften des Lebendigen ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer anderen Definition von Lebensvorgängen (Toellner 1980, 100). Da an den Emotionen als nur den Menschen zugehörigen Prozessen festgehalten wurde, entstand bestenfalls ein Verständnis von lebenden Körpern als Automaten anderer Art. Dieses Verständnis löste sich nur teilweise auf, insofern höheren Tieren eine vergleichbar komplexe psychische Struktur wie Menschen zugestanden wurde. Trotzdem ist ein solches Verständnis in Biologie und Medizin auch heute noch vorherrschend, so z. B. in der Debatte um das Hirntodkriterium oder den Status schwerbehinderter Kinder bzw. dementer alter Menschen. Dies verweist darauf, dass der Gegenstand ‚Körper‘ im sozialen Akt der Erkenntnis sichtbar wird bzw. entsteht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























