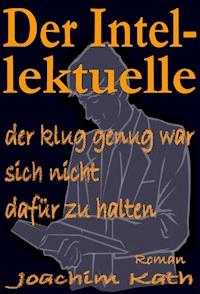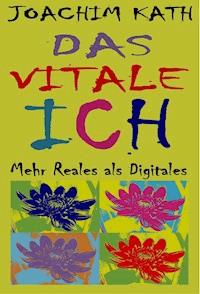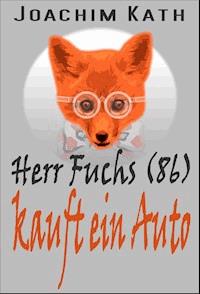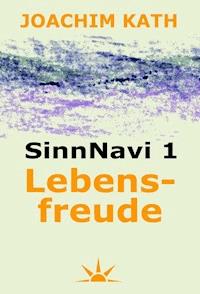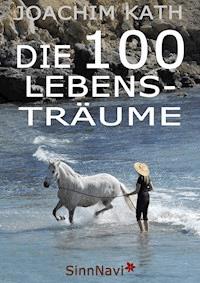Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"SinnNavi 2 - Politische Haltung" erklärt unabhängig und überparteilich, welche Einstellung zur Politik in einer demokratisch verfassten, freiheitlichen Gesellschaft heute sinnvoll und angemessen ist. Die korrekte Haltung ist ein Kompass für Moral und Ethik. Die Notwendigkeit politischer Neu-Orientierung ist in diesen Krisenzeiten überfällig. Die eigene politische Haltung anhand von Werten und Zielen der UNO, der EU, des deutschen GG und der Regierungspolitik zu überprüfen und zu aktualisieren ist sinnvoll. Die Beantwortung wichtiger politischer Fragen auf der Basis von Fakten ist wegen der zunehmenden Radikalisierung dringender denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SinnNavi 2
Politische Haltung
Joachim Kath
INHALT
1. Die Notwendigkeit politischer Neu-Orientierung
2. Was ist Politik?
3. Strategien und Konzepte
4. Was ist Politikwissenschaft?
5. Anleitung für eine durchdachte
politische Haltung
a) Armut beenden
b) Ernährung sichern
c) Gesundheit stärken
d) Bildung für alle
e) Gleichberechtigung
f) Wasser und Toiletten für jeden
g) Saubere Energie weltweit
h) Gute Arbeit für alle
i) Sozial verträgliche Industrialisierung
j) Ungleichheit mindern
k) Lebenswerte Städte
l) Nachhaltiger Konsum
m) Umfassender Klimaschutz
n) Meere schonen
o) Naturvielfalt erhalten
p) Friedliche Gesellschaften
q) Weltweite Kooperation
6. Der Staat im 21. Jahrhundert
Über die SinnNavi-Edition
Über den Autor
1.Die Notwendigkeit politi-scher Neu-Orientierung
„SinnNavi 2 – Politische Haltung“erklärt unabhängig und überparteilich, welche Einstellung zur Politik in einer demokratisch verfassten, freiheitlichen Gesellschaft heute sinnvoll und angemessen ist. Die korrekte Haltung ist ein Kompass für Moral und Ethik.
Im Blog eu1.com des Autors erscheinen in unregelmäßigen Abständen aktuelle Beiträge zu wichtigen politischen Fragen.
Unsere Welt ist in Umbruch. Die Lage muss nicht überdramatisiert werden, aber ernsthafte Gedanken sollten wir uns schon über unsere eigene politische Haltung machen. Sie zu überprüfen und zu aktualisieren, ist auf der Basis der in diesem Buch verständlich zusammengefassten Informationen neutral und selbstbestimmt möglich. Es ist erforderlich, eine neues Politik-Bewusstsein zu entwickeln, in dessen Mittelpunkt zumindest Prozess-Transparenz steht, wenn nicht sogar als Utopie die Gerechtigkeit und Ehrlichkeit aller Beteiligten. Sich dabei immer außerhalb des ritualisierten Parteienstreits samt Plastikphrasen und unbegründeten Schuldzuweisungen zu bewegen, ist im heutigen Politbetrieb keine leichte Übung. Die offizielle Politik wirkt oft wie „auserzählt“. Es ist nicht ihre Aufgabe, in Talkshows unterhaltsam zu sein. Jeder sollte wissen: Die Existenz einer funktionierenden Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie muss gegen Angriffe von außen und innen wirksam verteidigt werden!
Der Inhalt dieses Buches dient der politischen Bildung und als Argumentationshilfe bei Diskussionen. Dies ist absolut notwendig, weil Social Media den politischen Diskurs nicht, wie erhofft, mehr demokratisiert, sondern erschreckend stark polemisiert. Die autoritären, antiliberalen Gesellschaftsentwürfe der EU-Gegner haben in vielen Ländern an Bedeutung gewonnen. Die Europäische Union mit ihren offenen Grenzen (Schengen), ihrem Binnenmarkt und dem Euro ist wahrlich nicht perfekt, aber sie ist für Europa die einzige Möglichkeit, in einer globalisierten, digitalen Welt sozio-ökonomisch zu bestehen. Dem gilt es in der Politik Rechnung zu tragen und sich den EU-Abtrünnigen mit Vernunft und Augenmaß entgegen zu stellen!
Politik ist keine Wissenschaft, aber unsere politische Meinung braucht neben guter Allgemeinbildung ein tragfähiges Fundament. Haltung kann nur bewahren, wer eine hat und nicht ständig die Position wechselt. Der Staat ist nicht in der Lage, alle gesellschaftlichen Probleme zu lösen, zumal sie weder immer vorhersehbar sind, noch sich linear entwickeln. Die Zivilgesellschaft ist hier gefordert! Sie braucht Menschen mit einer politischen Haltung, die sie beizeiten erkennen lässt, dass die Probleme von heute mit den Antworten von gestern oder vorgestern nicht zu lösen sind.
Wie wollen wir in Zukunft leben? Was ist die richtige politische Einstellung? Verführt die Betonung von Moral und Ethik dazu, Sachfragen zu ignorieren? Ist der Pluralismus gefährdet? Gar unsere persönliche Freiheit? Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen ist wegen der zunehmenden Radikalisierung dringlicher denn je. Populismus darf nicht populär werden. Mut der Bürger statt Wut der Hetzer ist geboten. Eine stabile politische Mitte setzt voraus, von der Angst über die Hoffnung zur Zuversicht zurückzukehren. Politische Führung braucht Aussagen mit Substanz. Und sie braucht neben der Bewältigung internationaler Krisen auch nationale Sachpolitik samt der Einrichtung von effizienten Frühwarnsystemen. Eine klare politische Position zu beziehen, wird für alle Nicht-Politiker umso dringlicher, je weniger sie offenbar von Politiker*innen gewagt wird.
Der politische Diskurs der Gegenwart ist oft allein ausgerichtet auf die emotionale Inszenierung des Moments. Argumente und Wahrheiten zählen häufig nicht mehr. Es kommt vielen weitgehend nur noch auf den Effekt an, nicht mehr auf Fakten und Erkenntnisse. Viele fragen sich: Wo ist die Diskussionskultur unserer Kulturnation geblieben? Wo auch die kontinuierliche politische Arbeit? Versinkt alles in Ratlosigkeit? Es herrscht oft der Eindruck vor, dass fast schon zwanghaft im Wochenrhythmus auf ein bestimmtes Thema gesprungen wird, dem dann unverhältnismäßig viel Beachtung in den Medien und seitens der Politik geschenkt wird, obwohl dessen Bedeutung eher marginal für die mittel- und langfristige politische Ausrichtung ist.
Sagen wir es deutlich:Es wird zu viel etikettiert und zu wenig argumentiert! Es werden kaum noch evidenzbasierte Entscheidungen getroffen!
Jedes geäußerte Wort, jeder Satz, wird sofort angegriffen, völlig losgelöst vom Kontext und Inhalt. Oft sogar zunehmend ohne jeglichen Anstand. Menschen werden sofort in die extreme linke oder rechte Ecke gestellt, wenn sie Kritik äußern. Mehr Ruhe und Nachdenklichkeit würde der Debatte gut tun! Die alten Politik-Rezepte funktionieren nun einmal aus vielfältigen Gründen in der digitalisierten Globalisierung kaum noch so wie früher. Darauf muss sich eingestellt werden, aber nicht durch Hass, der die Vernunft ersetzt. Deutsche Politik neigt gelegentlich dazu, ihre Kräfte zu überschätzen und den Willen ihrer Nachbarn zu wenig auszuloten.
Die neue Politik braucht mehr Transparenz, wie Entscheidungen zustande kommen und wer daran mitwirkt. Die Bürger wollen konkret wissen, was ist. Alle Politiker*innen und Nicht-Politiker*innen, alle Gewählten und Wahlberechtigten, generell sämtliche an politischen Themen interessierten Menschen, brauchen ein neues Politikverständnis. Gerade was die Kommunikation zwischen der politischen und wirtschaftlichen Klasse, der sogenannten Elite und den Bürgern angeht, haben sich reale wie auch nur empfundene Informationslücken (Infogaps) gebildet. Sie durch neue Ideen aufzulösen, ist für eine zukünftige globale, europäische und deutsche Politik unabdingbar.
Wir haben erlebt, dass es weltweit Krisen der unterschiedlichsten Art gibt, nicht nur Kriege und Terror, Hungersnöte und Wassermangel, auch andere humanitäre Krisen und Zusammenbrüche von Banken und Finanzsystemen. Ganze Volkswirtschaften befinden sich nach wie vor am Rande des Abgrunds. Im Jahre 2015 waren weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Alle diese krisenhaften Entwicklungen sind nicht wirklich im Griff und bisher nicht annähernd politisch zufriedenstellend gelöst. Manche Probleme sind überhaupt noch nicht angegangen worden.
Vielfach wird seitens der Politik der Anschein erweckt, es sei anders und tendenziell sogar wieder besser geworden, aber das ist oft purer Zweckoptimismus. Wir sehen jeden Tag das Gegenteil in den Nachrichten und aus neuesten Studien wissen wir, dass die Angst der Bürger steigt. 95 Prozent haben nach den massenhaften Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof in der Telefonbefragung im Auftrag eines Senders gesagt, sie fühlten sich vom Staat nicht ausreichend geschützt. Ein Staat, der sein Gewaltmonopol nicht situationsgerecht durchsetzen kann, verliert seine Souveränität. Und wenn man dann zusätzlich gewahr wird, dass es eine interne und eine externe Polizeistatistik gibt, also eine frisierte Version für die Öffentlichkeit, kann diese Information beim besten Willen nicht als vertrauensbildende Maßnahme gewertet werden. Wer Extremismus und Gewalt leugnet, aus dem Motiv heraus, Ausländerfeindlichkeit nicht schüren zu wollen, stärkt in Wahrheit die kriminellen Täter. Toleranz ist nur dann sinnvoll, wenn sie keine Intoleranz und Duldung von Straftaten hervorruft.
Hinzu kommen die gravierenden Versäumnisse in vielen Ländern der Erde, den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für ein akzeptables Leben zu bieten. Wir schaffen es in Wahrheit nicht wirklich, das Konfliktpotenzial zu reduzieren, um den Hauptgrund für die Flüchtlingsströme, die Gefahr für Leib und Leben, einzudämmen. Mit Waffen kann zurückgeschossen werden, sogar auf die Lieferanten derselben und in ganz unterschiedlichen Formen, die spürbar weh tun. Haben Politiker*innen noch die Phantasie für kausale Zusammenhänge?
Ebenso wenig gelingt bisher eine Integration von Migranten vielerorts so gut, wie dies wünschenswert wäre. Parallelgesellschaften verschiedener Ethnien konnten sich etablieren und fallen verstärkt durch problematisches Verhalten auf. Es war naiv seitens der Politik, anzunehmen, Europa würde angesichts der Kriege und des Wohlstandsgefälles zu unseren nur durch das Mittelmeer getrennten Nachbarn auf Dauer ein Paradies der Seligen bleiben können. Genaugenommen wird in Deutschland ein Bundesministerium für die schwierige Aufgabe der Integration der Flüchtlinge und zur Koordination mit den Bundesländern benötigt, ebenso wie ein Einwanderungsgesetz. Jahrzehntelang zu behaupten, Deutschland wäre kein Einwanderungsland, war nicht nur ein Fehler, sondern definitiv unwahr.
Was passiert wirklich zukunftsweisend in Deutschland, dem größten EU-Staat, dessen Wirtschaft angeblich so überaus gut läuft? Die Politik erkennt bisher die konsumgetriebene Einseitigkeit des Wachstums ebenso wenig wie die vergleichsweise magere Produktivitätsentwicklung. Und offenbar auch nicht die hohe und steigende Ungleichheit bei Vermögen, Einkommen und Lebenschancen. Dazu kommt eine marode Infrastruktur, in die viel zu wenig investiert wird, gleiches gilt für die so wichtige, insbesondere in sozialen Brennpunkten im Argen liegende Bildung. Der Wille, notwendige Reformen flächendeckend tatsächlich anzupacken, ist gegenwärtig zu wenig erkennbar.
Es gibt Integrationsämter in Deutschland, aber die sind für die berufliche Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten zuständig. Für die Integration von Asylanten und Einwanderern ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) da, das mit der Integrationsarbeit 2005 begonnen hat, als das Zuwanderungsgesetz in Kraft trat. Fünf Jahre später wurde das Amt dann mit der Entwicklung des Bundesweiten Integrationsprogramms (IP) beauftragt und hat damit begonnen, bestehende Integrationsprogramme von Bund, Ländern, Kommunen und freien Trägern festzustellen und mit den Themen des Nationalen Integrationsplans (NIP) zu vereinen.
Im Januar 2014 wurde schließlich das Pilotprojekt „Jeder Mensch hat Potenzial – zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration für Asylbewerber*innen“ unter der Federführung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie einzelnen Bleiberechtsnetzwerken des ESF-Bundes-programms „XENOX – arbeitsmarktrechtliche Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge“, angesiedelt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAS), begonnen.
Zitat aus der Homepage des BAMF: „Nach dem Prinzip „Early Intervention“ sollen Asylsuchende an neun Modellstandorten (Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Ludwigshafen, Berlin, Dresden, Augsburg und Freiburg) noch vor Abschluss des Asylverfahrens und der eventuellen Erteilung eines Aufenthaltstitels in die Vermittlungsstrukturen der Arbeitsagenturen aufgenommen und ihrem Qualifikationsprofil entsprechend in spezifische Unterstützungsmaßnahmen einbezogen werden.“
Bekanntlich kam dann im Verlaufe des Jahres 2015 die Flüchtlingswelle und das BAMF wurde trotz des Prinzips „Frühes Eingreifen“ total überrollt. Die Asylanträge derjenigen, die überhaupt in dem Chaos einen stellen konnten, stapelten sich zu Hunderttausenden. Niemand hatte mehr einen Überblick über die Zahlen und der Präsident, der übrigens vor dem Kapazitätsengpass gewarnt hatte, musste seinen Hut nehmen.
Die mehr als 20 Wissenschaftler*innen in der Migrationsforschung des BAMF, haben in ihren Studien so bahnbrechende Erkenntnisse festgestellt wie beispielsweise, dass Teilnehmer an Sprachkursen besser Deutsch können als Nicht-Teilnehmer, oder dass die „in Deutschland lebenden Muslime in Bezug auf Herkunft, Glaubensrichtung, religiöse Praxis sowie soziale Situation eine sehr heterogene Gruppe bilden.“ Wenn solche Ergebnisse allerdings als Grundlage der politischen Beratung dienen, dann ist das Fehlen einer unbürokratischen, modernen Gesamtstrategie für die Migration und Integration zwangsläufig programmiert.
Alle diese Fehleistungen und Versäumnisse der Politik in demokratischen Staaten und die moralisch in weitaus größerem Maße zu verurteilende Unterdrückung in diktatorischen Staaten, zeigen die Hilflosigkeit der Mächtigen, den heutigen Herausforderungen angemessen begegnen zu können. Es fehlt einfach der Wille für übergeordnete Problemlösungen aus Gründen eigenstaatlicher Interessen, Inkompetenz und Machterhalt. Das nationalstaatliche Denken gewinnt offensichtlich wieder in vielen Ländern die Oberhand. In einigen EU-Ländern wird sogar der Austritt aus der Gemeinschaft diskutiert.