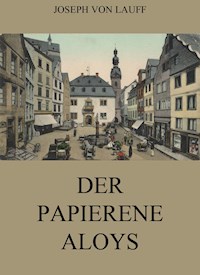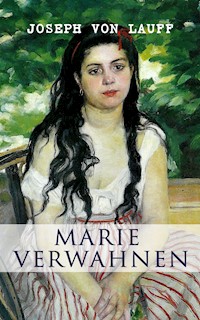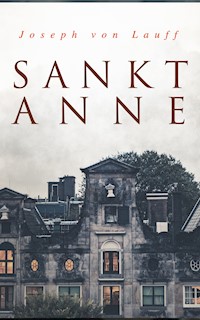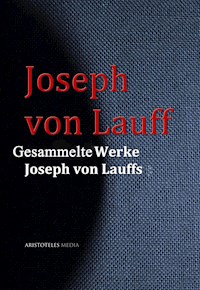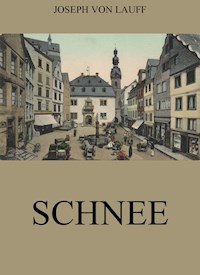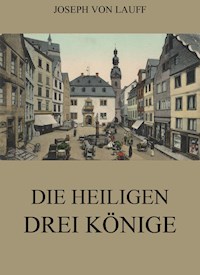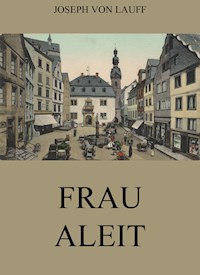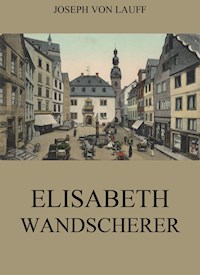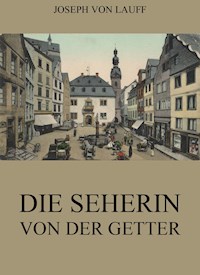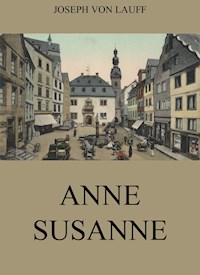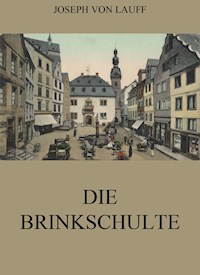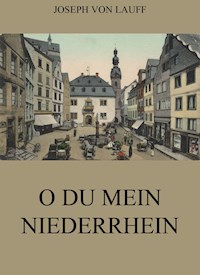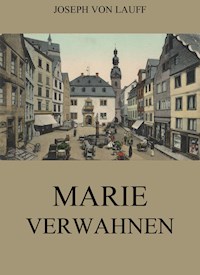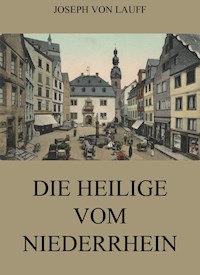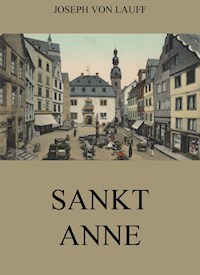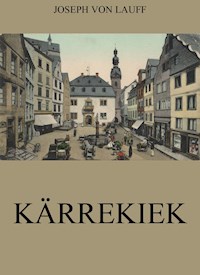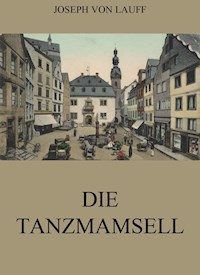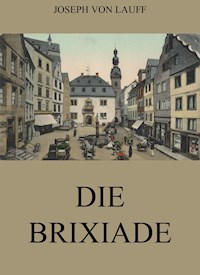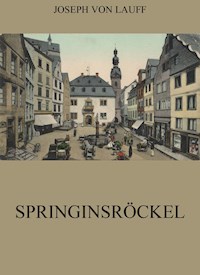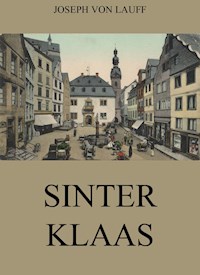
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman vom Niederrhein, der Heimat des Schriftstellers. Lauffs umfangreiches literarisches Werk besteht vorwiegend aus Romanen, Erzählungen und Theaterstücken. In seinen Prosawerken behandelt er meist Themen aus seiner niederrheinischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sinter Klaas
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Sinter Klaas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Schluß
Sinter Klaas, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638825
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Sinter Klaas
1
»Hupla!«
An einem ockergelben Häuschen, das mit seinem kleinen Garten und Ziegenstall an die alte verwahrloste Stadtmauer stieß, schlug herrisch die niedrige Tür auf.
Ein knirpsiger Mensch, ganz in Schwarz gekleidet, glattrasiert, einen schäbigen Zylinder mit Trauerflor auf dem Kopf, das gekniffene Gesicht energisch, zurückhaltend, manchmal lächelnd, meist aber grausam wie das Aussehen eines Knollenblätterichs, war auf der Schwelle erschienen, machte hier Halt und rief über die Schulter in den Hausflur zurück: »Lena, meinen Medaillenstab!«
»Hier, Vater!«
»Merci!«
Dann ging er.
Ein üppiges Weibsbild, das trotz des frischen Wetters seine kräftigen Formen mit einer dünnen Kattunbluse umkleidet hatte, sah ihm mit großen, runden Augen nach, bis die nächste Straßenecke ihn verschwinden ließ. Dann wandte sie sich, kicherte in sich hinein und sah auf den Boden, wo eine feiste, graue, gezähmte Ratte mit klebrigem Schwanz zu ihren Füßen hockte.
»Na, Jette,« sprach sie diese an, »nu geht die Komödie auf den Wassermühlen los. Mir soll's egal sein, auch dir; wir haben doch nichts davon. Jetzt komm' man!« und von dem ekelhaften Ungeziefer begleitet, trat das dralle, nicht unschöne, wenn auch etwas aus dem Leim geratene Frauenzimmer wieder in den Hausflur zurück, ließ sich in der Küche nieder und genehmigte sich ein Schälchen mit Kaffee.
Inzwischen war der Alte weiter gepilgert, geschwollen, stocksteif, wie der Tod im Puppentheater; mit einer gewissen Selbstherrlichkeit und Grandezza schritt er durch die Kesselstraße, über den Großen Markt mit den altfränkischen Giebeln, wo der Reitergeneral Friedrich Wilhelm von Seydlitz in Stein gemetzt aufragte und die vierhundertjährige Linde eben dabei war, die ersten grasgrünen Blättchen durch die Hüllen zu stoßen – er, Jan van den Birgel, und sagte den Tod an.
Er ging von Haus zu Haus, wenigstens zu solchen, die sich durch ihr Äußeres vorteilhaft hervortaten; denn was er zu melden hatte, war für die Honoratioren bestimmt. Die kleinen Leute wurden in Bausch und Bogen und mehr summarisch behandelt.
Bei einer gediegenen Schnirkeltreppe, die zu einer vornehmen Tür mit blanken Messingbeschlägen führte, hielt er den Fuß an. Neben dem Eingang hing ein schwarzes Brett, auf dem Protokolle, Auktionen und sonstige gerichtliche Sachen mit Oblaten festgeklebt waren.
Hier wohnte der Notar.
Mit dem Medaillenstab klopfte Jan van den Birgel an. Als ihm geöffnet wurde, leierte er seinen Spruch herunter; aber dieses Geleier war zähfadig, hatte den Geschmack von welken Blumen auf der Zunge, war mit Krepp umwickelt und erinnerte an Firnis und Hobelspäne.
»Christian Franz Malthus ist tot,« sagte er langsam. »Begräbnis am Freitag, präzise drei Uhr. Requiescat in pace!«
Dann ging er zum Apotheker, dicht nebenan.
»Christian Franz Malthus ist tot. Begräbnis am Freitag, präzise drei Uhr. Requiescat in pace!«
Dann zum Doktor.
»Christian Franz Malthus ist tot. Begräbnis am Freitag, präzise drei Uhr. Requiescat in pace!«
Und wieder klopfte er an.
Es war beim Steuerempfänger ...
Es mochte auf vier gehen. Die Schwalben, die erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt waren, hatten bereits niedrigen Flug; im Westen spreitete sich schon ein resedafarbiges Band, das sich hier und da mit rosigen Tupfen bedeckte – da drehte sich Jan van den Birgel dem Kesseltor zu, überschritt die Schleusenwerke und trat auf den Paternosterdeich, der in einer mächtigen Schleife, an stillen Ortschaften und Gehöften vorüber, nach Wissel und Emmerich führte.
Hier blieb er stehen und sah in die Gegend.
Jan van den Birgel war ein grausiger Kerl. Auf den ersten Blick gewahrte man nicht, worin eigentlich das Grausige bestand. Er konnte demütig sein, aber unter dieser scheinbaren Demut lagen häßliche Gedanken, wie Sumpf und Moder unter einem stehenden Wasser. Er war wie eine Nebelkrähe, die unter blankem Sonnenlicht ihres Weges zog und sich doch am wohlsten fühlte, wenn sie auf irgend eine mistige Stätte oder bei einem verluderten Tier einfallen konnte. Sein Lebensbuch umfaßte Seiten, die beschrieben waren, aber auch solche, die keine Zeile enthielten, und diese gaben dem ganzen Buch das Gepräge. Wie alt er eigentlich war, wußte keiner zu sagen. Sein Aussehen wechselte wie das eines Chamäleons. Was er eigentlich trieb, auch darüber schwiegen die Akten. Sein Leben ging hin wie das eines Maulwurfs, einer Küchenschabe, oder wie das eines Borkenkäfers, der seine heimlichen, unheimlichen Gänge bohrte, sich im Holzmulm amüsierte, Eier und Maden erzeugte, die ihrerseits wieder ihr weiteres Dasein auf eigene Gefahr und Laune förderten und sich dabei trefflich erhielten. Nur das wußten alle: vor etlichen Jahren war er noch Leinweber gewesen, wobei ihm sein fleißiges Weib das Garn haspelte und die fertiggestellte Ware auf dem Wege des Hausierhandels unter die Leute brachte. Aus dieser Ehe war eine Tochter, die Lena, entsprossen. Die wuchs heran zu einem starken Menschenbild, schmal in den Schultern, breit in den Hüften, geschmeidig in den Gliedern und mit Brüsten, die an eherne Kuppeln erinnerten. Eine Zeitlang verknüpften sich mit diesen Kuppeln unliebsame Erörterungen, die aber im Laufe der Tage zurückebbten, dann gänzlich verstummten. Während nun diese Gerüchte in sich zusammenfielen, hatte Frau van den Birgel das armselige Leben überbekommen, streckte unter dem Leintuch die Beine steif und wurde unter den Lebensbäumen dicht beim Kalvarienberg begraben. Mit diesem Tage hatte der trauernde Gatte die Lade kaltgestellt und das emsige Schiffchen in eine Ecke gepfeffert. Er wollte nicht mehr. Statt dessen schaffte er sich einen Zylinder mit hängendem Trauerflor an, legte sich einen Medaillenstab zu und versah das Amt eines Leichenbitters in der kleinen Gemeinde. Durchschnittlich fünf bis sechs Tote im Jahre. Davon konnte keine Kirchenmaus leben, geschweige denn ein Mann, der sein Handwerk beiseite getan und eine Tochter zu ernähren hatte, deren Haupttätigkeit darin bestand, mit Jette zu schäkern, ihre blanken, tadellosen Zähne zu zeigen und im übrigen Gottes Wasser über Gottes Acker laufen zu lassen. Und doch lebte Jan van den Birgel, lebte gut und gediegen, hatte allsonntags sein gesottenes Huhn im Topf und seine Bouteille Doppelbier auf dem Tisch und, wenn's hoch her ging, auch seinen Boonekamp of Magenbitter; aber über das Wie und Wodurch, über die Möglichkeiten dieses Lebens, das mit dem der Lilie auf dem Felde eine gewisse Ähnlichkeit hatte, darüber schwieg die Chronik des kleinen Ortes, wußte niemand etwas Bestimmtes zu sagen, darüber gingen nur Mutmaßungen ... und dennoch: die Fäden hierzu liefen ins Geldrische. Dort, zwischen den unermeßlichen Nierswiesen, auf einem stattlichen Anwesen, das über fruchtbare Äcker, treffliche Viehbestände und ausgedehnte Molkereien verfügte, trafen sie sich und schürzten sich hier zu einem festen gordischen Knoten zusammen, und der derzeitige Besitzer dieser weitverzweigten Liegenschaften hütete sich wohl, den scheußlichen Knoten kurzerhand auseinander zu schlagen.
So standen die Dinge, als Jan van den Birgel, der Mann mit dem schäbigen Zylinder und der langen Pleureuse, auf der Deichkrone stand und in die weite Gegend hinaussah.
Drüben, keine Büchsenschußweite von ihm entfernt, auf einem niedrigen Hügel, der sich unvermittelt aus der Ebene erhob, lag die Höfkenssche Mühle, klobig, im weißen Chorhemd, 'ne schwarze Schieferkalotte auf dem Kopf und mit gewaltigen Armen, die sie langsam und gemächlich im Kreise bewegte.
Dort mußte er hin und weiter in die Niederung fort, wo der Gutshof Op gen Dort sich am fetten Boden ausstreckte, breit hingelagert, und von dem jungen Hans Harkort regiert, dem die Menschen den seltsamen Namen ›Kalviner‹ beigelegt hatten. Ja, auch zum Kalviner mußte er hin, aber erst später. Vorher jedoch ...
»Dorthin!« sagte er mit heiserer Stimme, streckte den Medaillenstab aus und gespensterte an der schwarzen Kuhle und der Mergelgrube vorbei auf die Windmühle los.
Unmittelbar neben ihr, von einer weißen Mauer flankiert und mit abgekröpften Linden umstanden, lag das Wohnhaus, fett und gemästet wie die Mühle selber, mit blanken Scheiben, ziegelroten Pfannen und der ganzen Behäbigkeit eines niederrheinischen Anwesens.
Als Jan van den Birgel den mit Karren, Roßäpfeln und ausrangierten Mahlsteinen besetzten Hof überschritt und dann in den Hausflur trat, empfing ihn das Gebelfer eines bissigen Spitzes.
»Kusch' dich, du Vieh!«
Vor der bleiernen Stimme verkroch sich der Hund wie eine arme Seele, die etwas auf dem Kerbholz hat und nicht weiß, was sie mit ihrem Elend anfangen soll.
Gleich darauf pochte der Medaillenstab gegen die erste Tür rechts vom Eingang.
»Wer ist da?«
»Ich!«
»Wer, ich?«
»Jan van den Birgel.«
»Dann in Gottes Namen: herein!«
Der Windmüller Cornelis Höfkens, auch der ›Matador‹ geheißen, saß an diesem Nachmittage mit brennender Kalkpfeife im Lehnstuhl, breitbeinig, mehlüberstaubt und mit einem glatten Gesicht, das an die Physiognomie eines weißen, verschnittenen Bullen erinnerte. Von den Ohrläppchen zogen sich graumelierte Hasenpfötchen bis zur Mitte der feisten Backen, die noch die frische Spur des Rasiermessers an sich hatten. Er war ein Mann in den sechziger Jahren, ernst und würdig in seinem Gehaben, und gehörte zu denen, die ihre wohlüberlegten Worte langsam wie die lauretanische Litanei durch die Zähne ziehen. Eine weitläufige Verwandte aus dem Geldrischen, Mamsell Apollonia Korthals mit Namen, versah ihm den Hausstand.
Die etwas kurzatmige und reichlich mit Matronenspeck ausgestattete Dame verstand es, ihm das Leben so angenehm wie nur möglich zu machen. Cornelis fühlte sich wohl unter ihrem Zepter und ließ sie schalten und walten nach bestem Gutdünken. Im übrigen suchte er seine eigenen Wege. Sein Geschäft ging ihm über alles, aber auch die Solopartie, die ihn und seine Freunde, als da waren: der emeritierte Kappesbauer und Schnapsbrenner Pitt Lörksen, der Spezereiwarenhändler Dores Schweißgut und Christian Franz Malthus, allwöchentlich zweimal in der Wirtschaft ›Zum dicken Tommes‹ zusammengebracht hatte. Mit dem Ableben des letzteren war allerdings eine empfindliche Lücke zu Tage getreten, klaffte eine bedenkliche Leere, die den ersprießlichen Fortbestand der Kartengemeinschaft in Frage stellte, wenn nicht gar unmöglich machte. Christian Franz Malthus, der ›Trumpfkönig‹ im Spiel, diese Säule am Stammtisch des ›Dicken Tommes‹, dieser stiernackige Mensch, wenn auch in den letzten Jahren merklich zusammengebrochen, hatte die Partie aus der Hand gelegt und war plötzlich und unversehens koppheister gegangen. Sein geheimnisvolles Ableben wirbelte die Gemüter der kleinen Stadt bunt durcheinander. Man stand vor einem Rätsel, das keine Lösung verstattete. Die niedergefallenen Flore und Kreppschleier lagen so dicht, daß darunter jede Vermutung erstickte und ersticken mußte. Nur Cornelis hatte seine eigenen Gedanken, und als er sich mit ihnen näher befaßte, sie von sich wies, aber immer wieder auf den traurigen Zusammenhang der Dinge zurückkam, da lief ein kalter Schauer über den Rücken des Lebendigen.
So saß er mit seiner brennenden Kalkpfeife und sandte lichte Wölkchen zur verräucherten Decke, als einer Einlaß begehrte.
»In Gottes Namen: herein!« sagte er feierlich und sah mit glanzlosen Augen auf den Boten des Todes.
Jan van den Birgel senkte dreimal den Medaillenstab vor ihm nieder.
»Tag, Höfkens!« sagte er in seiner leiernden Sprechweise. »Christian Franz Malthus ist tot, Begräbnis am Freitag, präzise drei Uhr. Requiescat in pace!«
»Ich weiß, ich weiß,« versetzte Cornelis, »und wenn's Backsteine regnet – ich komme.«
»Kann's mir denken,« meinte Jan van den Birgel, »aber von wegen der Solopartie – 'n Halbstündchen früher. Ich glaube, er hat's so gewünscht auf Leben und Sterben.«
»Das hat er,« bestätigte der Müller mit feuchten Augen.
»Und dann – vergeßt die Kalkpfeife nicht!«
»Die?!« sagte Cornelis. Über sein blankes Gesicht lief ein tiefes und trauriges Verstehen. »Man bloß keine Sorge. Fünfundzwanzig Jahre hindurch an dem nämlichen Stammtisch gesessen – ich und mein Geschäfts- und Solokollege, fünfundzwanzig Jahre hindurch Karten gekloppt, immer dasselbe, fein und mit allen Schikanen – ich und mein Geschäfts- und Solokollege ... Gottverdomie noch mal, und da das Beste vergessen?«
Seine Worte erstickten.
»Menschenskind,« fuhr er mit verhaltener Stimme fort, wobei er sich aufwuchtete, »das wäre ja nächst dem leibhaftigen Satan ... Hier stehe ich mit brennender Kalkpfeife, und mit brennender Kalkpfeife werde ich meinem Geschäfts- und Solokollegen die letzte Ehre antun. Amen. Im übrigen: habt Ihr Pitt Lörksen verständigt?«
»Verständigt,« nickte Jan van den Birgel. ›Trumpfsieben‹ kommt pünktlich.«
»Und Dores Schweißgut?«
»Dito verständigt. ›Grünober‹ nimmt sich die Ehre.«
»Merci!«
»Nichts zu danken, absolut nichts zu danken. Es war alles ein Tun, und nu kann ich wohl weiter machen, zum Kalviner und so. Aber was ich noch sagen wollte, Herr Höfkens ... Ich meine: eigentlich habt Ihr die große Nummer gezogen.«
»Was heißt das: ›die große Nummer gezogen›‹?«
»Gott, wie man so redet!« griemelte der Leichenbitter vergnügt vor sich hin. »Ich weiß nichts Bestimmtes, absolut nichts Bestimmtes; aber mir ist so der Gedanke aufgegangen: jetzt bekommt Ihr die dreifache Portion Wind in die Segel.«
»Warum das?«
»Komische Frage, Herr Höfkens. Herr Malthus ist tot, tot wie 'ne Ratze, wird übermorgen begraben, na, und so weiter. Auch sein Geschäft wird übermorgen begraben; denn sind männliche Erben vorhanden? Keine blasse Idee von 'ner Ahnung. Wer soll da die Wassermühle betreiben? Ich will nicht und dito Ihr auch nicht. Also – das gibt Wind in die Segel. Gratuliere. Oder habt Ihr 'ne andere Ansicht?«
»Ja, seine Tochter, die macht es.«
»Die?« meinte Jan van den Birgel und lachte kurz und grindig auf. »Nicht rühr' an die Sache. Simonis bedankt sich.«
»Simonis, Simonis ...?!«
Der sonst so behäbige Windmüller fiel aus seiner Rolle. Der Name wirkte auf seine Gemütsverfassung wie Feuer und Schwamm auf trockenes Roggenstroh. Seine Beschaulichkeit legte er ab, wie einer einen linden, wohltuenden Pelzrock an den Nagel hängt, um dafür einen groben Arbeitskittel aus der Kirschholzkommode zu nehmen. Mit einer herrischen Handbewegung zeigte er auf einen Stuhl.
»Nehmt Platz!« sagte er zwischen den Zähnen und warf sich selbst in den zunächst stehenden Sessel.
Jan van den Birgel folgte mit einem gewissen Unbehagen der dringlichen Aufforderung. Als er sich endlich niedergelassen, den fuchsigen Zylinder auf den Tisch gestülpt und den Medaillenstab wie ein Sponton neben sich aufgepflanzt hatte, meinte er lauernd: »Also ich bitte, Herr Höfkens. Was soll's mit Simonis?«
»Der kommt gleich an die Reihe,« versetzte der Müller, »zuerst das mit dem ›Wind in die Segel‹. Auf Parol, Herr Jan van den Birgel« – und der alte Herr war aus einem verschnittenen zu einem veritabelen Bullen geworden – »ich für meine Person habe mich nie an dem verfluchtigen Spruch gehalten: Ungegönnt Brot soll fett machen. Der Deuwel mag's fressen! Ich und Malthus sind immer die besten Freunde gewesen, und ich hab's ihm niemals verübelt, wenn seine Wassermühlen die doppelte Arbeit besorgten. Im Gegenteil: liefen seine Mahlgänge wie geschmiert, war's meine Freud', gingen sie mal weniger gut, war's mein Elend. So hab' ich's immer gehalten, und kein Neid oder sonstig Begehren ist mir dabei unter die Weste gekommen. Auf Parol, niemals im Leben! und jetzt, wo er tot ist, kann ich nur wünschen, daß sich Kosman Kraneboom als erster Gesell weiter betätigt und Franziska als einziges Kind die Geschäfte besorgt, um das Unternehmen proper über Wasser zu halten. Das wollte ich sagen von wegen der infamen Geschichte mit dem ›Wind in die Segel‹. Ich will nicht andermanns Profit. Ums Verrecken nicht, unter keiner Bedingung. Jedem das Seine. Und wer da etwas anderes herausspekuliert, dem schlage ich die Knochen zusammen. Verstanden? Meine Weste bleibt rein, ist es immer gewesen, wird niemals einen Flecken besitzen, im Angedenken an den da« – dabei zeigte er mit dem Daumen der rechten Hand über die Schulter – »an den Trumpfkönig, an meinen verstorbenen Geschäfts- und Solokollegen, sonst kann ich ihm nicht als Matador unter die himmlischen Augen treten, wenn es so weit mit mir ist und sie mir das letzte Hemd über die Ohren ziehen. Kurzum, was Malthus geschaffen, das muß weiter florieren, und dazu ist nötig: Franziska muß aus dem Geldrischen heraus, muß auf die Wassermühlen zurück, um mit Hilfe von Kosman die ganze Geschichte auf dem alten Standpunkt zu halten. Auf Parol, das ist meine ehrliche Meinung, und damit Strich unter die Sache.«
»Aber Simonis ...!« warf Jan van den Birgel lauernd dazwischen.
»Der?!« schrie der Müller, und unter seinen wie mit Spinnweben verhangenen Brauen brannte ein häßliches Licht auf. »Bleibt mir mit Simonis vom Leibe! Da liegt ja das Elend! Das ist ja der Anfang von seinem Jammer und Sterben gewesen. Drum pinkert jetzt der Wurm in der Mühle, ist er auf die Hobelspäne gekommen, wird ihm der Deckel über die Nase geschoben, und wenn ich dran denke, wird mir der Oldenkott Rippchentabak zum Ekel,« und dabei zerbrach er die irdene Pfeife und warf die einzelnen Stücke mit einem grimmigen Fluch in eine verlorene Zimmerecke. Verzweifelt flocht er die Hände zusammen und sagte: »Malthus, Malthus, du bist von jeher 'ne noble Nummer gewesen, immer derselbe, vornehm bis dahin, keine menschliche Seele konnte dir was nachsagen, nicht so viel, wie das Schwarze unterm Nagel bedeutet. Aber dann kam einer und hat dir die richtige Besinnung verkleistert – und da bist du den Holzweg gefahren, den richtigen Holzweg – und da ging das nicht anders – du mußtest ... und als ich genauer zusah, da hattest du deine einzige Tochter dem Simonis verschrieben ... Malthus, warum?! – Himmel, Herrgott und Mühlstein ...!«
Mit geballter Faust schlug er auf den Tisch, daß der Tabakkasten davon aufhoppelte.
»Ja,« sagte Jan van den Birgel und zwinkerte listig mit seinem linken Augenlid, »wenn einem seine Mühle so abbrennt, ich meine seine Mehl- und Kornspeicher, da kann schon alles passieren.«
»Was abbrennt? Was kann alles passieren? Ihr wollt doch nicht sagen, Jan van den Birgel ...?!«
»Nichts will ich sagen. Dafür ist mir mein Mundwerk zu schade. Aber das mit der Mühle ... irgend 'ne Unvorsichtigkeit ... gut versichert ... Gott ja! da kann doch irgend ein Streichholz ... und wenn da in der Nähe sich so'n bißchen Stroh und Werg befindet ... Selbstverständlich,« und er machte mit seinem Sponton eine bedeutsame und große Bewegung, »bei Malthus – ausgeschlossen die Sache. Aber sie ist doch nun einmal vor die Hunde gegangen – die Wirtschaft. Dran laßt sich nichts ändern.«
»Wenn auch,« fiel der Alte dazwischen. »Drum brauchte er sich nicht dem Simonis mit Haut und Haaren zu verkaufen. Da waren noch andere da. Zum Beispiel: hier steht der Matador,« und mit einem Ruck war Cornelis Höfkens in die Höhe gefahren. »Hier steht er, und wenn er ein Einsehen gehabt hätte, ich war immer zu haben, bei Tages- und Nachtzeit, bar und in Kassenscheinen, ganz gleich, und wären mir dabei die Hypotheken auf die eigene Mühle geflogen. Auf Parol! dafür hab' ich bei den grünen Husaren gestanden. Aber er wollte ja nicht und tat's lieber mit dem Simonis probieren. Unsinn, verfluchter! Was ist bei dem ganzen Handel herausgekommen? Kein Dittchen. Nur Unglück und Elend. Er ist darüber so halber sinnig geworden, und sie, was die Tochter bedeutet, die hat er auch auf dem Kerbholz.«
»Nein,« konstatierte Jan van den Birgel mit sichtlichem Wohlbehagen, »die hat er nicht auf dem Kerbholz. Das pure Gegenteil ist hier Trumpf in der Karte. Gut, sie hat den Simonis geheiratet. Aber warum das? Um die niedergebrannten Kornspeicher wieder aufs neue zu richten, um wieder Kapital auf die Mühle zu tragen und den Alten aus der Predullig zu helfen.«
»Ich sagte schon eben: ich hatte mich solidarisch verpflichtet.«
»Schon richtig, aber Simonis war forscher. Er wird schon seine Gründe gehabt haben – der Alte. Und außerdem: 'ne piekfeine Sache die Heirat. Alles doppelt und dreifach. Plüschene Sofas und so, und ich sage Euch, Höfkens, die kann allsonntags mit 'nem Juckergespann ins Hochamt 'neinkariolen. Ist das vielleicht nichts? Hundert schleckern die Finger nach so was. Das Weibsbild ist glücklich.«
»Mensch, Sie!«
»Herr Jeses! ich will's auf die Gabel nehmen und doppelt beschwören.«
Feierlich hob der Leichenbitter das Sponton in die Höhe.
Ein Fluch fiel über ihn her.
»Ruhe, Jan van den Birgel! Kein Wort mehr. Ich weiß es schon besser, wie es um mein Patenkind steht. Die kann den gestrigen Tag nicht mehr finden, die ist elend bis in die Knochen und ging am liebsten ins Wasser hinein, um ihr jämmerliches Leben zu ersäufen wie 'ne überflüssige Katze. Das weiß ich, so wahr ich hier stehe, so wahr ich der Matador bin und dereinstmals hoffe, das hölzerne Kamisol in Ehren zu tragen.«
»Das sind pure Redensarten, Herr Höfkens.«
»Was, Redensarten?!« fragte der Alte und trat auf ihn zu, »wo mir da alles bis an den Hals geht und mir das Herz abdrehen will, wo mir das Gesagte als Trauer und Tränen über die Zunge stolperte, da wollt Ihr meine Worte als Redensarten verschleißen? Herr, in drei Teufels Namen noch mal!« – und seine sonst, so ruhige und langsame Stimme flackerte auf – »nochmals gesagt: ich bitte um Ruhe, Jan van den Birgel, denn da ist noch eine andere Sache, eine ganz andere Sache,« und er warf den Kopf herum und trat ans Fenster.
»Nu kommt die Kalvinergeschichte,« klang's hinter ihm her.
»Ja, die Kalvinergeschichte!« gab der Müller zurück, stieß den Flügel auf und sah in den Abend, der langsam aus den sterbenden Lichtern des Tages herauswuchs. Die Schatten hatten schon lange Beine und schmale Gesichter. Dabei war die Luft so blank wie eine Spiegelscheibe, die die Fernen wiedergab, als wenn sie auf dem Präsentierteller lägen. Jenseits des Paternosterdeichs, kaum eine halbe Stunde von der Höfkensschen Mühle entfernt, erstreckte sich eine schmale Hügellehne quer durch die Niederung. Von dort blinkten helle Fenster, in denen der letzte Schein der untergehenden Sonne wie böhmische Granaten blutete, gleich gespenstigen Augen herüber. Die Konturen eines weitverzweigten Gutshofes hoben sich scharfumrissen von der Terrainwelle ab, die die ganze Gegend beherrschte. Von zersplissenen Baumgruppen flankiert, weißgekalkt und von saftigem Wiesengrün umbettet, machte der Gebäudekomplex einen stolzen Eindruck, der jedes niederrheinische Bauernherz höher schlagen ließ. Er stand wie auf einer Goldfolie, ruhig, trotzig und einsam, als hätte der lauliche Frühlingsabend seine ganze Glorie um ihn gespreitet.
»Da wohnt der Kalviner,« sagte Cornelis, und sein Arm hob sich langsam, um ebenso langsam wieder an seinem Leibe herunter zu sinken. »Wassermühlen und Op gen Oort die nämliche Schose. Alles riecht nach dem Spaten. Malthus ist tot, und der da von drüben ... Besser schon: er wäre von der Koppel gesenst wie mein Solokollege. Aber das kommt noch, das kommt noch, denn der Mensch kann nur 'ne gewisse Portion Not und Mordio vertragen. Was drüber hinausgeht, darf höchstens mit 'ner Handvoll Kirchhofserde wieder gutgemacht werden. Simonis, Hundekanaille ...!«
Unvermittelt schraubte der gutmütige Mensch sein Wort in die Höhe. Es klang schrill und blechern.
»Das ist ja nächst dem leibhaftigen Satan! Das ist ja, um den Katzenschwanz zwischen die Türe zu klemmen und das Biest gottslästerlich zu verprügeln. Das ist ja ... Zerquält und zerschunden, gehetzt und abgetrieben wie'n armselig Stück Wild! Himmel, Herrgott und Mühlstein! Mensch, wie konntet Ihr dem ehrlichen Kerl nur das gebrannte Herzleid antun?! Hundekanaille ...!« und mit heiserem Stöhnen warf er den Schädel herum. »Und Ihr da, Jan van den Birgel, Ihr und Simonis, Speck und Schwarte von der nämlichen Sorte, Ihr habt mitkomplottiert und dem braven Kalviner ...«
»Höfkens, macht keine Geschichten!«
»Ach was, Geschichten! Ich weiß, was ich weiß, oder Gottes Wort ist gelogen.«
»Höfkens, ich sage noch einmal ...«
Grinsend und lauernd hatte sich der unheimliche Gesell von den Binsen erhoben.
»Sagt, was Ihr wollt! Ich bleibe bei meiner Ansicht und bin erbötig, sie unter die Leute zu bringen. Basta!«
»Höfkens, ich sage zum dritten und letzten ...«
Die Stimme des kleinen Mannes vibrierte.
»Laßt mich aus dem Spiel, oder ich beschreie die Sache!« Mit erhobenem Stab war er näher getreten, den Blick starr und stur auf den Müller gerichtet. Seine magere Brust hob und senkte sich krampfhaft. Sein fahles Gesicht wurde noch fahler und fahriger und erinnerte in seiner scheußlichen Tünche an das eines Totenkopfes, auf dem nur noch spärliche Haarreste standen. Dabei wirbelte er das schwarze Sponton durch die Luft.
»'runter mit dem verfluchtigen Medaillenstab!« gebot der Müller mit herrischer Handbewegung, »denn mit dem niederträchtigen Ding habt Ihr schon, Strunk und Stiel, Glück und Reputation zusammen gehauen. Fisimatenten, infame!«
»Mensch, beleidigt mein Amt nicht, sonst kann es immer passieren ...«
»Was kann passieren? Immer nur heraus mit der Sprache!«
»Wartet man ab!« grinste der Kleine, und dann mit seinen kalten, steifen Fingern die Schultern des erregten Mannes berührend, sagte er tonlos, nachdem er die grauen Augen verächtlich geschlossen und sie wieder geöffnet hatte: »Beleidigt mein Amt nicht, sonst: Höfkens und Malthus, Wind- und Wassermüller werden in denselben Mustopf geworfen. Mir ganz partie egal, wie es kommt. Ich kann warten und warte. Aber das sag' ich Euch, Müller: ich brauche nur diese Finger gegen die Mühle zu strecken, hier diese fünf Finger – und drei Tage später könnt Ihr bereits als Matador mit dem Trumpfkönig Solo in der Ewigkeit spielen.«
Er lachte kurz und abgehackt auf, kurz und niederträchtig. Es klang, als habe ein Elstervogel vom Galgenholz heruntergegeckert.
Gleichzeitig klappte der Medaillenstab bei Fuß.
»Verstanden, Cornelis?«
Ja, er hatte verstanden.
Höfkens erbleichte.
Eiswasser lief ihm über Nacken und Rücken.
Was wollte der Mensch nur? Der Kerl hatte zu infame Manieren. Ihm so den Tod an die nackte Kalkwand zu malen! Das war ja bei Licht besehen 'ne Niedertracht, wie kein schäbiger Bußprediger sie besser hätte ausdenken können. Am liebsten hätte er dem widerwärtigen und gefährlichen Knirps die Drohung ums Maulwerk gepfeffert; aber er wagte es nicht. Seine Willenskraft erlahmte unter dem höhnischen und lästerlichen Blick dieses scheußlichen Beamten, der noch immer drohend vor ihm stand, ihm von Zeit zu Zeit die Schultern mit seinen kalten und steifen Fingern betippte und immer wieder versicherte, er brauche nur die Hand zu strecken, um die schwarzen Bretter in die Mühle tragen zu lassen, die nach Firnis riechenden Bretter, mit den blanken Beschlägen und dem finstern Bahrtuch darüber.
Mit beiden Händen wehrte er ab.
»Unsinn!« sagte er mit unsicherer Stimme. »So leicht stirbt sich das nicht; denn ich hoffe noch immer meine zwölf bis fünfzehn Jährchen zu leben. Was meint Ihr dazu, Jan van den Birgel?«
Mit einem breiten Lächeln suchte er sich über seine schweren Bedenken, über das ekelhafte Angstgefühl, das sich an ihn geworfen hatte, hinweg zu schwindeln. »Im übrigen,« brummte er kleinlaut, wenn er auch versuchte einen jovialen Ton anzuschlagen, »'nen ›Ollen Klaren‹ gefällig?«
»Wenn's denn sein muß, warum nicht?« versetzte der Kleine. »Aber Frieden gehalten, dann kann's noch mal gut gehen.«
Cornelis atmete auf, begab sich ans Eckschab und entnahm ihm ein Gläschen und eine Bouteille mit gebranntem Wasser.
»Beste Qualität!« meinte er freundlich, schenkte ein und präsentierte den Fusel. »Wohl bekomm's!«
»Merci!« sagte Jan van den Birgel, wippte das Gläschen hinunter, stülpte sich den Zylinder über den kahlen Schädel und achselte den Trauerflor über den linken Arm. »So, nu muß ich zum Kalviner 'nüber.«
»Gute Verrichtung!«
»Danke und nochmals gesagt: Christian Franz Malthus ist tot. Begräbnis am Freitag, präzise drei Uhr. Requiescat in pace! Vergeßt die Kalkpfeife nicht!«
Dann sockte er ab.
Cornelis Höfkens sah ihm mit bleiernen Augen nach.
2
Fünfundzwanzig alte, mächtige, sparrige Pappeln auf Reihe! Man konnte lange suchen, ähnliche zu finden, so trotzig ragten sie auf, so breitwipfelig und selbstgefällig liefen sie neben der wuchtigen Deichkrone her, die hier ihre größte Höhe erreichte, um dann wieder um etliche Meter abzufallen und in ebenmäßiger Weise ihren Weg nach Holland zu suchen. Und wenn der Sommerwind in ihren Laubmassen wühlte, wenn es heiß und dunstig in der Ebene herankroch und Gottes Licht wie ein gewaltiges Auge unter dem brandroten Himmel aufzwinkerte, dann begannen die alten Bäume zu rauschen, gewaltig und tausendzüngig, und sie erfüllten die weite Niederung mit ihren brausenden Stimmen. Fünfundzwanzig alte, mächtige, sparrige Pappeln im Wetterlicht, im Sommersturm – das gab eine Melodie wie selten zu finden ... und die Leute in der kleinen Stadt hörten darauf und sagten: »Nu geht's los! Bei Malthus werden die Bäume lebendig. Sankt Florian, hilf uns!«
Heute standen sie wie angenagelt, rührten und regten sich nicht und schafften heimlich daran, ihre Knospen zu brechen und die stillen Zweige mit ihrem braungoldigen Grün zu umschleiern. Gottes Abendlicht hing zwischen den Ästen.
Hinter diesen Pappeln versteckten sich die beiden Mühlen, die hier vor dem Stauwasser lagen, das unter dem Namen Kalkflack aus der Gegend von Xanten und Alpen herkam, die Stadt umflutete, am Kesseltor sich wieder vereinte und jenseits der Schleuse in breiter und ruhiger Fläche dem Rhein zuströmte.
Gesondert von den Wassermühlen erhob sich das stattliche Wohnhaus mit seinen weitläufigen Mehl- und Getreidespeichern, ein massiger Bau von herrischer Eigenart, der erst vor sechs oder sieben Jahren, nachdem der alte einem großen Schadenfeuer zum Opfer gefallen, fest und bodenständig aus der Scholle gewachsen war. Mit seinen hohen Dächern und blanken Scheiben sah er nach der offenen Seite hin weit in die Gegend, über Schleusen und Deiche, Wiesen und Triften, bis dorthin, wo die blauen Wälder von Moyland und die leichten Konturen der Rheindämme der Fernsicht ein Ziel setzten.
Noch vor wenigen Tagen hörte man schon von weither das rege Treiben auf den Malthusschen Werken. Karren fuhren ab und zu, Korn wurde abgeladen und schweres Stückgut mit Kleie und Mehl verfrachtet, und wenn man an solchen Stunden auf dem breiten Wehr stand und in die Tiefe hinabsah, dann ward einem seltsam und schaurig zumute. Dieses Gepolter zwischen den Strebebalken, dieses Seufzen und Ächzen, dieses Rumoren und Gurgeln aus dem schäumenden Gischt heraus benahm den Atem und machte die Augen trunken; denn wenn die gigantischen Räder, die, nur durch eine schmale Wassergasse getrennt, ihre kreisende Bewegung vollführten, wie festgelegte vorsintflutliche Tiere die tobenden Strudel unter sich fortschaufelten, sich wechselseitig begeiferten und dumpf vor sich hin brummten – immer dasselbe, immer dasselbe, dann schlug einem das Herz bis in den Hals hinein vor Andacht und vor heimlichem Grauen ... und dann hatte Christian Franz Malthus in der mehlüberstaubten Einfahrt gestanden, die Hände in den Hosentaschen, ernst und gemessen, an manchen Tagen mit gerunzelter Stirn und geballten Fäusten, aber immer Herr seiner Sinne und stets darauf bedacht, seinem Namen und seiner Arbeit Ehre zu machen.
Das war jetzt anders geworden, ganz anders. Die Mahlsteine ruhten, die gewaltigen Schaufler feierten, das Wasser lag wie tot und stierte bleiern aus der Tiefe herauf, denn ihr Herr und Gebieter lag mit spitzer Nase und bläulichen Fingernägeln auf seinem Paradebett, die Hände gefaltet, von Dämmerungen umgeben, neben sich eine brennende Wachskerze, von deren Messingleuchter ein Rosenkranz aus Pockholzkügelchen herabhing.
Christian Franz Malthus, genannt der ›Trumpfkönig‹, hatte ausgerungen. Morgen schon sollte er in die schwarzen Bretter hinein und in der Guten Stube aufgebahrt werden, wo er gerne in seinen Mußestunden verweilt, die lange Kalkpfeife geraucht und die schöne Glasservante betrachtet hatte, die eine Fülle köstlichen Delfter Porzellans enthielt. Das war nun alles vorbei und vorüber. Früher und heute! Gott ja! es hatte sich vieles verändert. Seitdem das große Schadenfeuer seine Kornspeicher heimgesucht hatte, als Nöte und Ängste kamen, seitdem seine einzige Tochter als Frau Simonis im Geldrischen wohnte und er immer und immer wieder seine traurigen und tiefdenkerischen Blicke auf Op gen Dort richten mußte, seit diesen Tagen war der knochenharte, spartanische, eigenbrödelnde Mann nur noch sein eigener Schatten geworden. Er arbeitete noch, aber diese Arbeit machte ihm keine herzhafte Freude mehr. Allwöchentlich spielte er mit seinem Kollegen Cornelis Höfkens, dem Spezereiwarenhändler Dores Schweißgut und dem emeritierten und fidelen Kappesbauer Pitt Lörksen sein Partiechen Solo im ›Dicken Tommes‹, allein auch hierbei wollte das richtige Behagen nicht mehr kommen, so daß er häufig ganz verloren ins Licht stierte, die meisten Stiche verpaßte und manches aufgelegte Trumpfsolo einfach in den Schornstein zu schreiben hatte. Dieses Sinnieren und Brüten wurde mit der Zeit immer schlimmer und bedenklicher, und da eines Tages ... Es war am verflossenen Sonntag gewesen ... er hatte noch an seiner Schreibkommode gesessen, stundenlang kalkuliert und gerechnet, das Niedergelegte kuvertiert und gesiegelt und es alsdann auf das sorgfältigste in ein Geheimfach seines Zylinderbüros verschlossen, als er plötzlich aufstand und mit dem Ausruf: »Es muß noch heute geschehen,« das Schriftstück zum Notar brachte, zurückkehrte und mit leuchtenden Augen seine Mühlen betrat, die unter der Sonntagsruhe lagen. Hier machte er sich an dem Gangwerk des linken Wasserrades zu schaffen, trat auf die Plattform, die über der Tiefe hing, und sang mit mächtiger Stimme den Kampf- und Weihegesang der christkatholischen Menschen, daß es weithin die ganze Gegend erfüllte. Gleichzeitig setzte sich das große Rad in Bewegung, rollte und schaukelte und übertönte mit seinem Rauschen und Schaufeln das gewaltige »Wir sind im wahren Christentum«, das aber schließlich so herrisch vorgebracht wurde, daß es sich siegreich behauptete und aufstieg wie ein Adler mit ehernen Schwingen.
Wie eine Jerichotrompete kam es von der Höhe herunter, schwebte es über den Wassern, marschierte es zu den Menschen – das Lied, das Lied! Und also tönte und klang es:
»Wir sind im wahren Christentum, O Gott, wir danken dir! Dein Wort, dein Evangelium, An dieses glauben wir. Die Kirche, deren Haupt du bist, Lehrt einig, heilig, wahr. Für diese Wahrheit gibt der Christ Sein Blut und Leben dar.«
Dann verstummte es plötzlich; nur Rad und Wasser polterten weiter.
»Was los, was los?!« schrie Kosman Kraneboom, der Obergesell, aus seiner Kammer heraus, wo er seine Feierstunde verbrachte, stürmte vor, stoppte das Wehr ab und brachte das Gangwerk zum Stehen ... und er fand, was er suchte. Mit eingetriebenem Schädel hing der Müller zwischen den Speichen, noch die stolzen Worte: »Wir sind im wahren Christentum« auf den blutleeren Lippen.
Bald darauf lag er in seiner abgeblendeten Stube zwischen den Kissen, gestreckt wie ein Pfahl, geworfen wie eine überständige Eiche im Winterwald. Kein Arzt konnte mehr helfen. Nur der junge Vikarius erschien, gab dem Todwunden die letzte Ölung und sprach die Sterbegebete. Dann ums Abendwerden ... noch einmal kehrte das Bewußtsein zurück. Er rief nach Kosman, und als er mit diesem allein war, sprach er ihm zu und legte ihm eine dringliche Mission auf die Seele. Zwei Tage später war alles vorüber. Aber seltsamerweise, trotz der eiligen Depesche: Frau Simonis kam nicht und kam nicht. Da trat Kosman Kraneboom an den Toten heran, gebeugt und ganz durcheinander. Bekriegte sich aber und sagte mit zerdrückter Stimme: »Da muß was passiert sein im Geldrischen; aber sie wird schon kommen, die arme Franziska. Bis dahin bin ich der nächste dazu, dir den letzten Dienst zu erweisen. Im übrigen noch: was ich mir denke, darüber liegt Kirchhofserde. Jeder ist sein eigener Herr und Meister. Was er mit seinem Leben anfängt, das ist seine besondere Sache. Wir sind im wahren Christentum. Auch du. Daran darf keiner nicht rütteln. Malthus, ich schweige. Nur mit einem habe ich darüber zu reden. Gott sei deiner Seele barmherzig. Gehe hin zum ewigen Frieden; du verdienst ihn, denn dein Leben war Mühe und deine Seele war irre geworden vor lauter Bedrängnis. Keiner hebe den Stein wider dich auf. Wir alle sind sündig. Du noch am wenigsten. Gott wird gnädig sein. Amen.«
Hierauf machte er gegen den Abgeschiedenen das Zeichen des heiligen Kreuzes, drückte ihm die Augen zu und ging an die Arbeit.
Jetzt lag der Müller in königlicher Ruhe. Alles Leid war von ihm genommen. Die Mahlgänge feierten, die Wasser schwiegen; nur die braungoldigen Pappeln wisperten leise herüber. –
Wenn man von dem Höfkensschen Anwesen nach Op gen Oort wollte, mußte man die Wassermühlen passieren. So stakelte denn auch Jan van den Birgel schon geraume Zeit auf sie los, immer die große Einfahrt vor Augen, die, nachdem er den Kommunalweg hinter sich hatte, ihm wie ein unersättlicher Schlund entgegengespensterte.
Sie wurde immer größer und breiter. Der Abend kroch langsam in sie hinein, ließ aber noch so viel Helle übrig, daß man die Spinnweben, die von den schweren Balkenlagen wie zierliche Festons niederhingen, sattsam erkennen konnte. Mehr dem Inneren zu, zwischen dem Läutewerk, den hungrigen Trichtern und den verstäubten Mahlgängen, die aussahen, als wäre ein Rauhreif darüber gefallen, baumelte eine Messinglaterne, ein mattes Licht, unstet und fahrig, als schwebe der arme Geist des heimgegangenen Müllers zwischen Decke und Diele. Die nächste Umgebung stand unter dem verlorenen Schein dieser hängenden Leuchte.
Von dorther kam eine einsame und trostlose Stimme: »Herr, sei seiner armen Seele barmherzig!«
Mit wehem Ton zitterte sie durch die eingedunkelten Räume.
Und wieder klang sie: »Von den Schrecken der Finsternis – erlöse sie, o Herr!«
Die Stimme schwoll an, gewann einen zuversichtlichen Ausdruck und sagte: »Von ihren noch anhaftenden Sünden und den ewigen Strafen, die ihrer warten – befreie sie, o Herr!«
Eine wuchtige, schwerfällige, vierschrötige Gestalt, die auf einem Mehlsack gekauert hatte, erhob sich unter der Rübsenöllampe, langsam wie ein niederrheinischer Ackergaul von der Spreu, wie ein Gewaltiger aus dumpfem Traume heraus.
Es war Kosman Kraneboom, der Obergesell, das Faktotum der Mühle, die rechte Hand des Verstorbenen, der Sorger und Mühwalter, der Mensch mit dem reinen Gewissen, der nicht um Haaresbreite die Tafeln Mose außer acht gelassen hatte. Er war rein wie ein Kindergemüt, selbstlos wie eine Mutter, arbeitsam wie ein entmannter Stier im Joch. Die weißgesprenkelte Seidenmütze übergezogen, silberne Ringe in den Ohrläppchen, eine graumelierte Bartfräse um Backen und Kinn, gehörte er zu den Stillen im Lande. Er war ein Häuslerkind, auf dem Emmericher Eiland heimatberechtigt und mehr als dreißig Jahre im Dienst des abberufenen Mannes. Wer ihn ansah, freute sich über das Maß seiner Glieder, wer mit ihm zu tun hatte, wunderte sich über sein ausgesprochenes Gerechtigkeitsgefühl, wer aber den traurigen Mut fand, ihm an den properen Wagen zu karren, dem war es, als führe ihm Gottes Donnerwolke über den Schädel. Und dieser Kosman Kraneboom, dieser Insichgekehrte und Denker, wegen seiner vaterländischen Gesinnung auch der ›Preußen-Kosman‹ genannt, führte sein Gebetbuch mit den großen Lettern näher dem Licht zu und betete stärker: »Von dem nagenden Wurm des Gewissens – erlöse sie, o Herr! Befreie sie, o Herr! Mache sie rein, o Herr! wie ein Hemd auf der Frühlingswiese, auf daß sie eintriumphieren möge in den Garten deiner ewigen Freuden!« Und er streckte die Arme in das Dunkel hinein, und sein Schatten wuchs an der gegenüberliegenden Wand wie ein Zyklop auf. Er rief um Gnade für seinen toten Herrn und Meister wie der dürstende Hirsch nach der Quelle: »O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Welt ...«
»Herr erbarme dich unser!« nahm ihm plötzlich ein andrer das Wort von den Lippen.
Kosman fuhr auf und warf den Kopf herum.
»Wer ruft da, wer stört mich in meinem Gebet?«
»Ich habe mir die Ehre genommen.«
Ein Medaillenstab blenkerte auf, eine dunkle Gestalt trat näher heran. Jan van den Birgel war durch die Einfahrt getreten.
»Ich bin's.«
»Jetzt seh' ich's,« sagte Kosman Kraneboom und fuhr sich mit der borkenrissigen Hand über die ausgebleichten Augen. Gleichzeitig machte er eine abwehrende, stumme Bewegung.
»Gefällt Euch wohl nicht?!« meinte der Eindringling.
»Offen gestanden, es wäre mir lieber gewesen, Ihr wäret vorüber gegangen. Mit Euch und ähnlichen Leuten habe ich nicht gerne zu schaffen. Aber nichts für ungut, Jan van den Birgel.«
»Hm!« sagte dieser mit heiserem Lachen, »kann's mir schon denken. Ich und Simonis, wir zwei beiden ...«
»Ja, ihr zwei beiden,« kam es bedrückt aus dem Munde des vierkantigen Menschen, »ihr habt schon 'ne gehörige Portion Dreck an den Schuhen.«
»Kosman!«
»Das habt ihr; denn wenn ich Euch sehe, muß ich an Simonis denken, und wenn ich mir Simonis vorstelle, dann ist es mir gerade, als erfröre mir das Vaterunser zwischen den Zähnen.«
»Das sind wieder so 'ne verfluchtigen Preußen-Gedanken.«
»Schon möglich, aber laßt man diese Gedanken in Ruhe, denn wer dem Volk diese preußischen Gedanken nimmt, der nimmt dem Volk seine richtige Andacht, der bricht ihm das Rückgrat. Solche Gedanken wecken Tote auf, machen klar und hellsichtig, haben Mist an den Füßen, sind wie Gebote des Herrn. Sie sagen die Wahrheit, denn seit dem Tage, wo Ihr und Simonis uns mit euren malproperen Fingern die niederträchtige Suppe anrührtet, ist der Müller sinnig geworden, war sein Schatten ohne Kopf, konnte er den gestrigen Tag nicht mehr finden ...«
»Und der Brand . ..?«
»Herr Jeses, der Brand! Das war 'ne ehrliche und rechtschaffene Sache. Bleibt mir mit dem Feuer vom Leibe! Feurio! Rein war's wie die Sterbekerze am Sarg unsres seligen Dechanten. Wer schickte es? Der liebe Gott hat's geschickt. Da kann niemand gegen an operieren. Das kam, weil's kommen mußte. Ihr aber, Ihr und Simonis, ihr trugt Pech und Schwefel herzu und mächtige Teertonnen und bliest in die Flammen, um euren eigenen Hammel zu braten, euern fetten, dickleibigen Hammel, und seit dieser Stunde wühlt so 'ne niederträchtige Maulwurfskreatur vor der Einfahrt herum, hier vor der Einfahrt. Jeden hellichten Morgen hat sie ihren infamen Hügel geworfen ... und wißt Ihr, was so'n Hügel bedeutet?«
»Dummes Zeug und Unsinn bedeutet's.«
»Mensch – Ihr!« trumpfte Kosman Kraneboom auf, und tief in seinen verbleichten und ausgewaschenen Augen begann es zu leuchten. »Das ist ja, als täte ein Verrückter das Maul auf. Unglück bedeutet's, den Tod bedeutet's, und als die schöne Franziska, als sie sich dem Simonis verschrieb und den andern ins Elend hineinstieß, als sie hinaus mußte, als Gott und alle Welt in den Binsen versanken, da war's auch mit dem Müller alle geworden; denn wo war seine muntere Art geblieben? Abgehalftert wie'n spatlahmer Gaul. Und wo hatte er seine forsche Hantierung und barbarische Arbeit hingetan? Sucht auf dem Boden nach; da liegen sie beim alten Gerümpel, die konnten sich selbst auf Krücken nicht mehr weiter helfen, und so ist denn das Unglück gekommen. Das mußte gesagt werden, denn so was ist die preußische Wahrheit. Den Rest wißt Ihr selber. Das große Rad war barmherzig und hat ihn auf die Hobelspäne geworfen.«
Seine Worte verebbten, gingen unter in einem dumpfen Gemurmel.
Noch einmal flackerten sie auf.
Kosman Kraneboom streckte die Hand aus und sagte, den Blick eindringlich und scharf auf seinen Besucher gerichtet: »Geht weiter, Jan van den Birgel, sonst kann ich meine Andacht nicht finden.«
Zwischen den verstäubten Balken und Mahlgängen bewegte sich eine fühlbare Stille. Sie war plötzlich gekommen, ganz unerwartet, mit dem unheimlichen Schritt des Verhängnisses. Die beiden Menschen standen sich stumm gegenüber. Jeder von ihnen suchte die Gedanken des andern zu erraten. Sie waren wie angeschmiedet. Vieles ging ihnen durch den Sinn. Alle Begebnisse, die sich in den letzten Jahren auf den Wassermühlen abgespielt hatten, all das Sorgen und Ringen, die dunkeln Rätsel, die nebeneinander aufragten wie die düsteren Stämme in einem Föhrenbusch, zogen an ihren geistigen Blicken vorüber, als Kosman Kraneboom sich abwandte und wieder in sein monotones Murmeln verfiel, gleichsam, um den ungerufenen Gast aus der Einfahrt zu beten.
Aber der rührte und regte sich nicht, blieb, wo er war, und machte keine Anstalten, der dringlichen Aufforderung Folge zu geben.
Da drehte sich Kosman.
Seine Schläfen hämmerten. Mit einem energischen Ruck schob er seine Schirmmütze in den Nacken zurück.
»Ihr klebt ja wie Schusterpech,« sagte er hart und trocken. »Was wollt Ihr noch länger? Hier zwischen den Pfählen ist Sabbatruhe, Totenruhe. Ich will meine Überlegung haben. Drum sag' ich noch einmal: Geht weiter, Jan van den Birgel, sonst kann ich meine Andacht nicht finden.«
»Ihr Knüppel, Ihr!« fuhr der Gemaßregelte auf. »Ihr Knollfink von 'nem Herrgottsanbeter. Weiß der Deibel, was ihr Kerls nur habt, was euch in die Kaldaunen geschlagen! Erst der dämliche Windmüller mit seinen großartigen Redensarten, dann Ihr, dem toten Wassermüller sein Rosenkranzhanack! Das ist ja um die Kränke zu kriegen. Himmel, Herrgott und Motten!« und Jan van den Birgel stieß den Medaillenstab auf, daß davon ein unwirscher Klang durch die verlorenen Räume irrte. »Was fällt euch denn ein, mich hier zu kuranzen, Ihr und der Windmüller! Rutscht mir den Buckel 'runter, ihr alle zwei beiden! Was wollt Ihr überhaupt?! Ich bin hier im Amt, von der Kirche gesendet, Leichenbitter und so, und wer mir konträr ist, versündigt sich an Gott und der Auferstehung des Fleisches.« Seine Stimme schrumpfte zusammen. »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,« sagte er leise. »Amen, Amen!«
»Wenn Ihr denn kommt als friedfertiger Mann, als Seelenbräutigam ...«
»Als solcher bin ich gekommen,« sagte Jan van den Birgel.
»Dann allerdings ... was wegen der Ordnung geschieht, soll in der Ordnung verbleiben. Also, ich bitte. Ich will, daß alles der Regel gemäß ist, denn ohne eine solche, sagt der Herr Vikar, bleibt das menschliche Tun nur Stückwerk und eine klingende Schelle.«
»Meine ich auch,« bestätigte der Alte. »Wenn einer so unter den Sargdeckel spazieren will, muß ihm das kommod gemacht werden, denn er hat noch 'ne lange Reise vor sich. Da muß einer fix bei der Hand sein und Sorge drum tragen. Ich meine: ist alles parat für den Freitag?«
»Alles,« versicherte Kosman mit langem Gesicht. Aus seiner Brust rang sich ein weher und verhaltener Seufzer.
»Und dann im Angesicht seines Sterbens,« fuhr Jan van den Birgel erhobenen Tones fort, »ich frage zum andern: Wer kleidet ihn ein?«
»Die Notnachbaren. Auch die Frau von Dores Schweißgut und Cornelis seine Aufwartemamsell wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Die totale Aufmachung vom besten Ende weg. Am Kopfstück kommt 'ne zehnpfündige Kerze zu stehen.«
»Und wer balbiert ihn?«
»Schnurr Schnapp von der Waterkant.«
»Allerhand Achtung!« stellte der Leichenbitter ausdrücklich fest, »über alles Erwarten ... der richtige Mann ... und weil wir nu ... ja, so ... ich denke eben daran: Kosman, so um Kasper, Melcher und Balzer herum, wo die Tage schon 'nen kleinen Hirtzensprung machen und die Nächte 'nen kürzeren Atem bekommen, da bin ich dem Malthus selig begegnet. Er sah zum Gotterbarmen aus, so hatte der Mensch sich verändert. Wir verstanden uns schon lange nicht mehr und waren offenbare Gegner geworden, denn er war immer der unsinnigen Meinung, ich hätte ihm das Genick brechen wollen, obgleich ich für meine Person mich in vollster Unschuld befinde. Malthus hingegen ... Indessen jedoch, er kloppte mir auf die Schulter, ganz honett und freundlich, und sagte: Wenn's so weit mit mir ist und der gefirnißte Deckel mit's silberne Kreuz mir näher ist als's Plafond, dann soll die Solopartie, worunter ich meine Kollegen Cornelis, Dores und Pitt verstehe, nach alter Sitte, Herkommen und Brauch, wie das die vornehmen Leute so in der Gewohnheit besitzen ... Na, Ihr begreift mich schon, Kosman. Es ist nur von wegen dem Oldenkott Rippchentabak und den Kalkpfeifen. Selbstverständlich – prima Qualität. Auch die Fidibusbecher müssen parat sein, die mit den goldenen Rändchen. Alles auf's nobelste. Bestellt es an Kosman!«
Der Obergesell nickte wie aus einem dumpfen Brüten heraus.
»Dann bestimme ich hiermit ...« und Jan van den Birgel hob den Sponton in die Höhe.
»Ich weiß, ich weiß!« fiel Kosman dazwischen. »Die Sache ist rund wie'n Mühlstein. Ich brauche nichts weiter. Alles meinem preußischen König, aber auch alles für den Bas. Was der ordiniert hat, das ist so heilig wie die ehelichen Bettposen. Jedem sein Recht. Dem wird Unterschrift und Siegel gegeben, selbst wenn ich's von einem Jan van den Birgel in Bestellung bekomme.«
»Schön so!« krähte der Alte in heller Genugtuung, ohne der bissigen Einschränkung auf die Spur gekommen zu sein. »Und jetzt noch 'ne Frage. Ist Simonis vorhanden?«
»Nein.«
»Und die Frau?«
»Ist da.«
»Wie lange schon?«
»'ne Stund' oder zwei.«
»Warum das – allein?«
»Ganz einfach,« sagte Kosman mit eingetrockneten Lippen und Augen, die wie Holzmulm phosphoreszierten, »sie pilgert von einem Sarge zum andern.«
»Was?!« schrie Jan van den Birgel. Bis ins Mark getroffen, mußte er sich an einem Mahltrichter halten.
»Simonis ist tot,« konstatierte Kosman mit einer Ruhe in der Stimme, die an den langsamen Gang einer Sterbeglocke erinnerte. »Und sie, was die Frau ist ... kaum, daß sie ihn unter der Erde hat, muß sie nu ihren Vater begraben.«
»Kosman, Ihr seid woll ...?!«
»Simonis ist tot,« klang es ihm mit der nämlichen unerschütterlichen Gelassenheit entgegen.
»Mensch!«
Jan van den Birgel war wie vor den Kopf geschlagen. Er konnte sich nicht mehr zurecht finden. Wie ein Blitzschlag aus heiterm Himmel war es ihm in die Glieder gefahren. Er sah Mücken, Kugeln, betrunkene Sterne. Die Welt schien ihm aus dem Senkblei gekommen. Alles um ihn taumelte, wankte. Nur einer nicht. Kosman Kraneboom kam nicht aus dem Lot, war der alte geblieben, zuversichtlich und bodenständig wie immer.
»Simonis, Simonis!« rief der Verstörte. »Ich verstehe immer Simonis!«
»Stimmt,« sagte Kosman.
»Herr Jeses!«
Jan van den Birgel suchte nach Worten. Erst fand er keine, schließlich fielen sie ihm brockenweise von den Lippen herunter: »Nicht möglich ... noch vor wenigen Tagen ... am verflossenen Freitag ... 'nen Brief von Simonis ... 'ne Bestellung an Lena ... 'n feines Präsent ... alles in Ordnung ... er selber gesund wie'n Spiegelkarpfen im Wasser, wie'n Apfel am Baum ... und nu ... Mensch, es kann nicht seine Richtigkeit haben!«
»Es bleibt dabei,« sagte Kosman, ohne mit der Wimper zu zucken. »Simonis ist tot, tot wie'n altes Laken in 'ner Kirschholzkommode. Reineweg aus. Nichts mehr zu machen. So – und nu geht man nach Hause. Eure Mission ist zu Ende. Hier habt Ihr nichts mehr zu suchen. Aber zum Kalviner –- zu dem geht Ihr nicht. Zu dem gehe ich. Noch heute, wenn Op gen Oort sich in seiner Abendruhe befindet. Das Weitere ist meine Sache. Und damit will ich mich empfohlen haben für heute. Da geht Euer Weg hin.«
Er hob feierlich die Hand. Sie wies auf die Einfahrt, wo der Westen noch mit seinen letzten verlorenen Lichtern spielte. Dann trat er wieder in den vollen Schein der Rübsenöllampe, stocherte den Docht hoch und fuhr mit erhobener Stimme in der Litanei für den Abgestorbenen fort, ohne sich weiter um den Leichenbitter und Simonis zu kümmern.
»Erlöse uns, o Herr, vor den Schrecken der Finsternis und den Gluten des ewigen Feuers! Herr, sei unsren Seelen barmherzig, auf daß wir teilhaftig werden der heiligen Gnade und der Anschauung Gottes! Herr, erbarme dich unser, Christe, erbarme dich unser!«
Sein Gebet war wie eine leuchtende Flamme. Sie drang durch die Wolken.
Jan van den Birgel stolperte ins Freie, verbaselt, zerrissen.
Über ihm lärmten die Elstervögel in den hohen Pappeln, wo sie zur guten Nacht bei ihren angefangenen Kugelnestern aufbäumen wollten.
Schrien sie nicht: »Simonis ist tot, Simonis ist tot?!«
Ja, das schrien sie, genau so, wie es Kosman Kraneboom getan hatte.
»Haltet die Mäuler!« lärmte Jan van den Birgel seinerseits zu ihnen hinauf.
Aber seine Stimme zerflatterte, verkroch sich, winselte am Boden.
Noch einen langen Blick warf er auf die Wassermühlen; dann umgriff er den Medaillenstab fester und trudelte über den Deich fort. Aber den letzten Gang, den er noch zu machen hatte, machte er nicht.
Er ging nicht zum Kalviner.
3
Bald nachher tat sich der Wind auf. Er kam von Wisselward und Emmerich her, zog schmeichelnd und allbelebend über die Niederung und legte sich mit breitem Odem über das weitverzweigte Bauerngehöft, das mit seinen Ställen, Brennereien, Scheunen und Wirtschaftsgebäulichkeiten, seinen Ackerländereien und Wiesen einen Teil der Hügellehne einnahm, die fast unvermittelt jenseits der großen Deiche aus der Ebene aufstieg.
Schon von weither fiel es ins Auge. In selbstgefälliger Eigenart, in dem blendenden Weiß seiner gekalkten Mauern und dem frischen Grün seiner Tore und Läden, schluckte es begierig das helle Sonnenlicht ein, um es nur widerwillig und zögernd wieder von sich zu geben, und legte sich der Mond um seine Giebel und Dächer, dann schien es so, als wäre Op gen Oort in einer unendlichen Reinheit und einem ewigen Frieden gebettet.
Seit undenklichen Zeiten war das stattliche Anwesen in der Familie Harkort geblieben, hatte sich folgerichtig und nach alter Satzung vom Vater immer auf den ältesten Sohn vererbt, bis es anders gekommen war.
Als der letzte Besitzer, Adam Harkort, unter den Landwirten, seines behäbigen und großspurigen Wesens halber, auch der ›Marquis‹ geheißen, mit dem Tode abging, sich schwerfällig hingestreckt und ein elendes Sterben gefunden hatte, sprang der Gutshof mit all seinen Gerechtsamen und Liegenschaften unter Übergehung der Erstgeburt auf die Frau des Erblassers über, und zwar aus folgenden Gründen.
Aus dumpfer Seelennot und einem heiligen Gelöbnis heraus, das er wie eine klirrende Kette mit sich herumschleppte, hatte der Alte seinen zweiten Sohn Hans zum Geistlichen bestimmt, und dieser, gleichfalls unter tiefer Qual und Bedrängnis stehend, besuchte bereits das Priesterseminar in Münster, als er sich gegen Vater, Gelöbnis und Satzung auflehnte, noch vor den großen Weihen die Soutane ablegte und nichts einheimste als das Pflichtteil und den Fluch seines Erzeugers.
Mit diesem Fluch auf den Lippen, hart wie ein Kiesel, selbst unerbittlich unter der letzten Wegzehrung, wurde der starkknochige Mann zu den Vätern versammelt. Fast gleichzeitig mit ihm sah sich der Erstgeborene zu den Freuden der himmlischen Tafel berufen. Ein grausames Geschick hatte ihn unversehens und wie mit blanker Sense in die Stoppeln geworfen.
Die Mutter blieb; allein seit jenen verhängnisvollen Tagen wühlte sich das Unglück in die fetten Ackerschollen hinein, hauchte den Pflug an, daß er verrostete, drängte sich mit breitem Rücken unter die Sparren, daß sie in allen Fugen und Gelenken ächzten und krachten, rief es die Maul- und Klauenseuche ins Haus, ließ es durch einen mächtigen Dammbruch die besten Wiesenparzellen versanden ... und das stolze Erbe wäre zweifellos zugrunde gegangen und unter den Hammer gekommen, hätte nicht Hans Harkort, allgemein der ›Kalviner‹ genannt, auf dringliches Zureden der Mutter mit energischer Faust, wenn auch wehen Sinnes, Op gen Dort über Wasser gehalten. Von seinen Schriften und Büchern fort, noch unter dem Fluche seines Vaters seufzend, eine große und heilige Sehnsucht im Herzen tragend, riß sich der ehemalige Seminarist ins Leben zurück und brachte die Speichen des gewaltigen und jetzt müden Rades aufs neue in Bewegung. Als Enterbter war nichts von dem Grund und Boden, auf dem er schaffte, sein eigen, und dennoch mühte er sich wie der letzte der ihm unterstellten Knechte. Was ihn belastete und ihm Furche bei Furche in die Schläfen hämmerte, schluckte er wie ein Starker, ein Sichwiedergefundener hinunter, glaubenskräftig und nur von dem Drange beseelt, die grauen Schatten, die das Haupt seiner Mutter umlagerten, weniger grau zu gestalten. Sein Wille regierte, und unter diesem Willen dampften die Schollen, zog der Pflug seine Gassen, senkte sich das goldene Korn aus dem Sämannstuch, füllten sich Scheunen und Ställe, tat der Gutshof einen langen und gesunden Atemzug und wurde wieder zu dem, was er gewesen war: der stolzeste Besitz in der Klever Gemarkung.
Darüber waren viele Jahre vergangen.
Der Wind war stärker geworden, die Dämmerung nahm zu, und die weite Umgebung florte sich ein.
Ein einsamer Mann stand um diese Zeit an einem Fenster des Herrenhauses und drückte die Stirn gegen die Scheiben, gleichsam um wachen Auges noch einmal Umschau über den großen Hof zu halten, auf dem das Leben allmählich einschlafen wollte. Nur vereinzelte Knechte und Mägde gingen vorüber oder verließen die Ställe, aus denen das Stampfen der Pferde, das sanfte Muhen der Kühe und das gedämpfte Klirren der Halfterketten herübertönte.
Es war Hans Harkort.
Er rückte und regte sich nicht; um so emsiger arbeitete seine geschäftige Seele. Soeben war er von den Feldern zurückgekehrt, körperlich abgemattet, mit heißem Gesicht, werkeltägig gekleidet und in Ledergamaschen, an denen noch der Kleiboden der feuchten Äcker klebte. Wer den jungen Menschen einmal gesehen hatte, vergaß ihn nie mehr im Leben. Wesen und Haltung imponierten. Er war ein Mann im Beginn der dreißiger Jahre, hochgewachsen, mit glattrasiertem, ausdrucksvollem Gesicht, wie aus Bronze gegossen, gedankenschweren, grüblerischen Augen und kurz geschorenem Haar, das an den Schläfen schon merklich ergraut schien.
Hans Harkort fuhr sich über die Augen. Draußen begann sich der Frühling zu regen. Er zupfte Himmelschlüssel, Lerchensporn und die jungen Ährenspitzen aus der erwachenden Erde. Die Tage waren wie Maientage und die warmen Nächte voller Sterne und Seligkeit. Aber in seinem eigenen Herzen wollte es noch immer nicht maien und lenzen. Von Zeit zu Zeit ging sein Blick nach den Wassermühlen hinüber, die wie schwarze Klumpen am Boden lagen und immer mehr eindunkelten. Dort waren die Sterbelaken auf die Dächer gefallen, war Trauer und Elend, zogen die Stunden wie unheimliche Mahner ihres Weges. Bei ihm, in seinem Inneren, war es nicht anders, da wohnte die Hoffnungslosigkeit, spannen trübe Gedanken ihre eintönigen Fäden. In dieser Öde mußte alle Freude trostlos versanden.
Der rote Sonnenball versank in der Niederung. Die Welt schlummerte ein. Auf dem Hof war es still und einsam geworden. Nur eine Schleiereule wankte wie ein Federspiel um die Dächer, um dann und wann ihren traurigen Ruf durch die Feier des Abends zu senden. Dazwischen rauschten die Bäume, die oberhalb der Schwarzen Koppel standen, mit Geisterstimmen herüber.
Hinter ihm klinkte die Tür auf.
Ein dralles Mädchen, im schlichten Waschkleid und ein schmuckes Häubchen auf den straffgescheitelten Haaren, brachte die Lampe, stellte sie auf den Tisch und wollte sich wieder entfernen.
»Wie spät schon, Johanna?«
»Es geht auf sieben, Herr Harkort.«
»Mutter noch immer nicht da?«
»Nein, Herr Harkort.«
»Wann ist sie ausgefahren, Johanna?«
»Gegen drei, kurz nach dem Kaffee.«
»Nach der Stadt?«
»Ja, nach der Stadt.«
»Und hat nichts hinterlassen?«
»Gar nichts, Herr Harkort.«
»Ich danke, Johanna.«
Auf lautlosen Lammfellsocken drückte sich das hübsche Mädchen aus dem erhellten Zimmer, die Tür behutsam hinter sich zuziehend, während der junge Mann sich in einen Sessel warf, den Kopf auf die Rechte stützte, seinen Gedanken nachhing und die Heimkehr der Mutter erwartete.