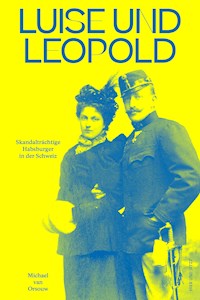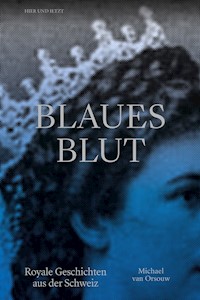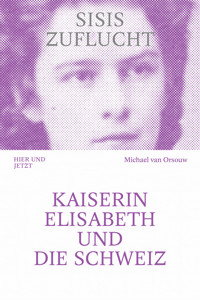
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaiserin Elisabeth von Österreich‐Ungarn (1837–1898) war zeitlebens eine europäische Prominenz, die interessierte und bis heute fasziniert. Zeitungsartikel, Zeitschriften, Filme, TV‐Serien und Bücher berichteten immer wieder über die rebellische Kaiserin und festigten das Bild der exzentrischen Regentin. Im multimedialen Gewitter kam der Bezug zur Schweiz stets zu kurz. Sisi gefiel hier die Ursprünglichkeit der Natur, kombiniert mit der Distanz zum kaiserlichen Hof. Sie vertraute dem Land mehr als dem grossen Kaiserreich ihres Gatten. Immer wieder weilte sie in Bern, Zürich, Lugano oder auf der Rigi – oftmals inkognito. Als sie Sorgen plagten, liess sie Klosterfrauen in Trachslau für sich beten. Dass sie in Genf auf tragische Weise einem Attentat zum Opfer fiel ist zwar bekannt, aber kaum, dass sie bei der dortigen Bank Rothschild ihr Privatvermögen angelegt hatte. Michael van Orsouw erzählt in knappen anschaulichen Kapiteln über die Bezüge der Kaiserin zur Schweiz und ergänzt damit ihre Lebensgeschichte dank neuer Quellen und Dokumente um unbekannte Aspekte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SISIS ZUFLUCHT
HIER UND JETZT Michael van Orsouw
KAISERIN ELISABETH UND DIE SCHWEIZ
INHALT
SCHLOSS UND SCHAUSPIEL
BILDER UND BESITZ
HOF UND HAND
TOD UND TRÄNEN
AUFFORDERUNG UND ANBETUNG
KUMMER UND KELCH
KRIEG UND KRIEGSPARTEIEN
WANDLUNG UND WUNDER
SCHÖNHEIT UND SCHWEIZERISCHES
MATHILDE UND «MÄDI»
SISI UND «SPATZ»
VENEDIG UND VORORT
KINDER UND KÜSSE
CHARME UND CHOLERA
REGEN UND RAUCHEN
SKANDALE UND SEUCHE
REISE UND RHEINFALL
GRAF UND GÖTTIN
KAISERIN UND KAISER
MÄNNERWELT UND «MARCELLO»
AUSFLÜGE UND ALPENCHIC
SCHWAGER UND SUIZID
VERMÖGEN UND VORSORGE
ATTENTATE UND ANARCHISMUS
GEMÄUER UND GEWITTERSTURM
GEDICHTE UND GESCHENK
SELBSTMORD UND STERBEN
HUNGER UND HOTEL
MARSCH UND MEISTERKOCH
SELFMADEMAN UND SENNENCHÄPPLI
MELANCHOLIE UND MITGEFÜHL
MARKETING UND MOLKE
BUNDESRAT UND BÄREN
DIENERTREPPE UND DECKNAME
STIPPVISITE UND SEEQUAI
ABSTECHER UND AVE MARIA
KUH UND KUNDIN
BRUNSWICK UND BERGTOUR
KONSTITUTION UND KONVERSATION
WEIN UND WILHELM
ABREISE UND AUDIENZ
ZAUNGÄSTE UND ZOBEL
VORAHNUNG UND VORZEICHEN
GRÄFIN UND GAFFER
TUNNEL UND TECHNIK
PARK UND PARADIES
SPAZIEREN UND SCHMERZ
STREICH UND STATUE
KÜNSTLER UND KUSS
EILSCHRITT UND EIS
BURG UND BELEUCHTUNG
TRAMZUG UND THONON
FRÖHLICHKEIT UND FRÜHSTÜCK
THRONFOLGER UND TUBERKULOSE
HUNGERÖDEM UND HANTELN
BEAU RIVAGE UND BAHNHOFBUFFET
SCHWESTER UND SCHICKSALSSCHLÄGE
FRIEREN UND FLANIERQUAI
SCHONUNG UND STREIFZÜGE
PORTRÄTS UND PONYS
FOTO UND FÄCHER
NIZZA UND NARZISSEN
GRANDHOTEL UND GEMSBOCK
SALINEN UND SONNENSTRAHLEN
ANHÖHE UND ANARCHIST
SPUK UND SPIRITISMUS
GOLDSCHIMMER UND GEFAHREN
ALBERT UND ADOLPH
PRIVATMUSEUM UND PROVOKATIONEN
GESPRÄCH UND GÄSTEBUCH
STROMAUSFALL UND SCHLAFLOSIGKEIT
ADELINA UND AUTOMAT
SCHÖNBRUNN UND SEELE
EILE UND ERMORDUNG
SCHLAGADER UND SAKRAMENT
TELEGRAMME UND TODESNACHRICHT
«KOLLEKTIVMÖRDER» UND KRITIK
UNTAT UND UNGEHEUER
BRUST UND BLUT
TALARE UND TOTENSTILLE
HABSBURG UND HALBMAST
DRUCK UND DROHUNG
IRRITATIONEN UND INTERPOL
DUMMHEIT UND DENKMAL
BESCHIMPFUNG UND BELEIDIGUNG
SCHÄDELDECKE UND SCHAUOBJEKT
GEHEIMNISSE UND GEDENKEN
SAMMLUNG UND STIFTUNG
SISI UND SISSI
SISI UND DIE SCHWEIZ – EINE CHRONIK
QUELLEN UND LITERATUR
BILDNACHWEIS
ORTSREGISTER
PERSONENREGISTER
DANK UND AUTOR
Die Kaiserin besucht die Habsburg: die Theatertour mit Tatjana Sebben als Sisi.
SCHLOSS UND SCHAUSPIEL
HABSBURG 2023 – Leicht gelangweilt lehnt sich die junge Frau an den Pfosten, auf dessen Spitze eine stilisierte Krone thront. Der Blick geht weit ins Tal, obwohl ein roter Baukran die Aussicht teilweise verdeckt, ein Kleinflugzeug röhrt über die Köpfe hinweg. Eine Hörstation zur alten Burg läuft weiter, sodass die Frau und ihre Gefolgschaft warten müssen.
Endlich geht die Tonschlaufe zu Ende. Augenblicklich streckt die junge Frau den Rücken durch, die Langeweile weicht einer Haltung voller Spannung, ihr wacher Blick richtet sich auf die Leute vor ihr – innert Sekunden wird die Frau zur Sisi, der Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn.
Die Schauspielerin erzählt in gepflegtem Bühnendeutsch von den Erinnerungen der Kaiserin an das Schloss Habsburg. Sie ruft ins Gedächtnis, wie ihre Tante Sophie jeweils die Bedeutung des Schlosses Habsburg für die Familie betont habe. Diese Habsburg im Aargau, zwischen Schinznach und Windisch, zwischen Lupfig und Villnachern. Die heutigen Überreste – karge Steine und eine unwirtliche Festung – lassen nicht erahnen, dass genau diese einstige Burg der eigentliche Stammsitz der Habsburger Monarchie war. Dass hier die Keimzelle der Weltmonarchie der Habsburg liegt, die so umfassend war, dass im Reich die Sonne nie unterging. Dass hier alles seinen Anfang nahm.
Es ist Sonntag, 13.05 Uhr, Ende Mai, und wir befinden uns auf einer szenischen Tour im Schloss Habsburg, die Bise durchwirbelt welke Blätter in den nahen Wäldern, die Schweizer Fahne auf dem Schlossdach flattert im Wind. Die Gefolgschaft Sisis sind diesmal keine Hofdamen oder kaiserliche Gäste wie früher, sondern es sind Touristen und Interessierte von heute, die sich Sisis Erzählungen anhören wollen. Respektive diejenigen der Schauspielerin.
Diese heisst Tatjana Sebben und gestikuliert beim Sprechen als Sisi lebhaft, die schwarzen Fingernägel scheinen durch die Luft zu fliegen. Sie steigt über Ruinenwände und liegengebliebene Steine hinweg und führt die Gruppe vor das Schloss, dann auch hinein. Sie erzählt vor und zwischen dicken Bruchsteinmauern von Sisis unglücklichem Leben als Kaiserin, als Mutter, als Gattin. Zwar sind die Geschichten längst vergangen, doch durch die Theatertour und die gekonnt dargestellten Emotionen haucht ihnen die Schauspielerin wieder Leben ein.
Zufällig vorbeikommende Passantinnen und Passanten drehen sich staunend nach der Darstellerin um, die ein historisches Kostüm, einen schwarzen Wollschal, ein kleines Täschchen und ein keckes Hütchen trägt. Die gespielte Sisi berichtet, dass sie – obwohl selbst Kaiserin! – die Republik als Staatsform besser fände als die Monarchie. Heute sagt sich das so leicht; doch damals war das eine Aussage mit kaum mehr nachvollziehbarer Sprengkraft. Schliesslich erwähnt sie ihr Verhältnis zur Schweiz: Das Land gefalle ihr, obwohl es gar viele Anarchisten gäbe, sie sei nämlich auf der Durchreise an den Genfersee.
Doch, Moment mal! Die hübsche Geschichte hat einen entscheidenden Fehler. Denn Sisi, wie Kaiserin Elisabeth genannt wurde, war gar nie auf der Habsburg. Die echte Sisi, die weiss Gott viel gereist ist, hat das Schloss nicht einmal betreten. Doch weil sie die bekannteste Habsburgerin aller Zeiten ist, darf sie in der szenischen Führung auf Schloss Habsburg nicht fehlen.
Diese an sich gelungene Theaterinszenierung führt etwas in die Irre, gerade wenn man sich mit Sisi und ihrer Beziehung zur Schweiz tiefergehend befasst. Denn die Kaiserin war der Schweiz nicht nur in Gedanken verbunden, sie kannte viele Schweizer Orte viel besser als lediglich vom Hörensagen. Sie war unzählige Male in der Schweiz, und sie verband mit dem Land deutlich mehr, als allgemein bekannt ist. Davon berichtet dieses Buch.
Die «Ruine Habsburg» als malerisches Sujet: Sie hing als Ölbild auch bei Sisi in Wien.
BILDER UND BESITZ
HABSBURG 1854 – Sprechen wir also von der echten Sisi, der geborenen Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern. Acht Edelpferde der Rasse Lipizzaner ziehen den Prunkwagen, in dem die 16-jährige Frau 1854 zur Hofburg in Wien fährt, um den österreichischen Kaiser Franz Joseph zu heiraten. Er ist der begehrteste Junggeselle Europas und hat sich in die sehr junge, sehr lebendige Elisabeth verliebt, die von ihrer Familie «Sisi» genannt wird. Sie ist in München aufgewachsen, hat einen unbändigen Bewegungsdrang und war häufig auf dem Sommersitz der Familie am Starnberger See, wo es von der Landschaft her ein bisschen wie in den Schweizer Voralpen aussieht.
Während andere 16-Jährige zur Schule gehen, ein Handwerk erlernen, in einer Küche arbeiten oder auf einem Bauernhof, muss die jugendliche Frau eine Kaiserin werden. Auch das will gelernt sein. Denn die Wiener Hofburg, wo sie nach der Hochzeit wohnt, strotzt nur so von strengen Hofregeln; die junge Sisi fühlt sich dementsprechend eingesperrt. So ist anzunehmen, dass sie, wenn sie sich als junge Kaiserin nicht frei bewegen kann, wenigstens die vielen Gemächer der Hofburg erkundet. Bekanntlich weist dieser Palast eine Fläche von 24 Hektaren auf – das entspricht 10 Fussballfeldern!
Bei solchen Rundgängen in der Wiener Hofburg stösst Sisi auf diverse Erinnerungsstücke, die direkt mit der Schweiz zu tun haben. So heisst einer der Zugänge zur kaiserlichen Hofburg «Schweizerhof»; ein Gebäudeflügel dieses Stadtschlosses trägt den Namen «Schweizertrakt»; der rot-weisse Eingang ist das «Schweizertor», er befindet sich gleich neben dem «Schweizerhofbrunnen». Diese Häufung von Bezeichnungen mit Schweizer Bezug erstaunt; sie geht auf eine schlagkräftige Truppe Schweizer Söldner zurück, die im fernen 18. Jahrhundert, zur Zeit von Franz I. Stephan und Maria Theresia, die Torwache stellten.
Auf ihren Streifzügen durch die Hofburg sieht Sisi in den Gängen auch die Ölbilder und Lithografien, welche die Ruine Habsburg im Aargau zeigen. Eines dieser Bilder stammt vom Schweizer Kunstmaler Jakob Josef Zelger aus Luzern, es heisst simpel «Die Ruine Habsburg», ein idealisiertes Gemälde. Dazu muss man wissen: Dieser Zelger hatte ein Faible für Prominente seiner Zeit; er war mit dem Komponisten Richard Wagner befreundet, und er traf 1868 Queen Victoria, die bei ihm gleich sechs Bilder bestellte – Weihnachtsgeschenke für die königliche Familie. Eines gefiel der Königin, die selbst durchaus gekonnt malte, allerdings nicht, sie liess es von London nach Luzern zurücksenden, weil es «zu bewölkt» sei und man den schönen Schweizer Sommerhimmel nicht sehen könne. Prompt setzte sich Zelger nochmals ans Bild und zauberte statt der Wolken luftigen Sonnenschein hin. Der Kunde war bei Zelger eben König respektive Königin oder Kaiserin.
Zelger ist übrigens nicht der einzige Schweizer, der Bilder der Habsburg in Sisis neuen Wohnsitz liefern durfte. Der Zürcher Künstler Johann Caspar Rahn malte 1814 das Ölbild «Umgebung der Ruine Habsburg», immerhin 54 mal 77 Zentimeter gross, das den Blick von der Habsburg ins Mittelland lenkt. Insgesamt sind sechs Ölbilder von Rahn in kaiserlichem Besitz. Ein weiteres heisst «Ruine Habsburg», es zeigt die Ruine in voller Grösse, mit Kühen, Schafen und einem Bauernpaar, ein perfektes Idyll. Das wird Sisi gefallen haben, die sich in solch ländlichen Gegenden wohl fühlte, weil sie so aufgewachsen war. Aufgrund der Bilder in der Hofburg wird deutlich, dass Sisi die Habsburg im Aargau gekannt haben muss, bevor sie in der Schweiz gewesen ist.
Mit 16 Jahren verheiratet: Aus Elisabeth in Bayern wird Kaiserin Elisabeth.
HOF UND HAND
WIEN 1857 – Mit der Schweiz hat die junge Kaiserin bald nach der Heirat zu tun, tiefgreifend und emotional. Denn als sich Elisabeth in tiefer, seelischer Not befindet und in einem depressionsähnlichen Zustand darniederliegt, wendet sie sich mit ihren unüberwindbaren Sorgen an eine kleine Einrichtung in der Schweiz – obwohl es unzählige vergleichbare Institutionen auch im grossen Habsburgerreich gäbe.
Dazu müssen wir etwas ausholen: Elisabeth mag zwar ihren Gatten Kaiser Franz Joseph, über den sie sagt: «Ich hab ihn ja sehr lieb. Wenn er nur ein Schneider wäre!» Aber das Leben an der Seite des Kaisers einer europäischen Grossmacht ist für sie, etwas überspitzt formuliert, ein Alptraum. Später dichtet sie selbst darüber:
«Ich bin erwacht in einem Kerker,
und Fesseln sind an meiner Hand.
Und meine Sehnsucht immer stärker –
Und Freiheit! Du, mir abgewandt!»
Der junge Kaiser ist mit Staatsangelegenheiten mehr als ausgelastet, er eilt von einem politischen Flächenbrand zum nächsten und macht dabei nicht die beste Figur. Seine harte Hand bekommen viele Untertanen zu spüren, sodass er den wenig schmeichelhaften Beinamen «Blutkaiser» bekommt. Die junge Elisabeth, die ihrem Mann nicht beistehen kann, weil er sie nicht an seinem Regierungsalltag teilhaben lässt, vereinsamt in der Wiener Hofburg. Dazu kommt noch, dass ihre Schwiegermutter die höfische Erziehung nachholen will, die Sisi angeblich für ein kaiserliches Benehmen fehlt.
Diese unerbetene Nacherziehung ist für die junge Kaiserin ein Desaster. Der Hof straft das unbeholfene Mädchen mit Verachtung, sie kann die Erwartungen in keiner Weise erfüllen. Sie hasst es, zur Schau gestellt zu werden und unter ständiger Beobachtung zu stehen. Als sie bald zum ersten Mal schwanger wird, schickt ihre Schwiegermutter sie in den königlichen Garten, damit das Volk ihren gewölbten Bauch sehen kann. Sisi fühlt sich blossgestellt wie ein Zootier.
Aber schwanger zu sein, ist für eine Kaisergattin eben die vordringlichste Aufgabe: Royale Frauen sollen vor allem gesunde Erben zur Welt bringen. Mehr noch: einen Stammhalter gebären und damit den Fortbestand der Habsburger Monarchie sichern. Das erste Kind, das 1855 zur Welt kommt, ist dann aber kein Sohn, sondern eine Tochter. Sie bekommt den Namen Sophie Friederike von Österreich und wird benannt nach der Kaisermutter Sophie, Sisis Schwiegermutter.
Die Namensgebung stellt ein erstes Omen dar: Schwiegermutter Sophie kümmert sich mit grosser Hingabe um ihre gleichnamige Enkelin. Die Erziehung des Babys liegt komplett in der Hand der Schwiegermutter, sie organisiert und ordnet an, sie tröstet und spielt mit dem Säugling. Kaiserin Elisabeth sieht dagegen ihr Kind nur selten, als ob der kleinen Sophie der Kontakt zur Mutter schaden könnte.
Schon bald darauf folgt die zweite Schwangerschaft. Erneut hoffen der Kaiser und seine Entourage auf einen männlichen Nachfolger. Doch es ist 1856 wieder eine Tochter, sie bekommt den Namen Gisela Louise Marie von Österreich. Zwar ist die Kleine liebenswert und gesundheitlich robust, aber halt doch «nur» eine Tochter.
1857 soll Sisi ihren Gatten auf eine Dienstreise nach Ungarn begleiten, weil sie bei den ungarischen Untertanen mit ihrer jugendlichen Art und den paar Brocken Ungarisch, die sie spricht, auf grosse Sympathie stösst. Jetzt, da das Haus Habsburg in Ungarn politisch einen schweren Stand hat, will der Kaiser die gewinnende Art der Kaiserin sehr berechnend einsetzen. Die junge Elisabeth nutzt in dieser Situation die Gunst der Stunde, leistet sich einen seltenen Moment der Autonomie und besteht darauf, ihre zwei kleinen Töchter nach Ungarn mitzunehmen: die wenige Monate alte Gisela sowie die zweijährige Sophie. Die Schwiegermutter bringt zwar ihre Einwände vor, wird aber ausnahmsweise übergangen.
Sophie wurde nur gerade zwei Jahre alt: Ihr Tod stürzte Sisi in eine Krise.
TOD UND TRÄNEN
BUDAPEST 1857 – In Ungarns Hauptstadt Budapest erkranken beide kaiserlichen Töchter an Fieber und Durchfall. Der mitgereiste Hofarzt beruhigt die Mutter, schätzt aber den Zustand der Kinder falsch ein. Während sich die kleine Gisela schnell erholt, geht es Sophie jeden Tag schlechter. Das Schlimmstmögliche tritt ein: Sophie, zwei Jahre und drei Monate alt, hat sich mit tödlichen Typhusbakterien infiziert. Herbeigeholte Ärzte versuchen alles, um das Kind des Kaiserpaars am Leben zu erhalten. Allen Notmassnahmen, speziellen Behandlungsmethoden und eilig georderten Arzneien zum Trotz stirbt Sophie Friederike Dorothea Maria Josepha am 29. Mai 1857 in den Armen ihrer Mutter. Ein Alptraum für Elisabeth und Franz Joseph! Der Kaiser telegrafiert seinem Obersthofmeister in Wien, sichtlich geschockt: «Unsere Kleine ist ein Engel im Himmel. Nach langem Kampfe ist sie zuletzt ruhig um ½ 10 verschieden. Wir sind vernichtet.» Doch im letzten Satz des Telegramms zeigt der Kaiser bereits wieder Fassung und Demut, wie es seine Rolle verlangt: «Sisi ist voller Ergebung in den Willen des Herrn.»
Das mit der «Ergebung» scheint übertrieben. Denn Sisi fühlt sich untröstlich und hat grosse Schuldgefühle. Hätte sie ihre Tochter doch besser zuhause gelassen? Wäre die Tochter in der Obhut der Schwiegermutter noch am Leben? Sie macht dem Hofarzt, aber auch sich selbst, schwere Vorwürfe. Die Kaiserin steht neben sich, sie verkriecht sich in ihrem Zimmer, weint Tag und Nacht und lässt sich nicht beruhigen. Auch die mittlerweile genesene Gisela vermag ihr Gemüt nicht aufzuhellen.
Einzig der Kaiser darf zu Sisi, doch auch seine Zuwendung kann sie nicht trösten. Die vor wenigen Jahren so lebenslustige und unbeschwerte Elisabeth verändert sich in dieser Zeit. Sie schläft kaum oder nur schlecht, sodass ihre Augen wie dunkle Höhlen aussehen. Sie verliert jeglichen Appetit, isst kaum noch etwas und magert zusehends ab. Sie zieht sich zurück, geht kaum noch nach draussen, ihre Gesichtsfarbe wird fahl. Sie durchlebt, würde man heute wohl diagnostizieren, eine tiefe Depression.
Ihrer Schwägerin Margarethe schreibt sie wenige Tage nach dem Verlust ihrer Tochter: «Es ist ein recht entsetzliches Unglück, das den Kaiser und mich betroffen hat, so sein erstes Kind sterben zu sehen, ist ein Schmerz, der recht schwer und hart zu ertragen ist, und ich dachte nie, dass ich mich so unglücklich fühlen könnte wie jetzt. – […] Unsere Kleine freilich ist jetzt glücklich, und wird im Himmel gewiss für uns bethen, dass uns Gott Kraft giebt, dieses Unglück zu ertragen, und dies kann auch unser einziger Trost sein.»
Zurück in Wien, besucht Kaiserin Elisabeth fast täglich die Kapuzinergruft, wo die kleine Sophie beerdigt ist. Dabei vertraut sie nicht allein auf deren Gebet im Himmel, sondern wendet sich in dieser grenzenlos traurigen Situation an eine Schweizer Institution ihres Vertrauens: an das Kloster Einsiedeln im Kanton Schwyz und an das zugehörige Frauenkloster in der Au in Trachslau. Dies, obwohl es in der Habsburger Monarchie sehr viele Klöster gibt, denen sie sich auch hätte anvertrauen können. Das kleine Frauenkloster in der Au liegt im abgelegenen Alpthal zweieinhalb Kilometer hinter dem Kloster Einsiedeln, etwas ausserhalb des Dorfes und direkt am Waldrand. Ausgerechnet von dieser Abtei erhofft sich die Kaiserin spirituelle Unterstützung in ihrer schwierigen Lebenslage.
Er galt als Genie: Pater Athanasius Tschopp, der Klostermanager.
AUFFORDERUNG UND ANBETUNG
TRACHSLAU 1857 – Wie kommt die Kaiserin von Österreich dazu, ein Frauenkloster in der Schweizer Provinz um Unterstützung zu bitten? Einer von Sisis Hofkaplänen hat den Kontakt zu den Klöstern in Einsiedeln und Trachslau hergestellt: Er heisst Joseph Fessler und war zuvor für mehrere Wochen in Einsiedeln, dabei besuchte er auch das Frauenkloster in der Au. Dieser Hofkaplan hat der Kaiserin davon berichtet, dass die frommen Klosterfrauen in Trachslau seit 1846 die ewige Anbetung pflegen würden, also Tag und Nacht ihre Gebete sprechen. Dabei schlössen sie in ihre Andachten «Heilanliegen für Hohe u. Niedere» ein, wie es damals hiess. Man kann also in Trachslau für sich beten lassen. Genau das will die Kaiserin von Österreich in Anspruch nehmen.
Dazu muss man wissen: Die Einführung der ewigen Anbetung in der kleinen Abtei im Alpthal hat nicht nur dem kaiserlichen Hofkaplan und der Kaiserin Eindruck gemacht, sondern hat dem Kloster einen richtigen Aufschwung verliehen. Die Schwesternzahl verdoppelte sich innert weniger Jahre, sodass man sogar einen neuen Gebäudeflügel am Berghang erstellen musste.
Als der Antrag aus Wien kommt, doch bitte auch für die sorgenerfüllte Habsburger Kaiserin im fernen Wien zu beten, steht Philomena Marer von Olten dem Kloster in Trachslau vor – doch ist sie vom starken Wachstum ihres Ordens überfordert. Deshalb lässt sie sich von einem fähigen Beichtvater und Kaplan unterstützen, der als eine Art Klostermanager und Aussenminister fungiert. Seit kurzem hat diese Aufgabe der prominente Pater Athanasius Tschopp inne. Er «dachte an alles», wie es in einer Klosterschrift heisst, und gilt als «genialer Mann», weil er bereits in jungen Jahren physikalische Erfindungen gemacht hat. So entwirft Tschopp neue Muster für die Klosterweberei, gestaltet Zeichnungen und Vorlagen für die Stickerei, hilft beim kunstgewerblichen Fassen der Reliquien, erstellt neue Verzeichnisse des Besitzes und vor allem der Einkünfte des Klosters.
Man kann sich beim weltgewandten Athanasius Tschopp gut vorstellen, dass er es ist, der die Verbindung zum Kaiserhaus in Wien hochhält und die Bitte von Kaiserin Elisabeth äusserst zuvorkommend behandelt. Er wird die Bedeutung des kaiserlichen Betanliegens für das Kloster richtig eingeschätzt haben.
Gerade in der Zeit, als die damals 37 Schwestern des Frauenklosters für Kaiserin Elisabeth und ihre verstorbene Tochter Sophie beten, bittet Pater Athanasius den Abt vom Kloster Einsiedeln um eine «Visitation» nach Trachslau. Was wie ein gewöhnlicher Besuch tönt, entwickelt sich zu einem regelrechten Umsturz. Frau Mutter Philomena tritt plötzlich zurück, obwohl sie erst 46 Jahre alt ist. Rund ein Monat nach dem Besuch des Abtes wählen die Schwestern 1858 Schwester Henrika Clara Bohner zur neuen Vorsteherin. Diese ist erst 33-jährig und stammt aus Bohlingen (Baden).
Doch das Wichtigste bei diesem Wechsel ist: Die Klosterfrauen nehmen die Bedürftigkeit der Kaiserin von Österreich weiterhin ernst, schliessen sie und ihre Not in die ewige Anbetung mit ein, selbstverständlich unter Wahrung grösster Diskretion. Das Durchschnittsalter der Nonnen liegt zwischen 20 und 30 Jahren, während Sisi damals Anfang 20 ist – nur schon die altersbedingte Identifikation zwischen Klosterfrauen und Kaiserin dürfte also gegeben gewesen sein. Obwohl sich klosterintern doch so einiges verändert hat, bleibt die spirituelle Unterstützung für die prominente Kaiserin erhalten.
Das Geschenk aus Wien: Elisabeths Inschrift auf dem Fuss des Kelchs für Trachslau.
KUMMER UND KELCH
TRACHSLAU 1859 – Zwei Jahre lang schliessen die Trachslauer Klosterfrauen Kaiserin Elisabeth in die ewige Anbetung ein. Die Monarchin zeigt sich gegenüber der Schweizer Abtei überaus dankbar. Denn sie schenkt dem Frauenkloster in Trachslau am 21. September 1859 gleich zwei auserlesene Gegenstände.
Beim einen Präsent handelt es sich um einen wertvollen Messkelch aus Gold, der mit vielen handgefertigten Ornamenten versehen ist: Das zeugt von feinstem Kunsthandwerk ausgezeichneter Goldschmiede. Am Sockel trägt der Kelch die Inschrift: «Durch Mariens Fürbitte nehme uns der Herr in seinen Schutz. E. K. v. O. Elisabeth, Kais. v. Oesterreich.» Sisi will, dass der Kelch an Marienfesten zum Einsatz kommt. Darum wird der Kelch bis heute im Frauenkloster an der Au in Ehren gehalten. Man holt ihn für hohe Kirchenfeste hervor, beispielsweise an Ostern, Pfingsten oder eben an einem der Marientage, wie es die Kaiserin gewünscht hat.
Das zweite Geschenk der Kaiserin sind kostbare Reliquien, also knöcherne Überbleibsel von Heiligen, die kultisch verehrt werden. Diese liegen in einer silbernen Kapsel, welche wiederum in einem Stoffsäcklein aufbewahrt wird. Die Kapsel ist «von zierlicher Arbeit», das Säcklein wird als «goldgestickte Verwahrtasche von weissem Damast» beschrieben. Die Reliquien sollen von der heiligen Gottesmutter Maria persönlich und vom heiligen Franz abstammen. Eine beigelegte Urkunde, die sogenannte Authentik, soll dies beweisen. Auf dem Stofftäschchen sind in Goldlettern die kaiserlichen Vornamen Elisabeth und Franz Joseph eingestickt.
Im Kloster nimmt man mit gutem Grund an, dass es die Kaiserin höchstpersönlich gewesen ist, welche das Säcklein genäht und die Stickerei angefertigt hat. Die angeheftete Goldschnur beweise überdies, dass die Kaiserin das edle Reliquiarium mehr als einmal auf ihrer Brust getragen habe – eine höhere Ehre lässt sich kaum ausdenken!
Die Kaiserin wünscht dafür im Gegenzug, dass die Gebete im Frauenkloster sie und das Kaiserhaus weiterhin miteinbeziehen sollen. In der schriftlichen Geschenkbeilage heisst es in etwas gewundener Sprache: «Dieses kleine Geschenk mögen die frommen Schwestern als eine Bitte hinnehmen, in ihrem Gebete für Oesterreich u. sein Kaiserhaus nicht zu ermüden, da die Zeiten nun mehr die Kraft des Gebetes als ein höchst dringendes Bedürfniß für die Regenten u. ihre Völker erscheinen laßen.»
Die neue Klostermutter Henrika in Trachslau im Kanton Schwyz schreibt nach dem Erhalt der Geschenke an die Kaiserin von Österreich und bedankt sich überschwänglich für Kelche, Kapsel und Reliquien. Die Sätze wirken etwas umständlich, aber kommen von Herzen: «Das sind die werthvollen Gegenstände, die von so hoher Hand am genannten Tage uns zugekommen; u. Gefühle der Rührung, des Dankes, der Beschämung vor Gott u. der hohen Spenderin in uns hervorgerufen, für welche wir keine Worte finden, die aber dauernd in uns bleiben, ungeschwächt bis an die letzten unserer Nachfolgerinnen übergeben u. täglich in eifrigstes Bittgebet vor dem Allerheiligsten für Jhre Majestät, die Gottgeliebte Kaiserin, u. das erhabene Kaiserhaus von Oesterreich, sich ergießen sollen. Auch die Gottvertrauenden Jntentionen u. heiligen Wünsche Euer Majestät sind uns ausdrücklich dargelegt worden, u. sie sollen von diesem Tage an, als das theuerste Anliegen unsrer Herzen, auch heilig beachtet werden.»
Des Kaisers Mann in Zürich: Graf Franz de Paula von Colloredo-Waldsee.
KRIEG UND KRIEGSPARTEIEN
ZÜRICH 1859 – Kaiserin Elisabeth schreibt im September 1859, dass die «Kraft des Gebetes als ein höchst dringendes Bedürfniß für die Regenten u. ihre Völker» zu betrachten sei. Das klingt für heutige Ohren etwas allgemein, muss man aber aus der damaligen Zeit heraus verstehen. Sisi richtet den Fokus auf «die Regenten u. ihre Völker» und meint damit auch die habsburgische Weltgeschichte, welche zum gleichen Zeitpunkt in eine entscheidende Phase tritt: Im noblen Hotel Baur au Lac in Zürich verhandeln Vertreter von Österreich-Habsburg, Frankreich, Sardinien und aus dem Piemont über die Zukunft Italiens.
Sisi dürfte schlaflose Nächte verbracht haben, als ihr Ehemann sein Österreich einige Monate zuvor in die Schlacht von Solferino führte. Das blutige Gefecht mit rund 30 000 Kriegstoten und 50 000 Vermissten und Verletzten wühlte nicht nur die Kaiserin auf. Den Genfer Henry Dunant bewegten die Gräuel der Schlacht etwa zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes.
Doch jetzt, im Nachgang der blutigen Schlacht, geht es um Friedensverhandlungen. Während Wochen wird in Zürich verhandelt und gefeilscht. Die Unterhändler benützen eifrig den Telegraf im «Baur au Lac», um bei den Regierungszentralen in Wien, Paris und Turin neue Vorschläge zu unterbreiten oder den Verhandlungsspielraum auszuloten. Der Depeschendienst im Hotel ist sogar nachts besetzt und war einer der Gründe, warum das relativ junge Hotel des Hoteliers Johannes Baur den Zuschlag erhalten hat.
Sisi wird in Wien mitbekommen haben, dass die Verhandlungen in Zürich stocken. Festgalas im Hotel und auf dem Zürichsee-Dampfschiff sollen die angespannte Verhandlungssituation lockern, aber ohne Erfolg. Erst eine tragische Episode leitet den Durchbruch ein: Am 21. Oktober 1859 erleidet Graf Franz de Paula von Colloredo-Waldsee, der Leiter der österreichischen Delegation, einen Schlaganfall – die Härte der Verhandlungen haben dem knapp 60-jährigen Diplomaten offensichtlich zugesetzt. Trotz sofort herbeigerufener Ärzte ist keine Rettung mehr möglich, und der Chefunterhändler stirbt am 26. Oktober in Zürich. Danach geht es vergleichsweise schnell: Eine Einigung, bei der alle Parteien ihr Gesicht wahren können, kommt zustande. Bereits am 10. November unterzeichnen die Verhandlungspartner im Rathaus der Stadt den «Frieden von Zürich». Die Stadt Zürich gibt ein Diner und veranstaltet ein Fest auf dem See, trotz des winterlichen Nebels.
Sisis Ehemann muss beim «Frieden von Zürich» politisch einiges einstecken: Er verliert die Lombardei an Frankreich, worauf die Provinz in einem zweiten Abkommen an den italienischen König Viktor Emanuel II. zurückgegeben wird. Zudem einigen sich Österreich und Frankreich darauf, gemeinsam einen italienischen Staatenbund zu errichten, Venetien unabhängig zu machen und die mittelitalienischen Fürstentümer wiederherzustellen. Damit markiert der «Frieden von Zürich» den Beginn der italienischen Einheit – ein Ereignis, das vor allem in die italienischen Geschichtsbücher Eingang gefunden hat und weniger in jene der Schweiz.
Übrigens: Für Johannes Baur und seinen Sohn Theodor haben sich die Verhandlungen sehr gelohnt. Die Neue Zürcher Zeitung rechnet vor, dass die zehn Wochen Verhandlung den beiden Hoteliers rund 100 000 Franken einbrachten. Böse Zungen behaupten sogar, dass Baur der einzige Sieger der Verhandlungen sei. Sisi wiederum wird das erfolgreiche Hotel Baur au Lac bald selbst kennenlernen.
Hing fortan im Kloster Einsiedeln: das prachtvolle Gemälde der Kaiserin.
WANDLUNG UND WUNDER
EINSIEDELN 1860 – Zwei Monate nach dem «Frieden von Zürich» kommt Sisi in die Schweiz – als Sujet eines riesigen Ölbildes. Denn ihr Ehegatte, Kaiser Franz Joseph, lässt im Januar 1860 dem Männerkloster von Einsiedeln zwei Ganzkörperporträts zukommen: eines von seiner Frau und eines von sich. Gemalt hat beide der österreichische Künstler Anton Einsle, eine Koryphäe seines Fachs. Er war ab 1838 der Hofmaler des Kaiserhauses mit einem grossen Atelier in der Hofburg und porträtierte den Kaiser immer wieder, allein in den ersten beiden Regierungsjahren rund dreissig Mal.
Die dem Kloster vermachten Bilder von Sisi und ihrem Mann sind «zwölf Fuss hoch, trefflich gemalt und eingerahmt», heisst es in den Zeitungen. Zwölf Fuss, das macht immerhin eine Höhe von 3,5 Metern! Elisabeth und Franz Joseph sind also überlebensgross dargestellt. Zu dieser Zeit fährt noch keine Eisenbahn nach Einsiedeln. Wenigstens ist die Strasse von Biberbrugg ausgebaut, dennoch scheint es ein aufwendiges Unterfangen, solch grossformatige Bilder im Jahr 1860 von Wien nach Einsiedeln zu transportieren. Aber den Kaiser kümmern solche Details nicht sonderlich.
Interessant ist, wie Hofmaler Einsle die Kaiserin für das Schweizer Kloster gemalt hat: Er stellt Elisabeth als vornehme Magistratin dar, sie trägt ein bodenlanges, spitzenbesetztes Kleid in irisierendem Hellblau sowie Perlenschmuck um den Hals und am linken Handgelenk. Ihr Haar ist kunstvoll drapiert mit eingeflochtenen Blumen, ihr Gesicht anmutig. Sie ist damals gerade mal 23 Jahre jung. Den Kaiser inszeniert der Künstler dagegen als strammen Feldherrn. Franz Joseph trägt Uniform und Säbel, er hat einen entschlossenen Blick, und im Hintergrund erkennt man ein Heerlager.
Mit den Ölbildern bedankt sich der Kaiser beim Kloster Einsiedeln für die Treue zum Hause Habsburg. Wahrscheinlich bringen die Geschenke auch die Dankbarkeit für den geistigen Beistand zugunsten von Kaiserin Elisabeth zum Ausdruck. Schliesslich hatte das Kloster Einsiedeln vermittelnd mitgewirkt und indirekt die Verbindung zum Frauenkloster in der Au in Trachslau hergestellt.
Zudem dürfte noch ein anderer Aspekt in die Gaben hineinspielen. Denn zuvor, während des italienischen Kriegs mit der Entscheidungsschlacht von Solferino, hat der französische Kaiser Napoleon III. dem Abt und Konvent von Einsiedeln ebenfalls ein Porträt von sich und eines seiner Ehefrau, Kaiserin Eugénie, geschenkt. Das konnte der österreichische Kaiser nicht ungeschehen machen, aber er wollte es mit seinen Geschenken wohl zumindest egalisieren. Deshalb ist es bedeutsam, dass die Bilder von Elisabeth und Franz Joseph ebenfalls im Fürstensaal des Klosters ihren Platz finden (und bis 1966 dort hängen bleiben).
Als die Porträts nach Einsiedeln gelangen, geschieht mit Sisi etwas Entscheidendes: Aufgrund anhaltenden Unwohlseins reist sie 1860 nach Madeira zur Kur – und kehrt nach fünf Monaten wie verwandelt zurück. So berichten es verschiedene Beobachter übereinstimmend. Aus der schüchternen Sisi ist eine selbstbewusst auftretende Monarchin geworden, sie wird jetzt von vielen als schönste Frau Europas bezeichnet. Betritt sie einen Raum, soll sie die Umgebung mit ihrer neu gewonnenen Ausstrahlung augenblicklich in ihren Bann ziehen.
So schreibt etwa der amerikanische Gesandte in Wien, Sisi sei «ein Wunder der Schönheit – hoch und schlank, wunderschön geformt, mit einer Fülle von hellbraunem Haar, einer niederen griechischen Stirn, sanften Augen, sehr roten Lippen mit süssem Lächeln, einer leisen wohlklingenden Stimme und teil schüchternem, teil sehr graziösem Benehmen».
Vieles von Sisi hat den Weg in die Schweiz gefunden: ihre Sorgen und Nöte während der Lebenskrise, ihre teilweise handgefertigten Geschenke, der Friedensplan ihres Ehegatten und ihr überlebensgrosses Porträtbild. Umgekehrt sind verschiedene Abbildungen der Aargauer Habsburg sowie diverse Schweizer Namensgeber in Wien präsent. Nur selbst ist die Kaiserin noch nie in der Schweiz gewesen. Das wird sich bald ändern.
«Schweizer Bluse» und «Berner Gürtel»: Beides trug Sisi 1864 in Wien.
SCHÖNHEIT UND SCHWEIZERISCHES
WIEN 1864 – Bevor Sisi erstmals in die Schweiz reist, lässt sie sich 1864 in Wien auf besondere Weise inszenieren. Die frisch erstarkte Kaiserin begibt sich ins noble Photostudio von Ludwig Angerer an der Wiener Theresianumgasse, um für eine ganze Bilderserie Modell zu stehen. Angerer, der erste Hoffotograf der Habsburger, fertigt kunstvolle Aufnahmen der Kaiserin an: Elisabeth ist mit einem Hund zu sehen, der auf einem Tischchen mit barock geschwungenen Beinen sitzt. Oder vor einem Stuhl mit gestreiftem Sitzpolster und gedrechselter Rückenlehne. Oder vor einem Tisch mit Intarsien auf der Seite. Dazu blickt sie selbstbewusst und ohne zu lächeln zum Hund, knapp an der Kamera vorbei.
Doch das wirklich Bemerkenswerte an dieser Fotoserie ist die schweizerische Färbung des kaiserlichen Outfits. Elisabeth von Österreich trägt, so die offizielle Beschreibung, «Schweizer Bluse, Berner Gürtel und schwarzen Rock». Um sich in der Öffentlichkeit vorteilhaft zu präsentieren, zeigt sich die sehr wirkungsbewusste Kaiserin also in einer Garderobe mit weitgehend Schweizer Herkunft.
Über den «schwarzen Rock» mit seinen schräg fallenden Mustern muss man kaum ein Wort verlieren, ausser dass solch imposant ausladende Röcke damals in adeligen Kreisen weit verbreitet waren. Spezifischer wird es bei den charakteristisch schweizerischen Kleidungsstücken, der Bluse und dem Gürtel, die Sisi für die Fotostrecke ausgewählt hat. Die «Schweizer Bluse» muss nicht unbedingt aus einer Schweizer Schneiderei stammen, aber folgt dem hiesigen Stil. Insbesondere die voluminösen Ärmel erinnern klar an die Schnitte von Schweizer Trachtenblusen; dass diese vor allem im Bereich der Oberarme sehr weit gehalten sind, wirkt für die damalige städtische Mode ungewohnt, kommt aber bei Trachten in ländlichen Gebieten vor. Ebenso den Trachten nachempfunden, scheint die Zweifarbigkeit. Typisch für die Garderobe einer Adligen ist nämlich zu dieser Zeit, dass Rock und Oberteil aus dem gleichen farbigen Stoff gestaltet sind, um miteinander als Ensemble zu wirken. Die dunklen Bänder, die lose auf Sisis Bluse geheftet sind, durchbrechen das Weiss auf effektvolle, dekorative Weise.
Damit kommen wir zum «Berner Gürtel», dem optischen Mittelpunkt der kaiserlichen Kleidung. Dies ist kein gewöhnlicher Gürtel, sondern ein schmales, leicht versteiftes Mieder, das gut sichtbar über der Kleidung festgemacht wird. Es verbindet dank seiner Breite das Ober- und das Unterteil. Den Namen «Berner Gürtel» dürfte dieses Kleidungsteil von der Spitze an der unteren Kante haben, welche auch der Berner Tracht eigen ist. Im angelsächsischen Raum bürgern sich für dieses Kleidungsaccessoire die Begriffe «swiss waist», «swiss belt» oder «swiss waist belts» ein. Es soll in den 1860er-Jahren bei Royals ebenso grosse Verbreitung gefunden haben wie bei bürgerlichen Frauen.
Aber warum diese Popularität für den «Berner Gürtel»? Annette Kniep, die Kuratorin für historische Kostüme beim Bernischen Historischen Museum, sieht einen möglichen Zusammenhang mit dem aufkommenden Tourismus und der gleichzeitigen Nationalstaatenbildung, «also die Förderung der Tracht im Rahmen einer schweizerischen Identitätsbildung und ihre verstärkte, internationale Wahrnehmung durch politische Berichterstattung, Tourismus und Druckgrafik».
Hinzu kommt, dass die Fotos von Sisi in den Schweizer Kleidungsstücken geradezu ikonischen Charakter erhalten und grossen Absatz finden. Das zeigt, dass diese Bilder nicht nur für private Zwecke hergestellt werden, sondern als Inszenierungen für die breite Öffentlichkeit.
Brachte in Zürich ihre Tochter zur Welt: Sisis Schwester Mathilde.
MATHILDE UND «MÄDI»
ZÜRICH 1867 – Am Mittwoch, dem 23. Januar 1867, ist es endlich so weit: Kaiserin Elisabeth betritt zum ersten Mal Schweizer Boden. Zum Leidwesen der Schweiz wird dieser erhabene Moment aber nicht mit der gebotenen Feierlichkeit begangen. Sisi fährt lediglich mit dem Dampfschiff von Lindau über den Bodensee nach Romanshorn, wo sie in die Eisenbahn umsteigt – mehr hat der Grenzübertritt in den Akten nicht hinterlassen. Sie reist wiederum «im strengsten Incognito», wie die Neue Zürcher Zeitung weiss, unter ihrem gebräuchlichen Decknamen «Gräfin von Hohenembs».
Dieser Reisetag ist auch ohne Brimborium beim Überqueren der Landesgrenze voller Aufregung für die Familie der Kaiserin, sodass Elisabeth von ihrer Ankunft in der Schweiz vielleicht gar nicht so viel mitbekommt. Denn Sisi kommt aus München angereist, wo genau an diesem Tag König Ludwig II. von Bayern seine Verlobung mit Sisis Schwester, Sophie Charlotte in Bayern, bekannt gegeben hat. Das wird Elisabeth sicher erfreut haben, weil sie Ludwig, ihren Cousin, ebenso gut leiden mag wie ihre jüngste Schwester. Beide sind, genau wie die Kaiserin, Fans der Musik von Richard Wagner: Siegfried, so telegrafierte der Bayernkönig passenderweise seiner Verlobten, habe endlich seine Brünhilde gefunden!
Zudem ist Sophies Familie zwar adelig und Teil des Hochadelsgeschlechts der Wittelsbacher, aber nur vom unbedeutenden Zweig der «in Bayern», der Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen. Dass eine Frau dieses mittelmässigen Familienastes durch Heirat nun zur Königin von Bayern werden soll, ist eine grosse Anerkennung und Ehre für Sisis Familie. (Zur Hochzeit, die ursprünglich auf den 15. Mai 1867 angesetzt wurde, kam es am Ende nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Sisi reist an diesem Tag in die Schweiz, weil sie eine andere Schwester besuchen will, nämlich Mathilde, in der Familie «Spatz» genannt. Diese hat 1861 Luigi Graf von Trani geheiratet, den Prinzen von Bourbon-Sizilien, Sohn des Königs beider Sizilien und Halbbruder des Ex-Königs Franz II. von Neapel. Zuweilen verwirren solche adeligen Zuordnungen mehr, als sie helfen, aber in diesem Fall zeigen sie: Auch Mathilde hat eine sehr gute Partie gemacht, wie man so schön zu sagen pflegte.
«Spatz», also Mathilde, hat am 16. Januar, 13.45 Uhr, und rund eine Woche vor Sisis Anreise, ihr erstes (und einziges) Kind in Zürich zur Welt gebracht: Eine Tochter, die den Namen Maria Theresia Magdalena bekam. Sie wurde nach ihrer Grossmutter und Mathildes Schwiegermutter benannt, in der Familie nennt man das Mädchen in Abgrenzung zu den gleichnamigen Frauen fortan «Mädi».