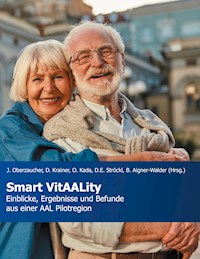
Smart VitAALity E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet das Konzept, die Methoden, die Analysen und die Ergebnisse der Evaluierung der Kärntner Pilotregion für AAL-Technologien Smart VitAALity. Das Forschungsprojekt und die entsprechende Pilotregion wurde im Rahmen des Programmes "benefit" der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG mit Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie aus Eigenbeiträgen der Konsortialpartner finanziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgeber*innen
Johannes Oberzaucher
Daniela Krainer
Olivia Kada
Daniela Elisabeth Ströckl
Birgit Aigner-Walder
Fachhochschule Kärnten, Österreich
Dieser Band beinhaltet das Konzept, die Methoden, die Analysen und die Ergebnisse der Evaluierung der Kärntner Pilotregion für AAL-Technologien Smart VitAALity.
Das Forschungsprojekt und die entsprechende Pilotregion wurde im Rahmen des Programmes „benefit“ der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG mit Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie aus Eigenbeiträgen der Konsortialpartner finanziert.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Danksagung
Über die Autor*innen
Definitionen und Abkürzungen
Abschnitt 1 - Einblicke in die Pilotregion Smart VitAALity
1 Allgemeine Zielsetzung des Evaluierungsberichts
2 Genereller Hintergrund und Ausgangslage
3 Smart VitAALity – Überblick über das technologische System
4 Generelles Testsetting und abgeleitete Relevanz für Smart VitAALity
5 Evaluierungsdesign im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity
6 Stichprobenbildung, Strategie und Umsetzung
Abschnitt 2 - Ergebnisse und Befunde der Smart VitAALity Evaluierung
7 Nutzung von Smart VitAALity im Alltag
8 Akzeptanz und Alltagsintegration von Smart VitAALity
9 Wirkungen von Smart VitAALity auf die subjektive Lebensqualität älterer Menschen
10 Ergebnisse der sozioökonomischen Potenzialanalyse
Abschnitt 3 - Ergänzende Reflexionen
11 Ergänzende Evaluierung und Reflexion der eingesetzten Technologie
12 Ergänzende Einblicke in die Sicherheitskonzepte der Smart VitAALity Lösung
Abschnitt 4– Resümee und Ausblick für Smart VitAALity
13 Smart VitAALity auf dem Weg zum Markt
14 Resümee zum Smart VitAALity System
15 Evaluierung von Smart VitAALity - Schlussfolgerungen und Potenzial
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorwort
Mit der demografischen Entwicklung als Hintergrund werden unsere alternde Gesellschaft und damit einhergehende Herausforderungen aktuell stärker denn je sichtbar. Die Zunahme chronischer Erkrankungen und damit einhergehende Autonomieverluste stellen eine besondere Herausforderung dar. Um sich diesen Herausforderungen erfolgreich stellen zu können, werden Anwendungen und Services, die auf den langfristigen Erhalt der Lebensqualität abzielen, als essenziell gesehen. Als innovative Lösungsstrategie sind in diesem Zusammenhang Services im Bereich Smart Home, Smart Service und weiterführend einer Smart City Infrastruktur im Bereich „Health, Inclusion und Assisted Living“ zu sehen. Vielfach kann die Entwicklung des AAL-Marktes den gestellten Erwartungen nicht standhalten. Warum sich diese trotz vorhandenen Nachfragepotenzials und innovativen Produktansätzen am Markt nicht nachhaltig durchsetzen können, wird auf die unzureichende Berücksichtigung gegenwärtiger Marktentwicklungsbarrieren bei der Gestaltung ihrer Geschäftsmodelle zurückgeführt. In diesem Zusammenhang fördert die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG Pilot- bzw. Testregionen in denen aktuell in rund 600 österreichischen Haushalten und Wohneinheiten innovative AAL-Lösungen installiert, im Alltagseinsatz erprobt und wissenschaftlich evaluiert werden bzw. wurden. Im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity wurde auf Basis eines bedarfs- und theoriebasierten Zugangs, im partizipativen Prozess gemeinsam mit späteren potenziellen Benutzer*innengruppen und Stakholder*innen ein technologisches System und integrierte Services entwickelt und versucht zu klären, wie die Wirksamkeit auf Kerndimensionen der empirisch messbaren Lebensqualität (Wohlbefinden, Gesundheit, Soziale Partizipation ) ausgestaltet ist und ob definierte Determinanten der Lebensqualität beeinflusst werden können. Wirksamkeitsbeeinflussende Faktoren wie Akzeptanz und Nutzungsverhalten haben die Evaluationsdomänen erweitert. Im Sinne einer nachhaltigen Verwertung wurde eine sozioökonomische Potenzialanalyse realisiert und die Ergebnisse in eine Nachhaltigkeitsstrategie übergeführt. Ziel war und ist dabei immer gewesen, die wissenschaftlichen Befunde als Basis für eine langfristige Entwicklung und Verankerung der Smart VitAALity Lösung zu verwenden. Dies war die Basis für eine – im Sammelband auch dargelegte – erfolgreiche Produktumsetzung aus dem Forschungssetting heraus und damit auch der erste Schritt hin zu einer nachhaltigen Marktpräsenz und -entwicklung.
Danksagung
Das Smart VitAALity Projektteam möchte sich im Besonderen bei den Co-Forscher*innen – den Senior*innen – bedanken, die uns im Rahmen des partizipativen Entwicklungsprozesses begleitet haben, als auch bei den Teilnehmer*innen der Smart VitAALity Studie. Die Bereitschaft zur Nutzung und Teilnahme, aber auch die langfristige Diskussion und Multiplikator-Funktion waren für das Team, die Projektdurchführung und Ergebnisgenerierung, als auch langfristige Verankerung entscheidend.
Auch wollen wir den beteiligten Gemeinden (Klagenfurt, Ferlach, Villach) für ihre Offenheit, aktive Teilnahme und jahrelange Unterstützung im Rahmen des Forschungsprojektes danken.
Dies gilt auch für die vielen regionalen Vereine (im Speziellen LAiF-Lebenswertes Altern in Ferlach, Repair Cafe), die uns in vielen Diskussionen, Treffen und Disseminationstätigkeiten aktiv unterstützt haben.
Und nicht zuletzt gilt auch der Dank den involvierten Personen im Bereich der Förderlinie benefit der österreichischen FFG und des BMVIT, die uns Türen geöffnet haben und uns immer aktiv unterstützt haben.
Über die Autor*innen
FH-Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Johannes Oberzaucher ist Professor für den Bereich Active and Assistive Technologies an den Studiengängen Medizintechnik und Healthcare IT. Seit dem Jahr 2016 ist er Leiter des Departements „Health and Assistive Technologies” am Institute for Applied Research on Ageing (IARA) an der Fachhochschule Kärnten. Seine Schwerpunkte im Forschungsfeld AAL liegen im Bereich der multidisziplinären Technologieentwicklung im partizipativen Prozess und der Evaluierung von AAL Lösungen auf Basis des Living Lab Ansatzes. Im Projekt Smart VitAALity war er u.a. in der Rolle des Projektleiters verantwortlich für die Gesamtprojektkoordination sowie Planung, Implementierung und Koordination der multidisziplinären Evaluierung sowie Verankerung und Überführung des Ansatzes hin zu einer langfristigen Markteinführung.
DI Daniela Krainer, Medizintechnikerin und Ergotherapeutin ist seit 2014 an der Fachhochschule Kärnten am Studiengang Medizintechnik in der Forschung sowie in der Lehre im Bereich Ageing Care & Technology tätig. Sie ist Mitarbeiterin am Institut für Applied Research on Ageing im Department „Health and Assistive Technologies“ und leitet seit 2018 die Forschungsgruppe Active & Assisted Living (AAL). Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der nutzerzentrierten und partizipativen Forschung sowie in der Evaluierung im Bereich Domänen der Technologieakzeptanz. Im Projekt Smart VitAALity war sie u.a. für das Feldtestmanagement, -koordination und -durchführung, sowie für die Evaluation der Zusammenhänge akzeptanzbeeinflussender Faktoren der Technologienutzung verantwortlich.
FH-Prof.in Mag.a Dr.in rer.nat. Olivia Kada forscht und lehrt am Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement der FH Kärnten und ist externe Lehrbeauftragte am Institut für Psychogerontologie (IPG) der FAU Erlangen-Nürnberg. Für ihre Forschungen im Bereich Langzeitpflege wurde sie mit dem Ignatius Nascher Preis für Geriatrie der Stadt Wien 2017 sowie dem Theo und Friedel Schöller-Preis 2016 ausgezeichnet. Im Projekt Smart VitAALity war sie u.a. verantwortlich für die Evaluation der Effekte auf die subjektive Lebensqualität.
Dipl.-Ing. Daniela Elisabeth Ströckl, BSc ist Mitarbeiterin des Studiengangs Medizintechnik, Mitglied des Departments „Health and Assistive Technologies“ am Institute for Applied Research on Ageing (IARA), der Forschungsgruppe AAL an der FH Kärnten sowie der Forschungsgruppe Application Engineering der Alpen Adria Universität. Ihre Schwerpunkte im Forschungsfeld der Medizininformatik bzw. AAL liegen in der Entwicklung von multimodalen Schnittstellen sowie der Evaluierung in den Bereichen User Experience und Nutzung von medizinischen Applikationen von der Prävention/Telemonitoring bis hin zu Krankenhausapplikationen. Im Projekt Smart VitAALity war sie u.a. verantwortlich für die Entwicklung der grafischen Benutzeroberflächen, der User Experience Evaluierung und der Nutzungsanalyse.
FH-Prof. Dr. Birgit Aigner-Walder ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kärnten und leitet das Department „Demographic Change and Regional Development“ am Institute for Applied Research on Ageing (IARA). Ihre Schwerpunkte im Forschungsfeld Bevölkerungsökonomie sind die Analyse der Auswirkungen der Alterung der Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt, private Konsumentscheidungen und die Daseinsvorsorge sowie die Evaluierung potenzieller Lösungsansätze zu bestehenden Herausforderungen in den genannten Feldern. Im Projekt Smart VitAALity war sie für die sozioökonomische Potenzialanalyse verantwortlich.
Dipl. Ing. Erich Krassnig ist Leiter der Abteilung IT-Services im Hilfswerk Kärnten. Im Projekt Smart VitAALity war er neben organisatorischen Tätigkeiten für die technische Begleitung der eingesetzten AAL Technologien im Hilfswerk Kärnten zuständig.
Dipl-Ing. Sandra Lisa Lattacher, BSc ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Kärnten (Forschungsgruppe AAL und Institut für Applied Research on Ageing im Department „Health and Assistive Technologies“). Neben den großen Forschungschwerpunkten Data Science und User Centered Design, liegen ihre Interessen in der medialen Entwicklung, Visualisierung und Verbreitung der Forschungsergebnisse über digitale Medien. Im Projekt Smart VitAALity war sie u.a. an der Datenanalyse verschiedener Evaluierungsparameter beteiligt.
Dr. Walter Liebhart ist Geschäftsführer der Firma ILOGS mobile software GmbH (www.ILOGS.com). ILOGS ist Marktführer im Bereich der mobilen/ambulanten Dienste und beschäftigt sich seit fünf Jahren mit Forschung und Entwicklung von AAL-Lösungen. Im Rahmen von ZentrAAL lieferte ILOGS die technische Plattform, welche für zukünftige F&E Projekte sowie marktreife Produkte weiter ausgebaut wird.
Albert Luger, BA MA ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department „Demographic Change und Regional Development“ am Institute for Applied Research on Ageing (IARA) an der Fachhochschule Kärnten. Seine Forschungsinteressen umfassen energiewirtschaftliche, regionalökonomische und arbeitsmarktrelevante Fragestellungen. Im Projekt Smart VitAALity war er gemeinsam mit seinen Kolleg*innen verantwortlich für die gesundheitsökonomische Evaluierung (Kosten-Nutzen- und Kosten-Nutzwert-Analyse) der entwickelten technischen Assistenzsysteme.
Dipl. Ing. Kurt Majcen ist in der Forschungsgruppe „Connected Computing“ bei DIGITAL – Institut für Informations- und Kommunikationstechnologien der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH tätig. Seit 2010 koordinierte und führte er Projekte im Schwerpunkt Active and Assisted Living (AAL) durch, von 2015 bis 2019 u.a. auch die steirische AAL-Test Region „RegionAAL“. In Smart VitAALity leitete er das Team für die Erstellung des Sicherheitskonzeptes für die IKT-Lösungen.
Anna-Theresa Mark, BA, MA studierte „Gesundheits- und Pflegemanagement“ an der FH Kärnten sowie „International Health and Social Management“ am MCI Innsbruck. Seit 2018 ist sie im Studienbereich „Gesundheit und Soziales“ an der Fachhochschule Kärnten als wissenschaftliche Projektassistentin tätig. Im Projekt Smart VitAALity war sie an der Wirkungsanalyse zur Lebensqualität beteiligt.
Robert Ofner, MSc. BSc. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Department „Demographic Change and Regional Development“ am Institute for Applied Research on Ageing (IARA) an der Fachhochschule Kärnten. Im Projekt Smart VitAALity war er an der sozioökonomischen Potenzialanalyse beteiligt.
Dipl.-Ing. Elena Oberrauner, BSc ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Active and Assisted Living und am Institute for Applied Research on Ageing (IARA), Department „Health and Assistive Technologies“, an der Fachhochschule Kärnten. Ihre Schwerpunkte sind User Centered Design, Nutzungsanalysen und Usability- & UX-Evaluierungen. Im Rahmen des Projektes Smart VitAALity beteiligte sie sich an der Durchführung der Rekrutierung, an der Mitentwicklung des Konzepts zur Nutzungsanalyse und unterstützte die Begleitung des Feldtests.
MMag.a Petritz Christina, Bakk.a studierte Betriebswirtschaftslehre sowie Psychologie und ist verantwortlich für das Projektmanagement im Hilfswerk Kärnten. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte liegen u.a. im Bereich der Umsetzung der Digitalisierungsbestrebungen des Hilfswerk Kärnten im Rahmen der mobilen Pflege und Betreuung, soziale Nachhaltigkeit, Projekte im Zusammenhang mit einem Angebotsausbau (z.B. teilstationäre Tagesbetreuung für Senioren*innen) und Fördermanagement. Im Projekt Smart VitAALity war sie für die Koordination interner Ressourcen, Kommunikation und Berichtverfassung von Seiten des Hilfswerk Kärnten zuständig.
Dipl.-Ing. Johanna Plattner, BSc arbeitet seit 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Kärnten am Studiengang Medizintechnik. Weiters ist sie Teil des Departments „Health and Assistive Technologies” am Institute for Applied Research on Ageing (IARA) und der Forschungsgruppe Active and Assisted Living. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Konzeption und Implementierung von Softwarelösungen und Algorithmen für verschiedene Anwendungsfälle in den Bereichen IoT und assistive Technologien. Im Rahmen des Projektes Smart VitAALity arbeitete sie u.a. an der Durchführung von Workshops für die Anforderungsanalyse, unterstützte bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Softwarelösung und wirkte bei der Durchführung und Analyse des Feldtestes mit.
Philip Scharf, MSc studierte Health Care IT an der Fachhochschule Kärnten, an der er auch in der Forschungsgruppe AAL als wissenschaftlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet. Im Projekt Smart VitAALity unterstütze er unter anderem die Bereiche Nutzungs- und Akzeptanzanalyse.
Lukas Wohofsky, MSc ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Active & Assisted Living (AAL) am Institute for Applied Research on Ageing (IARA) an der Fachhochschule Kärnten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Entwicklung und Evaluation von assistiven Technologien anhand des User-Centered Design Ansatzes. Im Projekt Smart VitAALity hat er die Auswertung der qualitativen Interviews im Rahmen der Akzeptanzanalyse durchgeführt und das Kapitel „Akzeptanz und Alltagsintegration von Smart VitAALity“ mitgestaltet.
Definitionen und Abkürzungen
AAL
Active and Assisted Living: Als altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben werden Technologien, Konzepte und Methoden bezeichnet, durch die es älteren Menschen ermöglicht werden soll, länger unabhängig von anderen Menschen zuhause zu leben ohne dabei Lebensqualität einzubüßen.
App
Als App wird eine Applikationssoftware für mobile Geräte, wie Tablet oder Smartphone, bezeichnet.
CBA
Kosten-Nutzen-Analyse (Cost-Benefit Analysis)
CC
Care Center
CEA
Kosten-Effektivitäts- bzw. Kosten-Wirksamkeits-Analyse (Cost-Effectiveness Analysis)
CUA
Kosten-Nutzwert-Analyse (Cost-Utility Analysis)
CMA
Kostenminimierungs-Analyse (Cost-Minimization Analysis)
Demowohnung
Eine Demowohnung ermöglicht Interessent*innen sich in einer realen Wohnumgebung das (verbaute) AAL-System anzusehen.
DGKP
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson
Drop-out
Ausstieg eines*einer Teilnehmer*in aus dem Test. Nichtnutzung einzelner Funktionen (selektiver drop-out).
Exklusionskriterien
Eigenschaften, die Personen nicht aufweisen dürfen, um sich für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Untersuchung zu qualifizieren.
Externe Anwendungen
Anwendungen, die nicht im Rahmen des Projekts entwickelt wurden, aber im System eingesetzt werden z.B. E-Mail oder WhatsApp.
Feldtest
Test eines Produktes/Prototypen unter realen Bedingungen (d.h. außerhalb eines Labors).
First Level Support
Erster Kontakt zur Lösung von Problemen und Anfragen. Im Projekt Smart VitAALity wurde dazu eine Hotline beim Partner FH Kärnten eingerichtet.
Friendly User
Potenzielle Nutzer*innen, die das System auf Basis von Testszenarien und Testfällen testen und Rückmeldungen zur Weiterentwicklung geben, bevor das System tatsächlich im Feld ausgerollt wird.
HCD
Human Centred Design - Neben der Einbeziehung von Endnutzer*innen zur Systementwicklung werden auch andere Stakeholder einbezogen.
IARA
Fachhochschule Kärnten - Institute for Applied Research on Ageing –
www.iara.ac.at
IC
Ein Informed Consent ist eine informierte Zustimmungserklärung, also eine Einwilligung nach erfolgter Aufklärung über die Intervention, mögliche Risiken und Rechte der Teilnehmer*innen.
ICER
Inkrementelle Kosten-Nutzen-Relation (Incremental Cost-Effectiveness Ratio)
IG
Interventionsgruppe
Inklusionskriterien
Kriterien, die Personen erfüllen müssen, um in die Untersuchung mit einbezogen zu werden.
Interventionsgruppe
Personen in der experimentellen Forschung, die an einer Intervention teilnehmen oder ein Produkt oder einen Prototypen für eine bestimmte Zeit ausprobieren.
ICD-10
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (WHO, 2016)
IKT
Informations- und Kommunikationstechnik beschreibt im AAL-Bereich Geräte, die Personen dazu dienen mit ihren Verwandten zu kommunizieren, entweder über Textnachrichten oder mittels Videotelefonie, und Geräte, die Vitaldaten messen und den Gesundheitszustand überwachen.
ITU
Intention to Use (Nutzungsabsicht)
Key-User
Key-User sind Endbenutzer*innen, die von Anfang an in den Entwicklungsprozess einer neuen Technik involviert sind.
KG
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe
Personen in der experimentellen Forschung, die (idealerweise) die gleichen Eigenschaften wie die Personen der Interventionsgruppe aufweisen, jedoch nicht an der Intervention teilnehmen bzw. diese erhalten.
Logging
Das automatische Speichern von Prozessen und Datenänderungen in Log-Dateien.
Mock-up
Rudimentärer Prototyp des Systems, der zum Testen verwendet wird, um erste Entwürfe darzustellen.
n
Fallzahl in der Stichprobe
nIG
Anzahl der Personen in der Interventionsgruppe
nKG
Anzahl der Personen in der Kontrollgruppe
Notrufzentrale
24-Stunden Telefondienst zur Abwicklung von Notfallsituationen
Nutzungshäufigkeit
Häufigkeit des Einsatzes von Smart VitAALity
Nutzungstyp
Nutzer*innen der Samrt VitAALity Lösung werden auf Basis der Nutzungsintensität des AAL-Systems und seiner Funktionen in vier Nutzungstypen (Nicht-Nutzer*innen, Wenig-Nutzer*innen, Mittel-Nutzer*innen und Viel-Nutzer*innen) unterteilt.
ÖNORM
Freiwilliger nationaler Standard, der in Österreich vom Austrian Standards Institute herausgegeben wird.
p-Wert
p-Wert resultiert aus statistischen Tests, die für die Hypothesenprüfung eingesetzt werden. Der p-Wert unterstützt die Entscheidung, ob ein Ergebnis als „statistisch signifikant“ anzusehen ist.
PC
Personal Computer
Persona
Beschreibung von typischen Nutzer*innen (mit Bezug auf ihre Eigenschaften und ihr erwartetes Nutzungsverhalten)
PIR Sensor
Passive Infrared Sensor – Lokalisationssensor, der für den Innenraum genutzt wird.
Qualitative Interviews
Eine mündliche Befragungsmethode bei der der interviewten Person offene Fragen gestellt werden. Offene Fragen sind so gestellt, dass sie nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können, sondern Spielraum für weitergehende Erläuterungen geben.
QUALY
Qualitätskorrigiertes Lebensjahr (Quality-Adjusted Life Year)
Raspberry PI
Einplatinencomputer, der als lokaler Server zur Sammlung von in der Wohnung anfallenden Daten verwendet wurde.
RCT
Randomisierte kontrollierte Studie (randomized controlled trial)
Rekrutierung
Prozess der Auswahl und Einladung potenzieller Teilnehmer*innen an wissenschaftlichen Untersuchungen
Responsible Science
Im Sinne eines*r „Responsible Research and Innovation“: „verantwortliche Forschung und Technologieentwicklung“ bzw. „verantwortliche Forschung und Innovation“ charakterisiert durch Beteiligung verschiedener Stakeholder, Berücksichtigung beider Geschlechter, wissenschaftsbezogene Bildung, Transparenz und Zugänglichkeit der Forschung, Stärkung ethischer Gesichtspunkte und die Beratung politischer Entscheidungsträger hinsichtlich der Vermeidung schädlicher und unethischer Entwicklungen in Forschung und Innovation.
Roll-Out
Überführung des Systems in das Feld für die eigentliche Feldtestung
Second Level Support
Nächste Instanz, wenn der First Level Support die Anfrage nicht lösen kann. Im Projekt Smart VitAALity wurde der Second Level Support zunächst vom technischen Team von ILOGS umgesetzt.
SECU-16
Erfassung von Technologieängstlichkeit und Sicherheit telemedizinsicher Anwendungen
Smart Home
Oberbegriff für technische Systeme und Komponenten, die in Wohnräumen verbaut sind und unterschiedliche Funktionen für die Benutzer*innen zur Verfügung stellen.
SQoL
Subjective quality of life
–
subjektiv wahrgenommene Lebensqualität
TAM
Technology Acceptance Model
TA-EG
Fragebogen zur Erhebung der Technikaffinität für elektronsiche Geräte
Testpersonen
Personen der Interventionsgruppe
Testphase
Abschnitt oder Phase der Systementwicklung, die den Zeitraum des Validierens einer Software im formativen Prozess beschreibt.
TN00
Interviewteilnehmer*in 0
TN_FB1
Teilnehmer*in Fragebogen t1
TN_FB2
Teilnehmer*in Fragebogen t2
TRL
Technology Readiness Level (dt. Technologie-Reifegrad) gibt auf einer Skala von 1 bis 9 an, wie weit eine Technologie entwickelt ist.
TUQ
Technology Usage Questionnaire
TUI
Technology Usage Inventory, ein Fragebogen zu Erhebung der Technlogieakzeptanz
User Centred Design
Einbeziehung von Endnutzer*innen bei der Systementwicklung durch einen Befragung
User-Interface
Alle Komponenten eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen oder Bedienelemente für die Benutzer*innen zur Ausführung spezieller Aufgaben zur Verfügung stellen.
User Involvement
Einbeziehung der Nutzer*innen bei der Systementwicklung
UTAUT
Unified theory of acceptance and use of technology
UX
User Experience
WLAN
Wireless Local Area Network – Bezeichnung für kabellosen Internetzugriff
Zielgruppe
Gruppe aller Personen, die mit einer Intervention, einer Maßnahme, einem Produkt oder einem Prototypen angesprochen werden soll.
1 Allgemeine Zielsetzung des Evaluierungsberichts
Autor*innen: Johannes Oberzaucher
1 Allgemeine Zielsetzung des Evaluierungsberichts
1.1 Allgemeine Zielsetzung der Evaluierung
1.2 Zielsetzungen des Berichts
1.3 Inhaltlicher Überblick
1.1 Allgemeine Zielsetzung der Evaluierung
Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG fördert im IKT Programm „benefit“ sogenannte AAL-Testregionen. Diese Test- oder besser Pilotregionen haben zur Hauptaufgabe AAL-System- und Servicelösungen zu entwickeln bzw. zu integrieren, wobei die den Dienstleistungen zugrundeliegenden Prozesse mitberücksichtigt werden sollen. Diese AAL-Lösungen wurden vor allem im urbanen Umfeld und mit Schnittstellen zu Smart Cities Technologien und Diensten evaluiert.
Die generelle Zielsetzung der Evaluierung im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity bestand in der Durchführung einer langfristig und breit angelegten sowie multidimensionalen Mixed-Methods-Studie im freien Feld. Diese Zielsetzung wird durch die Grundprinzipien Transparenz, Effizienz und Interdisziplinarität unterstützt. Ziel der Evaluierung ist eine innovative Auswertung durch die Kombination unterschiedlicher Datenquellen, Methoden und verschnittenen Ergebnisgenerierungen. Die Smart VitAALity Evaluierung basiert auf einem multidimensionalen Modell und ist als kausale Kette definiert, deren Evaluationsdomänen direkt ineinandergreifen. Es wird davon ausgegangen, dass die Technologieakzeptanz das Nutzungsverhalten beeinflusst und bildet die Voraussetzung dafür, dass das System entsprechend verwendet wird. Das Nutzungsverhalten wiederum beeinflusst, ob und welche Wirkungen das technische System auf das Alltagsleben und die sQoL der Zielgruppe hat. Um einerseits eine quantifizierbare Argumentationsgrundlage für eine entsprechende Nachhaltigkeitsstrategie, andererseits eine Ergänzung für eine Verwertungsplan- und Businessplan-Generierung zu garantieren, wird auf die zentrale sQoL Wirkungsanalyse eine Kosten-Nutzen- und Kosten-Nützlichkeitsanalyse aufgesetzt. Die Ergebnisse wurden in Bezug auf diese Evaluierungsstrategie und Domänen getrennt gesammelt und dargestellt, als auch im Kontext analysiert. Die Datenerhebungen und Auswertungsergebnisse der Projektpartner*innen sollen für alle Beteiligten und Interessierte transparent dargestellt werden.
1.2 Zielsetzungen des Berichts
Im vorliegenden Evaluierungsbericht sollen – auf Basis einer detaillierten Beschreibung des technologischen Systems, der Services und des Testsettings das Konzept, die Umsetzung und die Ergebnisse der multidisziplinären Mixed-Methods-Evaluierung des entwickelten AAL-Systems in vollem Umfang dargestellt werden.
Die Ergebnisse und Befunde sollen als Beitrag gesehen werden, die Herausforderungen der systemischen Umsetzung einer AAL-Pilotregion und ihrer Evaluierung deutlich und die gewählten Umsetzungen nachvollziehbar zu machen, sowie ein Verständnis für die Herausforderungen, Möglichkeiten und generellen Grundvoraussetzungen einer langfristigen Verankerung solcher Technologien im Alltag zu schaffen. Zentral soll transparent und durchgängig dargestellt werden, wie die technologischen Smart VitAALity Umsetzungen und Services von den Studienteilnehmer*innen bewertet und genutzt wurden, und welche Effekte sich auf definierte Lebensqualitätsdomänen und das generelle Alltagsleben der Studienteilnehmer*innen nachweisen lassen.
Zielgruppe für den vorliegenden Sammelband sind einerseits Partner aus Forschung und Entwicklung, die entweder ihre Ergebnisse aus breiten AAL Studien vergleichen wollen oder aus den Erkenntnissen lernen und diese in eigenen Pilotregionen umsetzen wollen. Andererseits die interessierte Öffentlichkeit, die sich ein klareres Bild über die Möglichkeiten und Herausforderungen von ausgewählten AAL und Smart Living Technologien im Alltag älterer Menschen machen wollen.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Inhalte in den einzelnen Abschnitten und Kapiteln gegeben.
1.3 Inhaltlicher Überblick
Abschnitt 1 – Einblicke in die Pilotregion Smart VitAALity
Kapitel 1 gibt einen generellen Überblick über die einzelnen Abschnitte ausgehend von einem allgemeinen Überblick, hin zu der eigentlichen Evaluierung und ergänzenden Reflexionen, bis zu einem Resümee und einer Zukunftsvision.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem generellen Hintergrund und der Ausgangslage zur Realisierung der Pilotregion Smart VitAALity, dem psychogerontologischen Hintergrund und den abgeleiteten Forschungsfragen.
Kapitel 3 beschreibt die systemischen Ziele von Smart VitAALity, das generelle Interventionsdesign, Systemkomponenten und die abgeleiteten technologischen Funktionalitäten und dazugehörigen Smart VitAALity Services.
Kapitel 4 definiert im Sinne einer generellen Definition des Testsettings die Smart ViTAALity Zielgruppe, Inklusions- und Exklusionskriterien und archetypische Benutzer*innen. Es wird versucht diese Definitionen in Zusammenhang mit beschreibenden Parametern der Grundgesamtheit zu setzen und einerseits die damit verbundene Relevanz darzustellen, andererseits die Basis für eine Evaluierung mit entsprechender Stichprobengröße zu zeigen.
Kapitel 5 zeigt das Smart VitAALity Evaluierungsdesign, den Aufbau und die Domänen des mehrschichtigen Evaluierungsmodells. Darauf aufsetzend wird ein Überblick über die durchgeführte Mixed-Methods-Studie sowie die abgeleitete Sequenzierung und Umsetzung gegeben.
Kapitel 6 gibt einen Überblick über die Stichprobenbildung inklusive der Planung des Rekrutierungsprozesses, der Parallelisierungsstrategie und der Durchführung der Rekrutierung. Weiters wird ein Überblick über Charakteristika der Interventions- und Kontrollgruppe gegeben.
Abschnitt 2 – Ergebnisse und Befunde der Smart VitAALity Evaluierung
Kapitel 7 analysiert und präsentiert das Nutzungsverhalten der Smart VitAALity Teilnehmer*innen und gibt Aufschlüsse darüber, welche Geräte, Funktionen und Services in welcher Intensität und Art genutzt wurden. Abgeleitet davon können Aussagen darüber getroffen werden, ob gewisse Funktionalitäten für ein assistierendes System im Regelbetrieb für Benutzer*innen gewinnbringend wären oder nicht.
Kapitel 8 beschreibt die Evaluierung der Smart VitAALity Systemakzeptanz und damit im Wesentlichen eine intendierte Nutzung des technischen Systems und der damit verknüpften Services. Die Evaluierung von Smart VitAALity fokussiert dabei auf die Domänen Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit und betrachtet zusätzlich psychologische Einflussfaktoren sowie die subjektive Einschätzung der zukünftigen Nutzungsabsicht ausgewählter Funktionen. Des Weiteren erfolgt eine Evaluierung des Care Center Service und eine weitere Einschätzung von Akzeptanzbarrieren, Erfolgsfaktoren und der potenziellen Alltagsintegration mittels Interviews.
Kapitel 9 beschreibt die Evaluation von Effekten des Smart VitAALity Lösungsbündels auf Dimensionen subjektiver Lebensqualität älterer Menschen. Im Rahmen des Kapitels wird zusätzlich das insgesamt junge Forschungsfeld analysiert und davon abgeleitet, wie die angenommenen positiven Wirkungen technischer Lösungen für ältere Menschen auf die subjektive Lebensqualität empirisch erforscht werden kann. Darauf aufsetzend wird dargestellt, wie im Projekt Smart VitAALity die Effekte von Techniknutzung auf die subjektive Lebensqualität untersucht wurden. Für das Projekt relevante Dimensionen subjektiver Lebensqualität wurden entsprechend analysiert und dargestellt.
Kapitel 10 stellt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der steigenden Kosten im Gesundheitsbereich gerade aus ökonomischer Sicht dar, welche Wirkungen sich durch Smart VitAALity – im Vergleich zur Regelversorgung – ergeben und wie die Gesamtbewertung des Systems unter Berücksichtigung der durch das System entstehenden Kosten zu beurteilen ist. Darauf aufsetzend wird eine sozioökonomische Potenzialanalyse durchgeführt. Im Konkreten wird eine Kosten-Nutzwert-Analyse und eine Kosten-Nutzen-Analyse präsentiert.
Abschnitt 3 – Ergänzende Reflexionen
Kapitel 11 zeigt eine ergänzende Evaluierung und Reflexion der eingesetzten Technologie und des technischen Support-Systems, das im Rahmen des Projektes Smart VitAALity über eine Support-Hotline Probleme mit Komponenten und generelle Fragen zur Technik analysiert und begleitet hat und als essenzieller Bestandteil für eine entsprechende Umsetzung im Rahmen eines Forschungsprojektes, aber auch darüber hinaus für eine spätere Produktumsetzung gesehen werden muss.
Kapitel 12 fokussiert auf die Themenfelder Security, Safety und Privacy und beschreibt für Smart VitAALity entwickelte Sicherheitskonzepte und die abgeleiteten Handlungsempfehlungen für Implementierung und Integration, Dokumentation, Schulung und Verwendung der Systeme. Eine möglichst weitgehende Beachtung der Handlungsempfehlungen sollte insgesamt eine sichere Verwendung der Systeme während des Feldtests und für eine zukünftige Implementierung in Haushalten ermöglichen.
Abschnitt 4 – Resümee und Ausblick für Smart VitAALity
Kapitel 13 zeigt, in Ergänzung zur eigentlichen Entwicklung und Testung von technologischen Lösungen, Aktivitäten zur Marktanalyse, Geschäftsmodellentwicklung sowie Projektverankerung. Im Rahmen des Kapitels wurden bestehende, projektrelevante Ansätze und Geschäftsmodelle identifiziert, die wiederum im interdisziplinären Diskurs als Basis für weiterführende, iterative Definition und Modellbildungen dienen können. Zusätzlich wird ein bereits umgesetztes Produktüberführungsszenario dargestellt.
Kapitel 14 fasst jeweils die wesentlichsten Erkenntnisse zur Funktionsfähigkeit, der Akzeptanz und den Effekten bezüglich der verschiedene Smart VitAALity Funktionen zusammen. Ergänzend werden daraus Empfehlungen für die zukünftige Umsetzung des Anwendungsbereichs abgeleitet, wobei auf die Gestaltung von Funktionen, die Anforderungen an die Designs von Hard- und Software und auf entsprechende angedockte Services eingegangen wird.
Kapitel 15 zeigt zusammenfassend die mögliche Auswirkung der Technologien auf die Lebensqualität im Alltag der potenziellen Benutzergruppen auf und es wird der konkret davon abgeleitete Mehrwert diskutiert. Davon abgeleitet wird das vorhandene Potenzial bzw. Nicht-Potenzial dargestellt und in Zusammenhang mit real umgesetzten Geschäftsmodellen mit entsprechendem Marktpotenzial gebracht.
2 Genereller Hintergrund und Ausgangslage
Autor*innen: Johannes Oberzaucher und Olivia Kada
2 Genereller Hintergrund und Ausgangslage
2.1 Genereller Hintergrund und Ausgangslage
2.2 Psychogerontologischer Hintergrund
2.3 Abgeleitete Hauptforschungsfragen und generelles Test-Setting
2.4 Quellen
2.1 Genereller Hintergrund und Ausgangslage
Mit der aktuellen demografischen Entwicklung werden unsere alternde Gesellschaft und damit einhergehende Herausforderungen aktuell stärker denn je sichtbar. Die Zunahme chronischer Erkrankungen und damit einhergehende Autonomieverluste stellen eine besondere Herausforderung dar, wenngleich Menschen sehr unterschiedlich altern (Tesch-Römer & Wahl, 2017). Um sich diesen Herausforderungen erfolgreich stellen zu können, werden Anwendungen und Services, die auf den langfristigen Erhalt der Lebensqualität abzielen, als essenziell gesehen. Als innovative Lösungsstrategie sind in diesem Zusammenhang Services im Bereich Smart Home, Smart Service und weiterführend einer Smart City Infrastruktur im Bereich „Health, Inclusion und Assisted Living“ zu sehen.
Das Smart VitAALity System bietet für die zukünftigen (Primär-)Benutzer*innen und ihr persönliches Umfeld bedarfsgerechte, erweiter-/nachrüstbare, modular- bzw. intuitiv benutzbare und in die bereits bestehenden Alltagsprozesse gut integrierte Services. Die Funktionalitäten zielen auf einen langfristigen Erhalt der Lebensqualität und deren Dimensionen (Wohlbefinden, Gesundheit, soziale Inklusion ) ab. Dies soll eine längere, autonome und zufriedene Lebensspanne in der eigenen Wohnumgebung ermöglichen.
2.2 Gerontologischer Bezugsrahmen
AAL Technologien haben generell das Potenzial zu einem guten Leben im Alter beizutragen, sofern sie die Bewältigung altersspezifischer Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben unterstützen und an die individuellen Lebensziele der jeweiligen Person angepasst sind (Remmers, 2016; Schulz, Wahl, Matthews, De Vito Dabbs, Beach & Czaja, 2015). Theorien erfolgreichen Alterns, insbesondere das Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation (SOK; Baltes & Baltes, 1990; Lindenberger, Lövdén, Schellenbach, Li & Krüger, 2008), bieten einen geeigneten theoretischen Rahmen für die Entwicklung und Evaluation lebensqualitätsfördernder AAL Interventionen (Schulz et al., 2015). Moderne Technologien müssen dem Ziel dienen, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren, indem sie die SOK Mechanismen des alternden Menschen unterstützen (Lindenberger & Lövdén, 2006). Nach Schulz et al. (2015) haben AAL Technologien durchaus das Potenzial positive Entwicklung zu befördern, bergen aber auch die Gefahr diese zu behindern.
Technology can be helpful by maintaining functioning, independence, and motivating engagement with important life goals, but it has also been speculated that it can be harmful by eroding skills and abilities through disuse, undermining motivation, and compromising autonomy and independence and by promoting a false sense of security. Little research is available to address this issue. (Schulz et al., 2015, p. 732)
Dies bedeutet, dass nicht nur der Ausgleich von Verlusten im Fokus stehen darf, sondern dass durch moderne Technologien auch der Kontext für Entwicklungsgewinne geschaffen werden muss; dies kann beispielsweise durch die Unterstützung von Self-Monitoring oder durch Kontexte für Lernen und Training geschehen (Kada, Mark, Kamin, Damm, Brenneisen & Lang, 2019). Als Gradmesser für den Erfolg von AAL Technologien sind gemäß den oben erwähnten theoretischen Ansätzen immer auch die subjektiven Lebensresultate aus Sicht der Senior*innen, also die subjektive Lebensqualität (sQoL), anzusehen (Schulz et al., 2015). In Kapitel 7 wird ein Überblick über die aktuelle diesbezügliche Studienlage gegeben.
2.3 Abgeleitete Hauptforschungsfragen und generelles Test-Setting
Eine gezielte Evaluierung und die Darstellung von Effekten auf ausgewählte Domänen der subjektiven Lebensqualität ist als zentraler Teil jeder AAL-Testregion, die von der FFG im Rahmen des IKT Programms „benefit“ gefördert wird, zu sehen. Diese Lebensqualitätsevaluierungen müssen aber immer mit Ergebnissen von UX-Analysen, Akzeptanzevaluierungen und Nutzungsverhaltensanalysen abgeglichen und in deren Kontext analysiert werden. Gerade diese Verschränkung von klassischen, technologisch-geprägten und gut in den technologischen F&E Bereich integrierten AAL-Evaluierungsdomänen (UX, Akzeptanz, Nutzungsverhalten), mit für den Alltagseinsatz hochrelevanten, aber vielfach für technologische Interventionen nur bedingt einsetzbaren Evaluierungsdomänen (sQoL Wirkungsanalyse, sozioökonomische Potenzialanalysen), gibt ein gesamtheitliches Bild über die aktuelle Alltagseinsatzfähigkeit solcher AAL Systeme.
Die Hauptforschungsfrage im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity dreht sich um die Wirksamkeit bezogen auf Kerndimensionen der subjektiven Lebensqualität (Gesundheit, Soziale Partizipation; für Details siehe Kapitel 7) und ob definierte (nur Smart VitAALity relevante werden aufgenommen) Domänen der Lebensqualität (Adler, 2000; Brown, 2004; Wiggins, R., Blane, D., Higgs, P. and Hyde, M., 2004) positiv beeinflusst werden können. Wirksamkeitsbeeinflussende Faktoren und gleichzeitig als klassische AAL relevante Evaluierungsdomänen angesehene Faktoren wie Akzeptanz (Venkatesh & Bala, 2008; Kothgassner, 2013) und Nutzungsverhalten (Spellenberg & Schellisch, 2009) erweitern die Evaluationsdomänen. Im Sinne einer Definition einer Argumentationsbasis zur Überführung von Smart VitAALity Komponenten und Services in ein (Regel-)-Finanzierungsmodell und einer entsprechenden Nachhaltigkeitsstrategie wird eine sozio-ökonomische Potenzialanalyse (Schneider & Buchinger, 2010; Mann, W.C., Ottenbacher, K.J., Fraas, L., Tomita, M. and Granger C.V., 1999; Hoenig, 2003; Buchinger, 2010) realisiert. Abbildung 2-1 gibt einen Grobüberblick über die vorgeschlagene kausale Kette und die Zusammenhänge des Smart VitAALity Evaluierungsmodells. Hier wird ein Überblick über die vermuteten Zusammenhänge der einzelnen Evaluationsdomänen dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung wird in Kapitel 5 gegeben.
Der methodische Ansatz integriert im Sinne einer Mixed-Methods-Studie qualitative und quantitative Erhebungen, auf Basis von validierten Messinstrumenten/Indikatorensets und wird forschungsprozesstechnisch (ISO 2010) und studiendesigntechnisch abgebildet werden.
Die Evaluierung erfolgt im urbanen Dreieck Klagenfurt-Ferlach-Villach und deckt damit einen urbanen Mix ab (von der Kleinstadt Ferlach mit 10.000 Einwohner*innen über eine Stadt mittlerer Größe - Villach mit 60.000 Einwohner*innen bis zur Großstadt Klagenfurt mit über 100.000 Einwohner*innen), der zusätzlich Vergleichsmöglichkeiten bieten wird.
Als Zielgruppen werden aktive Senior*innen (chronologisches Alter 60-80 Jahren), Angehörige und informell Unterstützung leistende Personen sowie professionell Pflegende und Pflegedienstleister adressiert. Als Hypothese ist ein langfristiger Erhalt bzw. (positive) Beeinflussung der Lebensqualität (QoL) der Primärbenutzer*innen durch Nutzung des Smart VitAALity Gesamtsystems definiert.
Abbildung 2-1: Evaluierungsmodell Smart VitAALity
Im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity setzte sich das Evaluierungsteam aus Mitgliedern unterschiedlicher wissenschaftlicher Einrichtungen und unterschiedlicher fachlicher Ausrichtungen (Pflege und Gesundheitswissenschaften, Medizintechnik, Medizininformatik, Medizin, Ökonomie und genereller Altersforschung) zusammen. Die interdisziplinäre Aufstellung zeigt sich einerseits im Aufbau und Durchführung der Evaluierung andererseits auch in der vernetzten Ergebnisdarstellung.
Neben einer klar erkenntnisgeprägten, empirischen Studie wurde im Rahmen der Pilotregion Smart VitAALity ein „bildender“ und verwertender Ansatz verfolgt. Senior*innen und AAL relevante Stakeholdergruppen (Angehörige, Daseinsversorger, Städte, Länder) wurden an die verwendeten Technologien angenähert – die Möglichkeiten sowie Vorteile aber auch auftretende Schwierigkeiten wurden breit bekannt gemacht. Falsche Erwartungen sollten somit frühzeitig (vor Markteinführung und möglicher Überführung in die Regelfinanzierung) minimiert werden.
2.4 Quellen
Adler, G., et al. (2000). „Soziale Situation und Lebenszufriedenheit im Alter," in Z Gerontology Geriatrics, vol. 33, no. 3, pp. 210-216, 2000.
Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation. In P.B. Baltes, M.M. Baltes (eds), Succcessful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences (pp 1–34). New York, Cambridge University Press.
Brown, J., et al.(2004). “Models of Quality of Life: A Taxonomy, Overview and Systematic Review of the Literature,” European Forum on Population Ageing Research
Buchinger, C. (2010) „Prognose der österreichischen Altenpflegekosten bis zum Jahr 2030,“ Wirtschaftsuniversität Wien, 2010.
Hoenig, H., et al. (2003). "Does Assistive Technology Substitute for Personal Assistance Among the Disabled Elderly?," in American Journal Public Health, vol. 93, no. 2, pp. 330-337, 2003.
ISO (2010). Ergonomie der Mensch-System-Interaktion -- Teil 210: Prozesse zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme, ISO 9241-210:2010, 2010.
Kada, O., Mark, A.-T., Kamin, S. T., Damm, F., Brenneisen, J. & Lang, F. R. (2019). AALtersbilder. Altersbilder in benefit und AAL Projekten. Eine Mixed Methods Studie. Studienbericht. Retrieved from: https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/thematische%20programme/IKT/AALtersbilder_Studienbericht_2019.pdf
Kothgassner, O., Felnhofer, A., Hauk, N., Kastenhofer, E., Gomm, J., and Kryspin-Exner, I. (2012). TUI - Technology Usage Inventory Manual.
Lindenberger, U. &, Lövdén, M. (2006). Co-constructing human engineering technologies in old age: lifespan psychology as a conceptual foundation. In P. B. Baltes, P. Reuter-Lorenz, & F. Rösle (eds.), Lifespan Development and the Brain: The Perspective of Biocultural Co-Constructivism (pp. 350–375). New York, Cambridge: University Press.
Lindenberger, U., Lövdén, M., Schellenbach, M., &, Li, S. C., Krüger A. (2008) Psychological principles of successful aging technologies: a mini-review. Gerontology, 54(1), 59-68. doi: 10.1159/000116114
Mann, W.C., Ottenbacher, K.J., Fraas, L., Tomita, M. and Granger C.V. (1999). "Effectiveness of Assistive Technology and Envrionmental Interventions in Maintaining Independence and Reducing Home Care Costs for the Frail Elderly. A Randomized Controlled Trial," Archives of Family Medicine, 8(3), 210-217, 1999
Remmers, H., Deutsches Zentrum für Altersfragen (2016) (Ed.), Ethische Implikationen der Nutzung alternsgerechter technischer Assistenzsysteme: Expertise zum Siebten Altenbericht der Bundesregierung. Berlin. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-49889-8
Schneider, U. &, Buchinger, C. (2010). “Projections of future long-term care expenditure in Austria (2008-2030) with special consideration of assistive technologies,” in Innovative ICT Solutions for Older Persons – A New Understanding, Gerda Geyer et al., Hrsg., Wien, 2010.
Schulz, R., Wahl, H.W., Matthews, J.T., De Vito Dabbs, A., Beach, S.R., & Czaja, S.J. (2015). Advancing the aging and technology agenda in gerontology. Gerontologist, 55(5), 724-34. doi: 10.1093/geront/gnu071
Spellerberg, A., Schelisch, L., (2009) „Ein dreiviertel Jahr mit PAUL: assisted Living in Kaiserslautern," in Ambient Assisted Living – AAL. Berlin: VDE Verlag, 2009.
Tesch-Römer, C., & Wahl, H.-W. (2017). Toward a More Comprehensive Concept of Successful Aging: Disability and Care Needs. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences,72(2):310-318
Venkatesh, V. and Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Science 39(2)
Wiggins, R., Blane, D., Higgs, P. and Hyde, M. (2004), "Quality of life in the third age: key predictors of the CASP-19 measure," Ageing Society, 24), 693-708.
3 Smart VitAALity – Überblick über das technologische System
Autor*innen: Johannes Oberzaucher
3 Smart VitAALity – Überblick über das technologische System
3.1 Systemische Ziele und allgemeines Interventions-Setting der Smart VitAALity Pilotregion
3.2 Smart VitAALity Anwendungs- und Interventionscluster
3.3 Smart VitAALity Systemkomponenten
3.3.1 Tablet
3.3.2 Smartwatch
3.3.3 Vitalparameter Mess-Set
3.3.4 Smart Home Komponenten
3.4 Smart VitAALity Anwendungsfunktionen
3.4.1 G1 Vitalwerte
3.4.2 G2 Aktiver Alltag
3.4.3 G3 Gesundheitstagebuch
3.4.4 G4 Medikamentenmanagement
3.4.5 G5 Notruf
3.4.6 S1 Regionale Informationen
3.4.7 S2 Veranstaltungen
3.4.8 S3 Nachbarschaftshilfe
3.4.9 S4 Vernetzungsplattform
3.4.10 S5 E-Mail
3.4.11 S6 Internet
3.4.12 S7 Zeitungen
3.4.13 S8 Kalender
3.5 Smart VitAALity Services
3.5.1 Gesundheitscoach und Smart VitAALity Care Center
3.5.2 Notruf und Smart VitAALity Call Center
3.5.3 Smart VitAALity Support Service
3.6 Quellen
3.1 Systemische Ziele und allgemeines Interventionssetting der Smart VitAALity Pilotregion
Ausgehend von den im vorherigen Kapitel beschriebenen Fakten folgt die Pilotregion Smart VitAALity somit immer dem Ansatz, dass ein Erhalt bzw. eine Verbesserung der subjektiven Lebensqualität als Gradmesser der erfolgreichen (Alltags-)Integration der entsprechenden AAL Technologien gesehen werden muss und diese auch entsprechend theoriegeleitet geplant und umgesetzt werden müssen – dies ermöglicht es nachfolgend eine Effizienz messbar zu machen, diese Ergebnisse in eine Nachhaltigkeitsstrategie einzupflegen und entsprechende Geschäftsmodelle abzuleiten bzw. zu unterstützen. Im Folgenden wird ein Überblick über das Smart VitAALity System im Zusammenhang mit den Hauptforschungsfragen gegeben. Detaillierte Beschreibungen der technologischen Lösungen und Umsetzung sind in den Unterkapiteln 3.4, 3.3 und 3.4 dargestellt.
Der Smart VitAALity Ansatz zielt generell darauf ab, für die zukünftigen (Primär-)-Benutzer*innen und ihr persönliches Umfeld bedarfsgerechte, erweiter-/nachrüstbare, modular bzw. intuitiv benutzbare und in die bereits bestehenden Alltagsprozesse gut integrierte Services zu realisieren. Die Funktionalitäten zielen auf einen langfristigen Erhalt der subjektiven Lebensqualität und deren Dimensionen (Gesundheit, Soziale Partizipation ) ab, um damit eine längere, autonome und zufriedene Lebensspanne in der eigenen Wohnumgebung zu ermöglichen.
3.2 Smart VitAALity Anwendungs- und Interventionscluster
Im Rahmen der Entwicklung der Smart VitAALity Lösung wurde der Ansatz gewählt zwei Interventionscluster (Gesundheit und Soziale Partizipation) zu definieren, die auf Komponenten der subjektiven Lebensqualität abzielen und innerhalb dieser Cluster einen Fokus auf eine Steigerung des Empowerments, der Awareness und der (Anwendungs-)Kompetenz zu legen. Die untergeordneten Interventionen innerhalb eines Clusters greifen direkt ineinander. Diese frühzeitige Definition der Interventionen ermöglicht einerseits eine entsprechende Planung des Studiendesigns, bereits unabhängig von einer technologischen Enddefinition, und eröffnet andererseits trotzdem eine benutzerzentrierte, partizipative Technologieentwicklung gemeinsam mit der Zielgruppe parallel zu anderen Life-Cycle Strängen innerhalb eines Testregionen Projektes. Die technologische Umsetzung der definierten Interventionen erfolgte basierend auf folgenden zwei Interventionsclustern „Gesundheit“ und „Soziale Partizipation“ mit entsprechenden Anwendungen (siehe Abbildung 3-1).
Der Interventionscluster „Gesundheit“ definiert in diesem Zusammenhang Anwendungsfunktionen, die Gesundheitszustandserfassung und Gesundheits-Selbstmanagement ermöglichen und durch ein telemedizinisches Care-Center-Service unterstützt werden. Zusätzlich ist eine aktive Notruffunktion integriert.
Abbildung 3-1: Smart VitAALity Interventionscluster GESUNDHEIT und SOZIALE PARTIZIPATION
Der Interventionscluster „Soziale Partizipation“ zielt auf den aktiven Austausch von Informationen und Bedürfnissen (z.B. im Sinne einer Nachbarschaftshilfe) und der Informationsbereitstellung von regionalen und überregionalen Information ab.
Von diesen Interventionscluster-Definitionen wurden im Rahmen des Projektes gezielt (technologische) Funktionen abgeleitet (siehe auch Kapitel 3.4). Diese müssen die Bedürfnisse und Unterstützungspotenziale der entsprechenden Zielgruppe widerspiegeln und von Anfang an berücksichtigt werden.
Im Rahmen der Pilotregion wurde das zentrale Paradigma verfolgt, dass durch die Nutzung der vorgeschlagenen Anwendungen, die sich aus den Interventionscluster ableiten ließen, eine intendierte Steigerung des Empowerments, der Awareness und Anwendungskompetenz im jeweiligen Cluster realisiert werden kann und diese in den vorgeschlagenen Analysen zu sQoL sichtbar werden. In diesem Zusammenhang können die Konzepte (Empowerment, Awareness und Anwendungskompetenz) generell gesehen werden und zusätzlich noch auf die Interventionscluster fokussiert definiert werden. Generell kann das Konzept des Empowerments (und als Komponenten davon die Awareness und Anwendungskompetenz) als professionelle Unterstützung von Autonomie und Selbstgestaltung definiert werden. Empowerment zielt darauf ab, dass „Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten, (…) Die Förderung von Partizipation und Gemeinschaftsbildung sind wesentliche Strategien des Empowermentprozesses, die sich meist auf benachteiligte Personen oder Gruppen beziehen. Empowerment verlässt die hierarchische Ebene vieler gesundheitlicher Dienstleistungen und betont vorhandene Stärken und Ressourcen (Lebenskompetenzen).“ (Fousek, Domittner & Nowak, 2012)
Bezogen auf den Interventionscluster „Gesundheit“ ist im Speziellen die Gesundheitskompetenz („health literacy“) als Hauptkomponente des Empowermentprozesses, die das Empowerment fördern kann, zu sehen (Fousek et al., 2012). Durch die Fähigkeit (gesundheitsrelevante) Informationen zu generieren, kritisch-konstruktiv zu nutzen und darauf aufsetzend entsprechende Alltagsprozesse zu adaptieren, kann Gesundheitskompetenz zu mehr Autonomie in Gesundheitsfragen führen. Gesundheitskompetenz kann dadurch Menschen zur Übernahme von Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit bezüglich ihrer Gesundheit ermächtigen (Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2013). Diese Erlangung von Gesundheitskompetenz ist im Speziellen auch im Zusammenhang mit einer in Österreich unterdurchschnittlich ausgeprägten Gesundheitskompetenz zu sehen. Die folgende Grafik (Abbildung 3-2) zeigt die Ergebnisse der Dimension „Umfassende Gesundheitskompetenz“ in einem EU-Ländervergleich (AT-Österreich). Abbildung 3-2 zeigt, dass sich Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern im hinteren Bereich befindet. Der Personenanteil mit mangelnder und problematischer Gesundheitskompetenz liegt in Österreich deutlich über dem EU-Durchschnitt (Ö: 54,8 %; EU: 46,3 %).
Bezogen auf den Interventionscluster „Soziale Partizipation“ ist im Speziellen die Medienkompetenz („media literacy“) als Hauptkomponente des Empowermentprozesses zu sehen. Gelingt es (durchaus bereits vorhandene) Technologien entsprechend nutzbar zu machen, bzw. den Anwender*innen eine entsprechende Medien- und Medienanwendungskompetenz zu vermitteln und die Möglichkeiten entsprechender Anwendung aufzuzeigen, so können sich die intendierten Wirkungen auf die sQoL entfalten. Diese kann auf österreichischem Level auch in Zusammenhang mit dem „Bundesplan für Seniorinnen und Senioren“ (BSS, 2013) in Bezug auf „Altern und Medien“ gesehen werden, in dem die Zusammenhänge differenziert betrachtet werden.
Abbildung 3-2: Ländervergleich – Levels der allgemeinen Gesundheitskompetenz/Health Literacy (GK/HL) (Pelikan & Ganahl 2017)
Dieser ist darauf fokussiert insbesondere einen „Flächendeckenden Zugang von älteren Frauen und Männern zu den neuen Medien sowie Informationen zur sicheren Nutzung und Stärkung ihrer Medienkompetenz“ u.a. durch den „Ausbau von wohnortnahen, niederschwelligen, barrierefreien und bildungsfördernden Angeboten für Frauen und Männer in der nachberuflichen Lebensphase in ganz Österreich einschließlich eines verbesserten Zugangs zu neuen Informationstechnologien“ zu erreichen. Dies kann zum Beispiel mit lokalen Schulungsangeboten zu Informations- und Kommunikationstechnologien, der Umsetzung des barrierefreien Zugangs zum Internet… und die Ausrichtung von eLearning-Kursen nach der Heterogenität der Zielgruppen erreicht werden (BSS, 2013).
Zielorientierung in der Pilotregion Smart VitAALity war es somit, ältere Menschen mit IKT-Anwendungen und angepassten Services vertraut zu machen, die einfach und sinnvoll in den Alltag und ihre gewohnten Abläufe integriert werden können und gleichzeitig gezielt positive Effekte in Bezug auf subjektives Gesundheitsempfinden sowie die erlebte soziale Partizipation zu setzen. Dieser Personengruppe sollte damit die Möglichkeit eröffnet werden, IKT-Anwendungen auszuprobieren und auch aktiv unterstützt werden, eine Medienkompetenz als Basis für die wirksame Anwendung dieser Technologien und der damit einhergehenden Interventionen zu entwickeln.
Generell sind dazu mehrere aufeinander aufsetzende Voraussetzungen zu erfüllen:
Die Interventionen müssen einer klar definierten Theorie folgen
Die abgeleiteten Funktionen müssen die Bedürfnisse und Unterstützungspotenziale der entsprechenden Zielgruppe widerspiegeln und von Anfang an berücksichtigt werden
Die techn. Komponenten und Funktionen müssen in modularer, personalisierbarer Art und Weise umgesetzt werden und weitgehend unabhängig von den Fähigkeiten integriert (Stichwort User Interaktion und Interface) werden
Eine gewisse Bereitschaft älterer Menschen muss gegeben sein, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen bzw. diese auszuprobieren
3.3 Smart VitAALity Systemkomponenten
Das Smart VitAALity System kann generell in mehrere technologische System- und Servicekomponenten unterteilt werden. Wie in Abbildung 3-3 dargestellt wurden als zentrale Interaktions- und Visualisierungskomponenten ein handelsübliches Tablet und eine Smartwatch mit projektspezifischer Software eingesetzt.
Ergänzend wurde ein vernetztes Vitalparametermessset (Gewichts-, Blutdruck-, Blutzuckermessung) sowie ein Smart-Home-Sensorset (nicht-invasive Sensoren) eingesetzt. Neben Funktionalitäten, die als reine Softwarekomponenten umgesetzt wurden und sowohl im Rahmen der Systeminteraktion als auch Datenvisualisierung durch die Benutzer*innen alleine benutzt werden, sind wie schon beschrieben mehrere Funktionen durch spezielle Services (die später real-umgesetzte Dienstleistungen abbilden) ergänzt.
Im Speziellen wurde auf Basis von Vitalparametermessungen sowie einem Telemonitoring und Analyse Prozess ein Healthcoach Service (im Rahmen eines medizinischen Care-Centers) realisiert. Durch spezielle Smartwatch-Interaktionen (Knopfdruck oder Touchscreenbedienung) konnte eine Notrufkette angestoßen werden, die final im Rahmen eines professionellen 24/7 Call Centers auf Basis von Anrufinteraktion und Metadatenanalyse eine Alarmkette anstoßen konnte. Im Folgenden werden die einzelnen Systemkomponenten nochmals detailliert beschrieben.
Abbildung 3-3: Smart VitAALity Systemkomponenten
3.3.1 Tablet
Im Rahmen der Smart VitAALity Systemumsetzung wurde ein handelsübliches Samsung-Tablet verwendet. Die Smart VitAALity Softwarelösung beinhaltet ein zentrales am Tablet dargestelltes User Interface, das einerseits die Ansteuerung der einzelnen als Applikationen umgesetzten Funktionen (siehe Kapitel 3.4) und andererseits die Visualisierung von relevanten Informationen (z.B. Gesundheitsdaten, Informationen, Hinweise) umsetzt.
Abbildung 3-4: Smart VitAALity Tablet und User Interface Beispielfunktion „Vitalwerte“
Auf dem Tablet (siehe Abbildung 3-4) haben die Benutzer*innen die Möglichkeit, die Smart VitAALity-App mit den drei Hauptfunktionsclustern Gesundheit, Information und Kommunikation zu verwenden, die sich auf die beschriebenen sQoL-Domänen Gesundheit und soziale Teilhabe beziehen. Das Tablet kann offen verwendet werden, d.h. es gibt keinen Kioskmodus, der den*die Benutzer*in auf eine Anwendung beschränkt. Dies unterstützt ein wichtiges Ziel des Projekts: die Medienkompetenz der Benutzer*innen zu verbessern. Das Tablet konnte als Stand-Alone Gerät (inkl. integrierter SIM Karte) zu Hause aber auch unterwegs verwendet werden.
3.3.2 Smartwatch
Als zusätzliche zentrale Interaktionskomponente wurde eine projektinterne Smartwatch (Abbildung 3-5) verwendet. Für das Projekt Smart VitAALity wurde die Software entsprechend den dargestellten Anwendungsfällen (Notruf per Knopfdruck und Call Center Service, Schritt- und Aktivitätserfassung, Informations- und Erinnerungsfunktion) integriert. Die Smartwatch verfügt über eine autonome Internetverbindung und eine integrierte SIM Karte, die überall und unabhängig von anderen Geräten genutzt werden kann.
Abbildung 3-5: Smart VitAALity Smartwatch
Die wichtigsten Funktionen umfassen eine einfache Überwachungsfunktion, einen Schrittzähler und eine Notruffunktion mit einem optionalen Call Center (mit einer Erreichbarkeit rund um die Uhr). Zusätzlich verfügt die Uhr über eine Kalenderfunktion, die mit dem Kalender des Tablets interagiert. Die Smart VitAALity Smartwatch war als ein vollwertiges Smartphone einsetzbar und ermöglicht das Versenden und Empfangen von Nachrichten sowie das Telefonieren.
3.3.3 Vitalparameter Mess-Set
Im Rahmen des Projektes wurden zur Erfassung von zentralen Vitalparameterwerten (Blutdruck, Blutzuckerlevel, Gewicht) klassische Messgerätesets (Blutdruckmessgerät, Blutzuckererfassung mittels Teststreifen und Analysegerät, Waage) verwendet (Abbildung 3-6), die zusätzlich die Daten automatisiert an eine in der Wohnung stationierte Gateway-Komponente übertragen konnten. Über spezielle Schnittstellen und Server-Infrastrukturen konnten die Daten einer Datenfusion mit erweiterten Parametersets (z.B. Schritte und Aktivitäten), einer Visualisierung am Tablet sowie einer Telemonitoring Komponente (zur Realisierung eines Care Center-Prozesses) zugänglich gemacht werden.
Abbildung 3-6: Smart VitAALity Vitalparameter Mess-Set
3.3.4 Smart Home Komponenten
Um die durch die Vitalparametermessgeräte (Blutdruck, Blutzuckerlevel und Gewicht) und die Smartwatch erfassten Parameter (Schrittanzahl und Aktivitäten) zu ergänzen, wurde zur Erfassung von ADL beschreibenden Parameter (Schlafenszeiten, Aktivitäten in der Wohnung) eine auf nicht-invasiver Sensorik basierende Smarthome Komponente (Abbildung 3-7) integriert und verwendet.
Abbildung 3-7: Smart Home Komponenten
Im Rahmen des Projektes wurde ein Set aus jeweils zwei PIR-Sensoren zur Erfassung von Aktivitäten in bestimmten Bereichen (Schlafzimmer und Wohnzimmer) sowie drei Sensoren zur Erfassung von Interaktionen im Wohnungsbereich (Küche, Toilette und Eingangstür) eingesetzt. Im Rahmen des Projektes war die Integration in Smart VitAALity Funktionen und einer weiterführenden Fusion der Daten als Hauptziel definiert. Zusätzlich wurden diese Komponenten auch generell bezüglich der Einsatzmöglichkeiten im (auch intimen) Wohnungsbereich und Einsatzgrenzen (bez. Privatsphäre) derartiger Technologien untersucht.
3.4 Smart VitAALity Anwendungsfunktionen
Auf Basis der in Kapitel 3.2 beschriebenen Interventionsdefinition sind entsprechend technologische Komponenten und dazugehörige Services umgesetzt worden. Die im System integrierten Komponenten und Services sind als Smart Living System im Alltag integriert worden (Meyer & Schulze, 2010; Mollenkopf et al., 2004), haben im Sinne einer Präventions-, Interventions- und QoL-Erhaltungsstrategie und dem langfristigen Ziel einer Optimierung der Lebensqualität ineinandergegriffen und unterstützten somit die Primärbenutzer*innen in verschiedenen Lebensphasen und Bedarfssituationen.
Die Funktionalitäten konnten sowohl alleinstehend verwendet werden als auch kombiniert, somit individuell auf ihre sQoL Wirksamkeit hin optimiert. Aktive Interaktionsschnittstellen waren ein Tablet und eine Smartwatch (siehe Kapitel 3.3) die verschiedene Services in einem zentralen (Visualisierungs- und Interaktions-) System/Konzept integrierten. Folgend wird ein Überblick über die in das System integrierten Funktionen, die generell auf die Dimensionen „Gesundheit“ (G1-G5) und „Soziale Partizipation“ (S1-S8) abgestimmt wurden, gegeben.





























