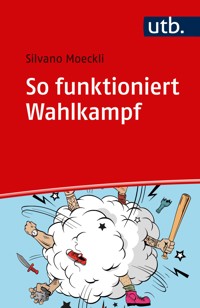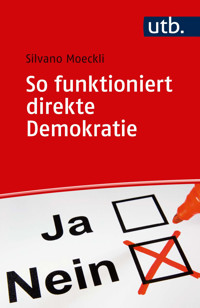
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch werden Ursprünge, Einrichtungen und Verfahren der direkten Demokratie auf kompakte und verständliche Weise dargestellt und erklärt. Zunächst wird erläutert, was direkte Demokratie ist und welche Typen von Sachabstimmungen es gibt. Es folgt ein Kapitel über die Geschichte der direkten Demokratie. In Analogie zu einem Mannschaftsspiel werden die Spielregeln der direkten Demokratie in verschiedenen Staaten beschrieben, die Spieler vorgestellt und der Spielverlauf verfolgt, inklusive möglicher Fouls. Schließlich werden die Spielergebnisse beurteilt. Auch neue Themen wie der Gebrauch des Internets in Abstimmungskampagnen oder die Deutungshoheit über den «Volkswillen» werden behandelt. Zahlreiche aktuelle Beispiele sowie 35 Abbildungen und Tabellen veranschaulichen und verdichten den Stoff.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvano Moeckli
So funktioniert direkte Demokratie
UVK Verlag München
© UVK Verlag München 2018 –ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH & Co. KG
Nymphenburger Straße 48 · 80335 Münchenwww.uvk.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ePub-ISBN 978-3-8463-5054-6
Inhalt
Für mein Patenkind Andreas
Professor Dr. Silvano Moeckli lehrt Politikwissenschaft an der Universität St. Gallen. Er ist ein ausgewiesener Experte für direkte Demokratie und hat darüber zahlreiche Publikationen verfasst, so das Standardwerk „Direkte Demokratie. Ein internationaler Vergleich.“ Der Autor ist nicht nur mit der politikwissenschaftlichen Theorie vertraut, sondern auch mit der politischen und wirtschaftlichen Praxis. Bevor Silvano Moeckli ein Universitätsstudium aufnahm, absolvierte er eine kaufmännische Berufslehre und das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg. Er war Mitglied des Präsidiums der Verfassungskommission des Kantons St. Gallen, gehörte der Bankkommission der St. Galler Kantonalbank an, war Mitglied der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz und des Kantonsparlaments St. Gallen, das er auch präsidierte. Missionen als Wahlexperte der UNO, der OSZE und des Europarates führten ihn nach Afrika, Asien, Osteuropa und auf den Westbalkan.
Vorwort
In meinem «Standardwerk» «Direkte Demokratie. Ein internationaler Vergleich» habe ich 1994 den Zustand und die Funktionsweise der direkten Demokratie in neun Staaten dargestellt und analysiert (Moeckli, 1994). Was hat sich seither verändert? In Europa hat sich die direkte Demokratie weiter verbreitet, insbesondere in den (wieder) entstandenen Demokratien in Mittel- und Osteuropa. Die Liste «aufsehenerregender» Volksabstimmungen ist länger geworden. Weltweit hat die direktdemokratische Bewegung neuen Schwung bekommen und sich international vernetzt. Die Bewegungen sind heute auch viel breiter aufgestellt und haben ihre Lobbyarbeit professionalisiert. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (dazu Abschnitt 6.9). Man kann sich heute viel leichter über Stand und Praxis der direkten Demokratie informieren als vor 25 Jahren. Zahlreiche Datenbanken erleichtern dies; zum Beispiel der Navigator zur direkten Demokratie (http://direct-democracy-navigator.org/) oder die Datenbank des «Centre for Research on Direct Democracy» (http://www.c2d.ch/). Das Internet erleichtert auch die Organisation direktdemokratischer Bewegungen und die Beteiligung am direktdemokratischen Prozess. So kann man über die sozialen Medien zum Mitmachen an direktdemokratischen Aktivitäten, zur Unterzeichnung von Volksinitiativen und Referenden oder zu Geldspenden aufrufen, und für die Europäische Bürgerinitiative (siehe Abschnitt 4.9) kann man auch online Unterschriften sammeln, wofür eine spezielle Software zur Verfügung steht.
Auch die Gesellschaft ist «demokratiereifer» geworden. Die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind im Durchschnitt besser gebildet als je, haben mehr Fremdsprachenkenntnisse, mehr Auslanderfahrung und kennen sich auch besser in anderen politischen Ordnungen aus als früher. So wissen heute viel mehr Menschen über die vielfältigen direktdemokratischen Einrichtungen in der Schweiz und den USA Bescheid. Mit durchschnittlich höherem Bildungsgrad werden auch die Anforderungen an die Qualität der Demokratie höher – und damit wird der Ruf nach direkter Demokratie stärker.
Die Wahlberechtigten sind heute insgesamt politisch selbstbewusster und besser gebildet als vor 50 Jahren und haben Zugang zu allen Informationen, die sie für einen sachgerechten Entscheid benötigen. Der «Normalbürger» empfindet die Parlamentsmitglieder nicht mehr länger als überlegen. Er erkennt, dass auch das Parlamentsmitglied mit unvollständigen Informationen entscheiden muss und dass auch anerkannte oder selbsternannte «Experten» die Zukunft nicht vorhersehen können. Und gerade die voraussichtlichen Wirkungen eines politischen Entscheids sind in einem Abstimmungskampf oft umstritten. Bei einer repräsentativen Befragung des Instituts für Demoskopie in Allensbach (Deutschland) im Mai 2012 wurde die Frage gestellt: «Neulich sagte uns jemand: ‚Wenn ich mir anschaue, was in der Politik so gemacht wird, denke ich mir oft: Die Politiker haben keine Ahnung, das könnte ich besser als die.‘ Denken Sie das auch öfter, oder ist das nicht der Fall?» Eine relative Mehrheit von 48 Prozent meinte: «Das denke ich auch öfter.»
Festzustellen ist auch eine Verwischung zwischen wissenschaftlicher Forschung und Wertengagement der Wissenschaftler. Ich selbst möchte auch nicht verhehlen, dass ich als Schweizer Bürger eine positive Grundhaltung zur direkten Demokratie habe. Dies mündet aber nicht in einen missionarischen Eifer und wird mich nicht davon abhalten, auch die Schattenseiten der direkten Demokratie auszuleuchten. Natürlich darf man davon träumen, dass es eine geniale dauerhafte politische Einrichtung gibt, welche viele Probleme auf einen Schlag nachhaltig löst. Aber eine solche hat es nie gegeben und wird es auch nie geben. Gute Institutionen wie die direkte Demokratie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie lern- und reformfähig sind.
Dieses Buch ist eine aktualisierte und erweiterte Fassung der Publikation «Direkte Demokratie», die 2013 im Rüegger Verlag erschienen ist. Ein spezieller Dank gilt Frank Rehmet, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Mehr Demokratie e.V., für die Unterstützung bei der Aktualisierung des Abschnitts 4.4 (Bundesrepublik Deutschland). Die Angaben über Abstimmungsergebnisse, die auf der Datenbank des «Centre for Research on Direct Democracy» (http://www.c2d.ch/) beruhen, konnten nicht aktualisiert werden, da die Website schon seit Ende 2017 «down» ist.
1Einleitung
1.1Naglers Sepp und das Veto im Kanton St. Gallen 1831
Joseph Eichmüller, «Naglers Sepp» genannt, war zu Beginn der Regenerationszeit 1830/31 Pintenwirt in Altstätten im St. Galler Rheintal. Sein Wirtshaus war in dieser Phase des politischen Umbruchs Sammelpunkt einer politischen Gruppierung, die sich «Demokraten» nannte. Es waren wohl seine Gegner, die ihm unterstellten, er solle als Wirt vor der Frage gestanden sein: «Was muss ich tun, auf dass die Nachbarn kommen zu trinken den güldenen Most?» Seine «Marketingstrategie» war: Predigen von der Souveränität des Volkes, von schweren Abgaben, vom Hochmut der Regenten, und wie die Weisen und Schriftgelehrten ruchlos wandelten vor dem Herrn. Und siehe da, die Bänke und Tische füllten sich (siehe Christian Jossi, in: Baumann et al., 2003, S. 185).
Am 13. Januar 1831 tagte im altehrwürdigen Gebäude des ehemaligen Klosters St. Gallen der Verfassungsrat des Kantons St. Gallen. Auf dem Klosterplatz hatten sich 600 mit Stöcken bewaffnete Bauern aus dem Rheintal zusammengerottet. Drahtzieher und Anführer dieser Demonstration war Joseph Eichmüller. Als Idealbild der Demokratie schwebte den Rheintaler Männern die nahen Appenzeller Landsgemeinden vor, weshalb sie lautstark die Einführung von Bezirkslandsgemeinden forderten. Die Sitzung musste unterbrochen werden, einzelne Ratsmitglieder mischten sich unter das Volk (B. Wickli, in: Graber, 2008, S. 44). Die Männer zogen «zufrieden» wieder ab, nachdem man ihnen die zum Volksveto bereits beschlossenen Artikel vorgelesen hatte (Henne, 1834, S. 135). Dieser Tag ist als «Stecklidonstig» in die Kantonsgeschichte eingegangen.
Die Einführung des Gesetzesvetos war damals lediglich ein Zugeständnis an die erregte Volksstimmung und an die politische Gruppierung der Demokraten, welche eine Art obligatorisches Gesetzesveto verlangt hatte. Aus der Sicht der politischen Mehrheit war es ein taktischer Schachzug zur Beruhigung der ungeduldigen Verfechter der direkten Demokratie. Schachzug deshalb, weil die Institution des Vetos mit so hohen Hürden versehen wurde, dass das Risiko, dass je ein Gesetz am Volksveto scheitern würde, als sehr gering eingeschätzt wurde. Anton Henne, der den Vorschlag des Vetos im Verfassungsrat eingebracht hatte, bezeichnete die Masse als unfähig, politische Entscheide zu fällen. Und als Modell für seine Idee schob er das Veto der Volkstribunen im alten Rom vor. Damit hatte das sankt-gallische Veto aber nichts zu tun; Henne lehnte sich offensichtlich an Bestimmungen der Französischen Verfassung vom 24. Juni 1793 an.
Wie sahen aber die Hürden aus, welche die tatsächliche Inanspruchnahme dieses neuen Volksrechtes verhindern sollten? Die Auslösung des Vetos hatte dezentral in den Gemeinden zu erfolgen. 50 Bürger mussten verlangen, dass eine Gemeindeversammlung abgehalten werde, um zu entscheiden, ob gegen ein erlassenes Gesetz Einwendungen gemacht werden sollen. Es genügte aber nicht, dass sich an der Gemeindeversammlung die Mehrheit der anwesenden Bürger gegen das Gesetz aussprach. Die Zahl der abgegebenen Nein-Stimmen musste vielmehr die Mehrheit aller stimmfähigen Bürger der Gemeinde ausmachen, denn Abwesende wurden als Ja-Stimmende deklariert (Vetoprinzip). Ein Gesetz war nur dann abgelehnt, wenn die Nein-Stimmen in allen Gemeinden innerhalb von 45 Tagen kantonsweit mehr als die Hälfte aller stimmfähigen Bürger ausmachten. Kam in einer Gemeinde das qualifizierte Nein mehr von 50 Prozent der Stimmberechtigten nicht zustande, zählten die abgegebenen Nein-Stimmen für das Kantonsvotum nicht.
Es erstaunt, dass trotz dieser Hürden in den folgenden 30 Jahren vier von 194 Gesetzen mittels des Vetos zu Fall gebracht wurden – bei insgesamt 40 Versuchen, ein Gesetz zu bekämpfen (Kölz, 1992, S. 314). Die demokratieskeptischen Urheber des Vetos wiegten sich 1831 also in Sicherheit. Realpolitisch hatten sie einen institutionellen Stolperstein aufgestellt. Das Veto war gedacht als symbolische Politik. Sie hätten sich wohl nicht träumen lassen, dass sie damit in den Köpfen eine Bewegung in Gang setzten, die sich nicht mehr stoppen ließ. So wurde aus dem sankt-gallischen Veto ideengeschichtlich ein Grundstein. Die erste direktdemokratische Institution auf Gesetzesstufe mit individueller Zählung der Stimmen war in einem Nichtlandsgemeindekanton verwirklicht. Die Idee griff auf andere Kantone über. Basel-Landschaft berief sich 1832 bei der Einführung des Vetos auf den Kanton St. Gallen.
Die Geschichte um Joseph Eichmüller und den «Stecklidonstig» ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass in der Politik Absicht und schließliches Ergebnis oft in einem seltsamen Zusammenhang stehen. Sie illustriert Max Webers Aussage: «Es ist durchaus wahr und eine … Grundtatsache, dass das schließliche Resultat politischen Handelns oft, nein: geradezu regelmäßig, in völlig unadäquatem, oft in geradezu paradoxem Verhältnis zu seinem ursprünglichen Sinn steht.» (Weber, 1977, S. 53). Ein Stolperstein wurde zum Grundstein (Moeckli, 1996a). Direkte Demokratie ist in den Anfängen oft symbolische Politik. Tiefere Hürden werden nicht gewährt; sie müssen erkämpft werden. Direkte Demokratie ist auch ein Vehikel, um das politische System zu verändern, insbesondere auch die Spielregeln der direkten Demokratie selbst. Heute braucht es übrigens im Kanton St. Gallen für ein Gesetzesreferendum 4‘000 Unterschriften, die innerhalb von 40 Tagen zu sammeln sind.
Die erste Geschichte lehrt: Direktdemokratische Instrumente werden nicht von oben gewährt, sondern müssen tatkräftig eingefordert werden. Und deren Wirkungen stehen oft in einem seltsamen Zusammenhang zur ursprünglichen Absicht.
Der Klosterplatz in St. Gallen heute (in der Mitte oben der Ratssaal)
1.2Die abgeblasene Volksabstimmung in Griechenland 2011
Am 1. November 2011 verblüffte Griechenlands Regierungschef Papandreou seine politischen Mitstreiter, sein Land, die EU und die Weltöffentlichkeit mit der Ankündigung, die Stimmberechtigten über neue Finanzhilfen für Griechenland und den Sanierungskurs abstimmen zu lassen. Die Opposition beschimpfte den Premier als unberechenbaren Spieler. Die EU-Partner waren perplex. Die spontanen politischen Bewertungen eines Referendums fielen in politischen und wissenschaftlichen Kreisen unterschiedlich aus. Kann es denn falsch sein, gewissermaßen in der Wiege der Demokratie, das Volk über das eigene Schicksal abstimmen zu lassen? Oder handelt es sich hier um einen raffinierten politischen Trick auf Kosten des Volkes, weil es eigentlich gar nichts zu entscheiden gab? Wollten die Politiker, die das Land in diese missliche Lage gebracht hatten, die Verantwortung einfach auf das Volk abschieben, um nach dem Scheitern sagen zu können «ihr habt es ja so gewollt»? Die Sachabstimmung – sie wäre die erste seit 1974 in Griechenland gewesen – wurde schließlich abgeblasen. Es bleibt aber die interessante Fragestellung, ob das Referendum eine gute oder eine schlechte Idee war. Ein Leser der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» meinte: «Das Land macht seiner Geschichte alle Ehre – endlich hin zur Basisdemokratie!». Ein anderer schrieb: «Papandreou kündigt Referendum über Hilfspaket an – wann folgt Merkel?»
Diese zweite Geschichte lehrt: Allein der Tatbestand, dass aus einer Notlage heraus eine Sachabstimmung organisiert wird, bedeutet nicht «mehr Demokratie» und sagt noch gar nichts über die Qualität der Demokratie aus. Sachabstimmungen können in autoritären politischen Systemen sogar ein Zeichen von verstärkter Repression sein. Die Meinung des Autors zum Plan des Referendums in Griechenland wird an anderer Stelle dieses Buches deutlicher werden.
1.3Die Internationalisierung der Politik als Gefahr für die Demokratie
Betrachtet man die Ideen- und Institutionengeschichte der direkten Demokratie weltweit und setzt diese in Beziehung zur tatsächlichen Mitgestaltungsbefugnis des Elektorats, dann fällt die Diagnose einigermaßen paradox aus. Auf der einen Seite gibt es immer drängendere Forderungen nach mehr (direkter) Demokratie, und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben etliche Staaten bei Verfassungsrevisionen oder auf starken zivilgesellschaftlichen Druck von unten direktdemokratische Instrumente ausgebaut oder neu eingeführt.
Auf der anderen Seite erfordern die zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Staaten und insbesondere die seit 2008 anhaltende Finanz- und Staatsschuldenkrise mehr intergouvernementale Kooperation, was auf Kosten der Demokratie ganz allgemein und der parlamentarischen und direkten Demokratie im Besonderen geht. Schicksalshafte irreversible finanz- und währungspolitische Entscheide werden von einer kleinen Elite von Regierungs -, Banken- und Zentralbankenvertretern getroffen; das Volk kann nicht mitreden oder gar mitentscheiden, trägt aber die negativen Neben- und Spätfolgen. Unter Zeit- und Entscheidungsdruck werden die jeweiligen Beschlüsse gefasst und als «alternativlos» deklariert. Das Wesen der Demokratie wäre aber gerade, dass man unter mehreren Möglichkeiten auswählen kann und dass vor einem wichtigen Entscheid ein breiter Diskurs stattfindet, der Zeit braucht. Wenn hoheitliche Befugnisse zunehmend auf überstaatliche Instanzen verlagert werden, dann höhlt dies den Wirkungsbereich der direkten Demokratie auf staatlicher, gliedstaatlicher und kommunaler Ebene aus. Die Institutionen auf überstaatlicher Ebene werden dann weitgehend von nationalen Regierungen und übernationalen Administrationen «betrieben»; selbst parlamentarische Kontrollrechte über den Finanzhaushalt und die Regierungsführung fallen weg. Die Internationalisierung entfernt die Politik immer weiter von der Bürgerschaft. In Staaten mit ausgeprägtem Föderalismus wie der Schweiz wird die Tendenz zur Gouvernokratie durch die horizontale Kooperation der Regierungen der Gliedstaaten noch verstärkt (dazu Moeckli, 2009). Die Entscheidungsvorbereitung und die Umsetzung verschieben sich in undemokratische, außerparlamentarische und nichtöffentliche Arenen. Weil keine parlamentarische Kontrolle besteht, eröffnen sich Interessengruppen neue Möglichkeiten des außerparlamentarischen Networkings und Lobbyings. Es ist zwar richtig, dass die Elektorate bzw. Parlamente in einzelnen Staaten darüber entscheiden können, ob der Staat einer bestimmten supranationalen Organisation beitritt oder nicht bzw. ob die Zusammenarbeit durch einen Staatsvertrag vertieft wird. Ein Vetorecht besteht also. Ist der Staatsvertrag aber einmal in Kraft, ist die direkte Demokratie in ihrem Wirkungsbereich eingeschränkt, denn die Bereiche, die staatsvertraglich geregelt sind, entziehen sich künftig dem Zugriff der direktdemokratischen Instrumente innerhalb der Staaten.
Bestrebungen, dem durch die Internationalisierung bewirkten Demokratiedefizit entgegenzuwirken, gibt es von Seiten der Hauptakteure der internationalen Politik kaum (siehe Alois Riklin, in: Brühlmeier, Mastronardi und Bächtiger, 2016, S. 271). Initianten von Volksinitiativen bleibt oft nur die Option, die Kündigung jenes Staatsvertrages anzustreben, der die Beschreitung des direktdemokratischen Wegs blockiert.
1.4Hoffnungsträgerin direkte Demokratie
Nicht erst seit der Finanz -, Staatsschulden- und Eurokrise ist die direkte Demokratie zu einer Hoffnungsträgerin geworden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und dem Ende des kommunistischen Ostblocks war der Hunger nach Freiheit und politischer Partizipation in den neu geformten Staaten und wieder aufblühenden Demokratien stark. Staaten wie Ungarn, Slowenien, Lettland, Litauen und die Slowakei nahmen substantielle direktdemokratische Mitwirkungsrechte in ihre Verfassungen auf. Dasselbe gilt für die neuen Gliedstaaten der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Aber auch mehr und mehr Menschen in den traditionellen Demokratien, die von der repräsentativen Demokratie enttäuscht sind und sich übergangen fühlen, fordern direkte Demokratie. Hinzu kommt eine generelle Politik- und Parteienverdrossenheit, was sich auch in anfänglichen Wahlerfolgen für neue und unverbrauchte Parteien wie der Piratenpartei manifestiert. Es wächst das Unbehagen darüber, dass der Input ins politische System immer stärker durch finanzstarke Lobbys dominiert wird und der Output ihren Interessen dient, nicht «dem Volk». Dies bedarf eines Korrektivs – und dieses könnte die direkte Demokratie sein. Über die Desillusionierung über die Leistungsfähigkeit des parlamentarischen Systems legt sich der Hoffnungsschimmer der direkten Demokratie. Direkte Demokratie ist auch eine Projektionsfläche, auf der sich die Sehnsucht nach einer bürgernahen und bürgergeerdeten politischen Ordnung spiegelt.
Neu entfacht wird die Diskussion um die Sinnhaftigkeit von direkter Demokratie jeweils nach spektakulären Abstimmungen bzw. Abstimmungsergebnissen, die ein großes mediales Echo hervorrufen. Das begann 1978 in Kalifornien mit Proposition 13, was den Auftakt zur sogenannten «Tax Revolt» bildete. Aufmerksamkeit erregten auch die Ablehnung des Euro in Schweden 2003, die negativ ausgegangenen Abstimmungen über die EU-Verfassung 2005 in Frankreich und den Niederlanden, die Abstimmungen in Großbritannien über das Wahlrecht (5.5.2011) und den «Brexit» (23.6.2016), die Abstimmung über Stuttgart 21 (27.11. 2011), die Abstimmung über die Eidgenössische Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» am 29. November 2009, erfolgreiche Volksinitiativen zur Legalisierung von Cannabis in Colorado 2012 (Marijuana Legalization Initiative) und in Kalifornien 2017 (Proposition 64) sowie das konsultative Referendum in den Niederlanden über das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine vom 6. April 2016. Auch das neue politische Initiativrecht in der EU («Europäische Bürgerinitiative») gemäß dem Vertrag von Lissabon, das seit dem 1. April 2012 wirksam ist, hat die Diskussion animiert.
In vielen europäischen Staaten haben sich direktdemokratische «Basisbewegungen» gebildet, so «Mehr Demokratie» in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Erwähnenswert sind auch die wissenschaftlichen Institute, die sich dem Thema direkte Demokratie widmen, so das Initiative & Referendum Institute Europe und die gleichnamigen Institute in den USA und in Asien, das Zentrum für Demokratie in Aarau (mit dem Centre for Research on Direct Democracy c2d), die Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie an der Philipps-Universität Marburg, das Deutsche Institut für Sachunmittelbare Demokratie an der Technischen Universität Dresden sowie die zahlreichen Websites zum Thema direkte Demokratie (siehe die Liste am Schluss). «Democracy International» ist eine globale Koalition von Bürgern und Nichtregierungsorganisationen, die das Ziel hat, direkte und partizipatorische Demokratie zu fördern. Die sozialen Netzwerke fördern heutzutage die Knüpfung von Kontakten und den Austausch von Informationen und Erfahrungen unter den Aktivisten. So hat beispielsweise der Twitter-Account «@mehr_demokratie» rund 12'000 Follower (Stand März 2018).
1.5Idee dieses Buches
Die Zahl der Publikationen, Websites und Datenbanken zur direkten Demokratie ist parallel mit dem politischen Interesse stark gewachsen – nicht allein in deutscher und englischer Sprache. Nur beispielhaft seien hier die Publikationen von Merkel/Ritzi (2017), Qvortrup (2014), Tiefenbach (2013), Kaufmann, Büchi und Braun (2010), Weiß (2010), (Kost, 2013), Freitag und Wagschal (2007), Zittel und Fuchs (2006) und Matsusaka (2004) angeführt. Heute bildet also nicht mehr der Mangel, sondern sind vielmehr die Flut von Informationen, Begriffsverwirrungen und falsche Vorstellungen über die Funktionsweise der direkten Demokratie das Problem. Publikationen in Buchform, welche den Stoff systematisieren, verdichten und bewerten, bleiben deshalb unverzichtbar.
Welchen Mehrwert möchte ich mit diesem Buch schaffen? Idee, Institutionen, Praxis und Wirkungen der direkten Demokratie sollen kompakt beschrieben und erklärt werden. Dabei soll nicht lediglich Faktenwissen zur institutionellen Ausgestaltung und der Inanspruchnahme der direkten Demokratie aufgehäuft werden – darüber kann man sich heute auf einschlägigen Websites informieren (siehe die erwähnte Liste am Ende des Buches). Ich möchte vielmehr Orientierung bei der Beurteilung der Vorzüge und Mängel der direkten Demokratie bieten, damit Streitfragen nach Sinn und Wesen der direkten Demokratie besser beurteilt werden können. Wichtigste Voraussetzungen dafür sind eine exakte Begriffsbildung und eine klare Strukturierung.
1.6 Das «Spiel» der direkten Demokratie
Aus didaktischen Gründen wähle ich zur Strukturierung und Erklärung die Analogie zu einem Spiel. Leserinnen und Leser können sich direkte Demokratie als ein Mannschaftsspiel vorstellen, bei dem (mindestens) zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Nun ja, Demokratie bzw. direkte Demokratie ist natürlich viel mehr als ein Spiel, sondern nüchterne politische Realität mit zuweilen einschneidenden Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Es geht um eine geregelte Zuteilung und Ausübung von Macht sowie um wichtige autoritative Entscheide für ein ganzes Volk, soziale Gruppen und einzelne Menschen. Es geht um das Mitwirken der Einzelnen am Staat, um die Auswirkungen staatlicher Entscheide auf die Einzelnen und um die Koppelung zwischen Regierenden und Regierten.
Aber als didaktisches Hilfsmittel zur Erklärung der Funktionsweise der direkten Demokratie ist das Bild des Spiels, insbesondere einer Mannschaftssportart, durchaus geeignet. Ein Spiel funktioniert nur, wenn es faire und allgemein akzeptierte Spielregeln gibt. Nach diesen Spielregeln wird dann das Spiel gespielt. Es gibt Gewinner und Verlierer. Die Gewinner fragen gewöhnlich nicht nach der Fairness der Spielregeln, wohl aber die Verlierer. In jeder Sportart müssen sich die Verantwortlichen periodisch überlegen, ob die Gebote der Fairness und Akzeptanz bei den Spielregeln noch erfüllt sind. Und natürlich ist es entscheidend, wer diese Spielregeln festlegt. Wie beim Mannschaftssport spielt man bei der direkten Demokratie nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil einer Mannschaft im gleichen Trikot. Die Frage ist dann noch, ob es einen Schiedsrichter gibt, und falls ja, wer diesen bestimmt und welche Befugnisse er hat. Schließlich stellt sich die Frage nach den Auswirkungen des Spiels auf die betroffenen Menschen. Ein Fußballspiel kann zu Freudentaumel führen, aber auch zu Tumulten, ja sogar zu «Fußballkriegen». Mit politischen Entscheiden ist es ähnlich.
Und noch eine Analogie zu einem Fußballspiel können wir bei der Unterscheidung von repräsentativer und direkter Demokratie machen. Bei der repräsentativen Demokratie wird auch gespielt, aber mit viel weniger und immer etwa den gleichen Spielern, die entweder auf der Regierungs- oder der Oppositionsbank sitzen. Die Zuschauer können zwar periodisch entscheiden, ob die Spieler die Bänke wechseln müssen (bei Wahlen); aber selbst mitspielen können sie nicht. Bei der direkten Demokratie geht das: selbst ein Spiel ansetzen und mitspielen, als Stürmer, im Mittelfeld oder als Verteidiger.
Ich werde also folgende Fragen aufwerfen und beantworten: Wie sind die Spielregeln (Institutionen) der direkten Demokratie ausgestaltet (Kapitel 4)? Welche Spieler (Akteure) sind mit dabei (Kapitel 5)? Wie verläuft das Spiel (Prozesse in der direkten Demokratie, Kapitel 6). Wie sind die Resultate und was haben sie für Auswirkungen (Kapitel 7)? Zu Beginn erkläre ich, um welches Spiel es sich handelt, und wie es eigentlich entstanden ist (Geschichte, Kapitel 3).
2Begriffe und Typen direktdemokratischer Verfahren
2.1Was ist direkte Demokratie?
Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit von Volksabstimmungen über Sachfragen gehen im politischen und wissenschaftlichen Diskurs weit auseinander. Bevor man aber an diese Streitfrage herangehen kann, muss man klären, wovon man spricht. Was ist direkte Demokratie? Wir brauchen eindeutige Begriffe.
Wie der Begriff «direkte Demokratie» schon ausdrückt, ist direkte Demokratie eine spezielle Form der Demokratie. Bevor wir das Spezielle betrachten, müssen wir das Allgemeine kennen, also wissen, was Demokratie ist. Das wird uns auch erlauben, zwischen den allgemeinen Vorzügen und Mängeln von Demokratie und von direkter Demokratie zu unterscheiden. Die Gefahr beispielsweise, dass die Anliegen von Minderheiten übergangen oder gar unterdrückt werden, gibt es in jeder Form von Demokratie, nicht nur in der direkten.
Politische Systeme können wir grob in zwei Typen unterteilen: demokratische und autokratische Systeme. Das wichtigste Merkmal der Demokratie ist es, dass die Herrschaftsträger (Präsident, Regierung, Parlament, Justiz) direkt oder indirekt durch das Elektorat gewählt und abgewählt werden, während in der Autokratie keine solche Rückkoppelung zwischen Regierenden und Regierten besteht (vgl. Abbildung 2). Die Herrschaftsträger ergänzen sich dort selbst. Wahlen werden «für die Galerie» abgehalten. Vergessen wir nicht, dass die Mehrheit der Staaten weltweit keine gefestigten Demokratien sind. Nach dem Rating von «Freedomhouse» waren 2017 von den 195 Staaten 87 «frei», 59 «teilweise frei» und 49 «unfrei».
In der Demokratie können wir drei Untertypen unterscheiden. Ist das Elektorat nur für die Wahl des Parlaments zuständig, so nennen wir dies eine repräsentative Demokratie (die Parlamentsmitglieder «vertreten» das Elektorat). Wählt das Elektorat zusätzlich auch einen Staatspräsidenten mit Regierungsbefugnissen, nennen wir dies eine präsidiale Demokratie. Kann das Elektorat zusätzlich über Sachfragen (und nicht
Typen der HerrschaftQuelle: Moeckli (2017a, S. 25)
nur über Personenfragen) abstimmen, so nennen wir dies eine direkte Demokratie. Direkt deshalb, weil Gesetzes -, Verfassungs- oder andere wichtige Fragen nicht abschließend durch das Parlament entschieden werden, sondern direkt durch das Elektorat.
In der direkten Demokratie kann das Elektorat über die Wahl des Parlaments hinaus also direkt über Sachfragen entscheiden. Es besteht eine zusätzliche Rückkoppelungsschlaufe zwischen Regierenden und Regierten. Mit dem Referendum können Entscheide des Parlaments aufgehoben werden, mit der Volksinitiative können Anliegen unter Umgehung des Parlaments direkt zur Volksabstimmung gebracht werden. Wesensmerkmal der direkten Demokratie sind nicht Abstimmungen über Sachfragen, sondern ist der minoritäre Charakter der Auslösung einer Sachabstimmung. Ein Teil des Elektorats kann gegen den Willen der politischen Mehrheit eine Sachabstimmung auslösen. Sachabstimmungen sind in den meisten Staaten der Welt möglich. Durch Unterschriftensammlungen erwirkte Volksabstimmungen (Bottom-Up Direct Democracy) gibt es aber nur in 38 Staaten (Serdült & Welp, 2012, S. 76) .
Sachabstimmungen werden auch in autoritären und semiautoritären politischen Systemen durchgeführt, aber sie werden dort durch die politische Führung inszeniert und haben meist die Funktion der Beschaffung von öffentlicher Anerkennung für das Herrschaftssystem oder eine Führerfigur, ohne dass vor der Abstimmung eine freie Meinungsbildung stattfinden kann (sogenanntes Plebiszit).
Volksabstimmung in Österreich über den «Anschluss» 1938 (Plebiszit)
Der Abstimmungszettel in Abbildung 3 weist die typischen Merkmale eines Plebiszits auf. Die Abstimmung erfolgt erst, nachdem der «Anschluss» bereits Tatsache ist («vollzogene Wiedervereinigung»). Der «Ja-Kreis» ist größer als der «Nein-Kreis». Die Stimmbürger werden gleich mit dem vertrauten «Du» angesprochen. Und schließlich ist die Abstimmung zugleich eine Wahl (natürlich nur mit einer Liste). Das Abstimmungsergebnis lautete übrigens: 99 Prozent Ja im Alt-Reichsgebiet, 99,7 Prozent in Österreich. Die Abstimmungsbeteiligung betrug 99 Prozent. Ein ähnliches Ergebnis ergab sich beim Plebiszit vom 16. März 2014 über den Anschluss der Krim an Russland: 97,5 Prozent Ja.
2.2Begriffe zur direkten Demokratie und Typen von Volksabstimmungen
Die Begriffsbildung und Typologie zur direkten Demokratie ist sowohl in einzelnen Staaten wie auch innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft alles andere als einheitlich und verursacht deshalb öfters Konfusionen. In Deutschland beispielsweise wird von «Volksbegehren» und «Volksentscheid» (auf Länderebene) bzw. «Bürgerbegehren» und «Bürgerentscheid» (auf kommunaler Ebene) gesprochen. Das «initiierende Bürgerbegehren» entspricht der schweizerischen Volksinitiative oder der amerikanischen «popular initiative». Das «kassierende Bürgerbegehren» (bzw. «Populareferendum») entspricht dem schweizerischen fakultativen Referendum (in den USA: «optional referendum»). Ebenfalls in Gebrauch sind die Begriffe «Volksgesetzgebung» und «plebiszitäre Demokratie», neuerdings sogar «sachunmittelbare Demokratie». In der Schweiz wird auch der Begriff «halbdirekte Demokratie» verwendet. Es ist eine definitorische Frage, ob man die Abberufung zur direkten Demokratie zählt oder nicht. In den USA ist dies gewöhnlich der Fall. Nach meiner Begriffsbildung gehört sie nicht dazu, denn es geht um eine Personenfrage.
In Abbildung 4 gehen wir davon aus, dass bereits eine Volksabstimmung erfolgt ist. Wir analysieren diese Abstimmungen im Nachhinein nach verschiedenen Kriterien. Wir umgehen damit die (in der Schweiz und in den USA ohnehin nicht übliche) Unterscheidung zwischen Volksbegehren (Einleitung) und Volksentscheid (Abstimmung), denn um direkte Demokratie kann es im Kern nur dann gehen, wenn am Schluss eine Volksabstimmung möglich ist.
Typologie von Volksabstimmungen© Silvano Moeckli
Handelt es sich um eine Personen- oder eine Sachfrage? In der repräsentativen Demokratie wird über Personen abgestimmt, in der direkten über Sachgegenstände.