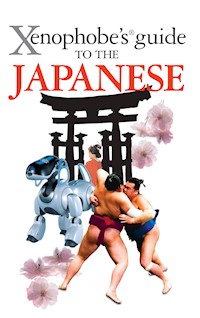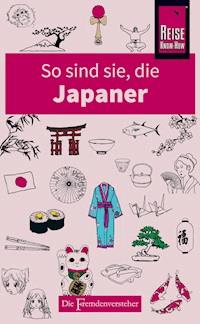
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Die Fremdenversteher
- Sprache: Deutsch
Geben wir es ruhig zu: Die Japaner sind manchmal seltsam. Sie essen seltsame Dinge. Sie benehmen sich seltsam. Sie sind mal zu steif und mal ein bisschen zu locker. Sie lachen über Dinge, die nicht lustig sind. Die Fremdenversteher liefern Antworten: Knapp, bissig und voller überraschender Einsichten. Am Ende ist klar: So sind sie eben, die Japaner! Die Fremdenversteher über die Japaner: "Japaner sind von Haus aus gesellig – Individualität und Egoismus sind genauso willkommen wie ein Sumoringer, der sich am Büffet vordrängelt. [...] In Japan möchte sich jeder von allen anderen unterscheiden und zwar auf genau die gleiche Art." Die Fremdenversteher: Die Reihe, die kulturelle Unterschiede unterhaltsam macht. Mit trockenem englischen Humor, Mut zur Lücke, einem lockeren Umgang mit der politischen Korrektheit – aber immer: feinsinnig und auf den Punkt. Die Fremdenversteher sind die deutsche Ausgabe der Xenophobe's® Guides – bei Reise Know-How. Die Fremdenversteher: Empfohlen bei leichter bis mittelschwerer Xenophobie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Nationalgefühl & Identität
Charakter
Manieren & Etikette
Regierung
Systeme
Bräuche & Traditionen
Essen
Geschäftspraktiken
Familienangelegenheiten
Hygiene, Gesundheit & gutes Aussehen
Bräuche & Traditionen
Humor
Freizeit & Vergnügen
Sprache
Die Autoren
Die Japaner nennen Japan „Nippon“ oder „Nihon“, was soviel bedeutet wie Ursprung der Sonne. In der japanischen Mythologie heißt es, dass die Japaner und ihr Land von einer Sonnengöttin abstammen. Daher die Herkunft des Namens. Das Wort Japan, das im Westen verwendet wird, hat seinen Ursprung von der chinesischen Aussprache der Wortzeichen „Sonne“ und „Herkunft“.
Japans 7.000 Inseln summieren sich zu einer Fläche, die etwas größer als Deutschland und in etwa gleichgroß wie der US-Staat Montana ist. Mit 127 Millionen Einwohnern verbucht Japan 41 % der Bevölkerung der USA. Stopft man aber beinahe die Hälfte der US-Bürger in 25 % der Fläche von Montana, hat man ein genaueres Bild davon, wie man in Japan lebt.
Nationalgefühl & Identität
Was das Japanischsein ausmacht
Für die Japaner ist die Welt zweigeteilt: „Wir Japaner“ und alle anderen (oder vage „Westler“, da alles, sogar Hawaii, als westlich von Japan gilt).
Fünf Sechstel Japans sind unbewohnbar, da das Land so bergig ist, dass dort nur Kiefern existieren können und es keine Straßen, Häuser oder Fabriken gibt. Das übrige Sechstel, vor allem an der Küste, ist unbewohnbar, da es weiter nichts als Straßen, Häuser und Fabriken gibt. Das bedeutet, dass die Japaner so dicht aufeinander leben, dass jede Idee von Individualität oder sich nicht auf eine andere Person verlassen zu können, komplett aus dem Denken gelöscht wurde.
Japaner sind von Haus aus gesellig – Individualität und Egoismus sind genauso willkommen wie ein Sumoringer, der sich am Buffet vordrängelt. Sie betrachten Homogenität als eine ihrer Stärken. Sätze beginnen oft mit „Wir Japaner“, als ob sie alle identisch handelten und genau die gleichen Auffassungen hätten. Das Resultat ist ein starkes Gefühl von uchi, was „drinnen“ bedeutet, zum Beispiel „wir“ oder „zu Hause“, und soto, was „draußen“ bedeutet, zum Beispiel „die anderen“ oder „im Ausland“.
Um ernst genommen zu werden, damit dem eigenen Wohlergehen die angemessene Aufmerksamkeit zuteil wird, in anderen Worten, um den Japanern überhaupt etwas zu bedeuten, muss man uchi sein. Ist man das nicht, kann man kaum Rücksicht erwarten: Man ist dann soto und wird damit schlicht mit Nichtbeachtung gestraft. Man ist unsichtbar. Für die Japaner sind Ausländer die allermeiste Zeit über soto.
Japan ist uchi, alles andere ist soto – also können sich die Japaner in Übersee anders verhalten. Dort kann man seine Meinung kundtun, zugeben, dass man eigentlich überhaupt gar nicht heiraten oder Rechnungswesen studieren möchte – solange es zu Hause niemand mitbekommt. „Scham auf der Reise wird zurückgelassen“, sagt ein Sprichwort praktischerweise. Es verwirrt manchen Europäer, wenn er merkt, dass sich das so lebhafte, Spaß liebende, unabhängige japanische Mädchen, das er auf seiner Reise kennengelernt hat, zu Hause in eine demütige Ja-Frau verwandelt.
An seine uchi-Freunde plaudert man seine innersten Geheimnisse aus. Mit reinen Bekannten bleibt es beim Gespräch über das Wetter. Man sollte diese beiden Einstellungen unter keinen Umständen durcheinanderbringen. Folglich wird auch die Anwesenheit eines Fremden im Fahrstuhl oder auf einem Gang nicht zur Kenntnis genommen. Türen werden einem vor der Nase zugeschlagen, Ellenbogen in die Rippen gerammt, Aktenkoffer hinterlassen blaue Flecken auf den Knien und niemand entschuldigt sich. Gehört man allerdings zum Bekanntenkreis, vorzugsweise als Kunde, wird der rote Teppich ausgerollt.
Japaner finden eine solch plötzliche Kehrtwende vollkommen normal. Bei der Unterscheidung von uchi und soto geht es darum, die Welt in noch zu handhabende Proportionen einzuteilen. Man wird dazu erzogen, füreinander zu sorgen. Offensichtlich kann man sich aber nicht um alle kümmern, also kommen uchi zuerst und Fremde zuletzt. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Und für die Japaner ist die Küstenlinie Japans der geeignete Ort hierfür.
Wie sie die anderen sehen
Um Japaner zu sein, muss man einen japanischen Namen und ausschließlich japanisches Blut in den Adern haben. Alle anderen sind gaijin („Außenseiter“/„Ausländer“) und können niemals Japaner werden. Ist man ein „echter“ westlicher gaijin, werden Japaner enttäuscht sein, wenn man nicht groß, blond und blauäugig ist. Diese Merkmale haben eine große Anziehungskraft, vor allem auf jüngere Japaner, von denen viele Kontaktlinsen tragen, um ihre Augen blau wirken zu lassen, und sich die Haare färben. Westliche Models, Schauspieler und Rockstars werden als das Nonplusultra optischer Attraktivität angesehen und darum von den Medien für alle Arten von Anzeigenkampagnen von Autos bis hin zu Hustenbonbons angeworben.
Für die Mehrheit der Japaner werden Ausländer Pi mal Daumen in drei Kategorien eingeteilt: a) die Dunkelhäutigen, b) Koreaner und c) Amerikaner (wobei selbst Briten als Amerikaner eingestuft werden. Die japanische Liebesaffäre mit Amerika geht tief. Auf die Frage „Welcher Nationalität würden Sie gern angehören, sollten Sie wiedergeboren werden?“ antworteten 30 % der Befragten „der amerikanischen“).
Da Korea früher eine japanische Kolonie war, leben und arbeiten sehr viele Koreaner in Japan. Die japanische Verfassung verbietet jegliche Form von Diskriminierung – aber nur gegen japanische Bürger und da es Koreanern nicht möglich ist, die japanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, sind sie davon ausgenommen. Diskriminierung ist ein heikles Thema – das deshalb vermieden wird. Die japanische Art mit etwas umzugehen, das man nicht akzeptabel findet, ist, dass man nicht darüber spricht: Wenn etwas nicht eingestanden wird, kann es als nicht existent angesehen werden.
Westler sind in Japan davon befreit, sich japanisch zu verhalten und selbst das gröbste Fehlverhalten wird einem noch vergeben, weil man ein gaijin ist; ein Wort übrigens, das man aus Höflichkeit nie aussprechen würde; ein Wort, für das Mütter ihre Kinder ausschelten, wenn sie es aussprechen. Gaijin verkörpert eine Kombination aus Faszination und Verachtung dem „ungebärdigen“ Westler gegenüber, mit der darunterliegenden Bedeutung „Er/Sie ist kein Japaner. Er/Sie wird niemals Japaner werden können, wie reich, intelligent und gutaussehend er/sie auch immer sein mag … arme Seele … wir müssen sie höflich behandeln.“
Die Japaner denken, dass sie dank ihres Wissens, ihrer Ausbildung und Forschung den Rest der Welt viel besser kennen, als jemals ein Ausländer sie kennen könnte. Folglich wird ein Ausländer, der Japanisch spricht und der japanischen Kultur Wertschätzung zollt, als henna gaijin (sonderbarer Ausländer) bezeichnet. Das Volk ist davon überzeugt, dass, auch wenn die Ausländer sie niemals verstehen werden, sie selbst diese sehr wohl verstehen werden, wenn sie sie nur lange genug ertragen.
Wie sie gesehen werden möchten
Die Japaner möchten als ordentliche, hart arbeitende Leute angesehen werden, die die Erwartungen erfüllen – und bei jeder Aufgabe die Nase vorn haben. Ihr Ideal aber ist, in aller Heimlichkeit super-intelligent zu sein. Wie sie selbst sagen: „Der weise Falke verbirgt seine Klauen“. Das Gegenteil wäre die ultimative Demütigung.
Zu diesem Zweck treiben sie sich bei der Arbeit, beim Sport und selbst in ihrer Freizeit dauernd an. Als sie von der Welt dafür kritisiert wurden, dass sie zu hart arbeiten würden, produzierten sie Fernsehprogramme darüber, wie man ein geruhsames Wochenende verbringen könnte – die alle am Wochenende sahen und mit großer Intensität studierten.
Aus der Angst heraus, als Faulenzer angesehen zu werden, nehmen die Menschen keinen Urlaub. Da Firmen ihre Angestellten ermuntern wollten, wenigstens ein paar Tage Urlaub zu machen, blieb ihnen aus schierer Verzweiflung nur die Möglichkeit, ihre Büros und Fabrikhallen komplett zu schließen, auch wenn sie dadurch Zehntausende von Arbeitssüchtigen zu einem elenden „Urlaub“, geplagt von Entzugserscheinungen, verdammten.
Charakter
Kein „Ja“ oder „Nein“
Japaner werden selten eine Frage mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Man missbilligt direkte Fragen ebenso wie direkte Antworten. Die übliche Antwort wäre Ma oder Mama, was soviel bedeutet wie „gewissermaßen“, „so ungefähr“ oder „mehr oder weniger“. Sie werden mhm und aha murmeln, zaudern und die Dinge eher offen lassen, als sich selbst zu einer Entscheidung durchzuringen. Wird ein japanischer Mann als „entscheidungsfreudig“ angesehen, gilt das als Charakterschwäche, und für eine japanische Frau gilt, dass es schlimmer ist, eigensinnig genannt zu werden als hässlich.
Ein japanischer Geschäftsmann hat den Unterschied zwischen Japanern und Westlern einmal so erklärt, dass Japaner analog und Westler digital seien. Eine Digitaluhr gibt die Zeit präzise, aber ohne Zusammenhang an. Eine Analoguhr auf der anderen Seite kann die genaue Information nur anzeigen, wenn man den Stundenzeiger, den Minutenanzeiger und das Ziffernblatt zusammen abliest. Japaner sehen sich selbst als Teile dieser Uhr, immer in Harmonie arbeitend und logisch dem Fluss ihres Lebens weiter folgend.
Vorlieben werden kaum ausgesprochen. Dies kann Dinge teuer machen. Lädt man zum Beispiel jemanden zum Essen ein, fragt man nicht nach seinen Ernährungsbedürfnissen. Das wäre zu direkt. Aus diesem Grund muss man sich auf alle möglichen ernährungstechnischen Eventualitäten vorbereiten.
Spricht man mit Japanern, ist es darum gut, Folgendes im Hinterkopf zu behalten:
– Sagen sie Ja, meinen sie Nein.
– Sagen sie Vielleicht, meinen sie wahrscheinlich Ja oder Nein oder andernfalls Möglicherweise.
– Wird man von allen angelächelt, bedeutet dies, dass man etwas unheimlich Anstößiges und Geschmackloses begangen hat (zum Beispiel das Essen mit den Stäbchen aufgespießt) und dass alle sich wünschen, man würde nach Hause gehen.
Gegenseitiges Verständnis
Aufgrund der ganzen Unentschlossenheit werden die Japaner von Kindesbeinen an darauf trainiert, die Gedanken des Anderen zu lesen, um irgendwie doch einen gewissen Fortschritt zu erzielen.
Die Quintessenz der unausgesprochenen Verständigung findet man in dem Wort yoroshiku: „Du hast verstanden, was ich von dir möchte. Ich habe verstanden, dass du verstanden hast, was ich von dir möchte. Deshalb überlasse ich es dir, die Aufgabe zu erfüllen und erwarte, dass dies auf die Art geschieht, wie ich es mir wünsche. Und ich danke dir dafür, dass du mich verstehst und für dein Einverständnis, die Mühen dieser Aufgabe auf dich zu nehmen.“ Und das alles in vier Silben.
Unter der Matte, hinter den Worten
Japaner lesen zwischen den Zeilen oder, um genau zu sein, hinter den Worten. Jeder weiß um den tatsächlichen Stand der Dinge, dass hinter tatemae – der „offiziellen Position“ oder dem, was in Worten ausgedrückt wird – eine honne, eine „wahre Stimme“ liegt, eine undefinierbare Masse menschlicher Emotionen, die den eigentlichen Stand der Dinge reflektiert. Diese bleibt im Hintergrund verborgen und muss vom scharfsichtigen Gesprächspartner erkannt werden. Die Japaner werden sich mental oder gar physisch still und leise von jemandem zurückziehen, der es nicht versteht, diesen Unterschied zu erkennen.
Die gegenseitigen versteckten Meinungen perfekt zu verstehen, was auch immer gesagt wird, ist nicht so außergewöhnlich, wie es klingen mag. Wenn es sich nicht um enge Freunde handelt, ist was sie zueinander sagen auf ca. zwanzig Phrasen beschränkt.
Sie erfassen die verstecktesten Hinweise auf die wirklichen Gefühle des Sprechenden, zum Beispiel durch deren Ausdrucksweise, die Stimmfärbung, den Anzugschnitt oder die Regenerwartung des Tages.
Die Japaner haben auch die Kunst, sich vorsätzlich falsch zu verstehen, perfektioniert, um keinen Gesichtsverlust zu verursachen. Ein Beispiel: Man fragt in einem Eissalon, was im Supa-Kureemu ist. Der Verkäufer wird eine genaue Beschreibung geben: Vanille und Erdbeereis, Pistaziennüsse mit glasiertem Honig und Schokoladensoße obendrauf. „Ich hätte gerne zwei davon“, sagt man. „Entschuldigung, aber wir haben nichts mehr“, ist die Antwort.