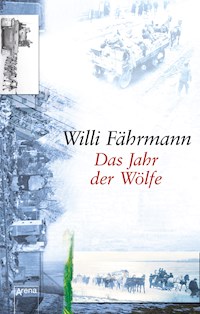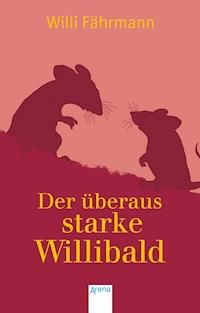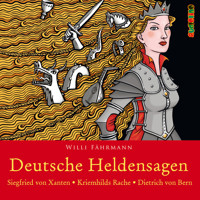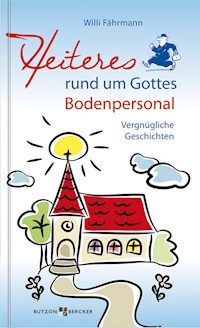6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Deutschland, 1943. Schwere Fliegerangriffe erschüttern immer häufiger die deutschen Städte. Die Zerstörungen sind gewaltig, ein geordneter Schulunterricht nicht mehr möglich. Weil Schulen vielerorts geschlossen sind, werden Kinder und Jugendliche in vermeintlich sichere Gebiete verschickt. Genau wie Ruth, die in einen kleinen Ort in Österreich gelangt. Doch während einige Lehrer verzweifelt versuchen, den Alltag für die Kinder und Jugendlichen aufrechtzuerhalten, rücken die Armeen der Sowjets immer näher. Trotzdem erlaubt das Nazi-Regime die Rückführung in die Heimat nicht. Der Kriegslärm ist schon zu hören, als der Direktor eine schwere Entscheidung treffen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Willi Fährmann
So weit dieWolken ziehen
Roman
Der Autor
Willi Fährmann,geboren 1929 in Duisburg, lebt heute in Xanten am Niederrhein.Mit seinem Gesamtwerk, für das ihmneben zahlreichen Einzelauszeichnungen der»Große Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur«verliehen wurde, gehört er zu den profiliertestenAutoren der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Seine im Arena Verlag erschienenen Bücher habendie Millionenauflage überschritten.
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012© 2008 by Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenEinbandgestaltung: Frauke SchneiderISBN 978-3-401-80016-5www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Erster Teil
Anfang November wehte ein kalter Wind vom Osten her und vertrieb die letzten milderen Herbsttage. An dem Morgen, als die erste dünne Schneedecke auf den Bergspitzen blinkte, kam Frau Brüggen zurück. Niemand hatte sie gesehen, niemand war ihr ins Tal entgegengelaufen, um ihr die beiden Holzkoffer zu tragen. Die Mädchen saßen noch beim Frühstück, als sie plötzlich in der Tür zum Speisesaal stand. Sie stellte die Koffer auf den Boden und stützte sich mit der Hand am Türpfosten ab. Die leisen Gespräche und das Klirren des Porzellans verebbten. Auch vom Lehrertisch her richteten sich die Blicke auf sie. In die Falten ihres Mantels drückte sich ein Kind, vielleicht acht oder neun Jahre alt. Ängstlich starrte es in den Saal. Das Ende seines blonden Zopfs hielt es zwischen den Zähnen. Frau Brüggen hockte sich erschöpft auf einen der Holzkoffer.
Dr. Scholten stand auf. Er schob den Stuhl zurück und ging mit langen, etwas staksigen Schritten durch den Mittelgang des Saals auf Frau Brüggen zu. »Gut, dass Sie wieder da sind«, sagte er und berührte sie leicht an der Schulter. »Wir haben uns schon Sorgen gemacht. In den Nachrichten wurde vorige Woche gemeldet, dass es wieder einen schweren Bombenangriff auf Oberhausen gegeben hat. Gut, dass Sie jetzt bei uns sind.« Er schaute auf das Mädchen. »Wen haben Sie uns denn da mitgebracht?« Als Frau Brüggen nicht antwortete, wandte er sich an das Mädchen: »Wie heißt du?«
»Ruth«, sagte das Kind, ohne den Zopf zwischen den Lippen wegzunehmen.
Am anderen Ende des Saals sprang ein Mädchen auf. Ihr Stuhl stürzte um.
»Irmgard! Was soll das?«, rief eine Lehrerin scharf. Das Mädchen antwortete nicht, lief zu dem Kind und blieb vor ihm stehen.
»Ruth?«, flüsterte Irmgard. Das Kind schaute sie an und streckte ihr die Arme entgegen.
»Kennt ihr euch?«, fragte Dr. Scholten verwundert.
»Meine Schwester«, antwortete Irmgard. »Ruth ist meine Schwester.«
»Das ist eine Überraschung in der Morgenstunde.« Dr. Scholten wandte sich wieder Frau Brüggen zu. »Ich glaube, Frau Kollegin, Sie müssen uns …« Dann stockte er. »Aber kommen Sie doch an unseren Tisch, Frau Brüggen. Für Erklärungen ist später noch Zeit. Frühstücken Sie erst einmal mit uns.«
Irmgard hatte Ruth an sich gezogen.
»Und du, Ruth, du kannst mit deiner Schwester zu den großen Mädchen gehen. Du wirst sicher auch Hunger haben.«
Frau Brüggen setzte sich an den Lehrertisch und Frau Lötsche holte noch ein Gedeck aus der Küche.
»Wie war es in Oberhausen?«, fragte Direktor Aumann, der seinen Platz am Kopf des Tischs hatte. »In den Nachrichten wurde der Angriff erwähnt, aber Genaueres haben wir nicht erfahren können.«
»Es war die Hölle«, antwortete Frau Brüggen. »Aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen.«
»Und was ist mit der kleinen Zarski?« Der Direktor schien Schwierigkeiten zu befürchten und schaute Frau Brüggen vorwurfsvoll an. »Warum haben Sie das Kind hergebracht?«
Frau Brüggen starrte eine Weile vor sich hin und sagte dann leise: »Sie ist meine Nichte. Sie muss hier bei uns bleiben.«
»Aber Frau Brüggen!« Frau Lötsche lachte auf. »Das geht nun wirklich nicht. Ich meine, wir sind eine Oberschule und kein Kindergarten. Außerdem ist es problematisch genug, dass schon eine Ihrer Nichten hier in Maria Quell ist.«
Der Direktor war überrascht: »Schon eine …? Dr. Scholten, wissen Sie auch davon?«
»Frau Lötsche meint unsere Schülerin Irmgard Zarski. Aber die ist von Anfang an in unserer Schule und jetzt in der achten Klasse.« Direktor Aumann war verärgert. »Mit neun ist Ruth für unsere Schule eindeutig zu jung.« Dann besann er sich und sagte: »Kommen Sie später in mein Büro. Wir müssen darüber reden.« Hastig stand er auf. »Dr. Scholten und Sie, Frau Lötsche, Sie kommen dann bitte ebenfalls mit.« Dann ging er hinaus.
Frau Lötsche wollte eilfertig aufstehen, aber Dr. Scholten hielt sie am Arm zurück. »Wir wollen zunächst in Ruhe fertig frühstücken.«
Wenig später sprang der Zeiger der großen Uhr auf sieben Uhr vierzig. Die Lagermädelführerin Käthe Malik, eine blonde, schlanke Frau in Uniform, sicher noch nicht älter als zwanzig, läutete eine Glocke. »Acht Uhr Stubenappell, acht Uhr zwanzig Unterrichtsbeginn.« Die Mädchen stellten das Geschirr zusammen, das vom Tischdienst zur Durchreiche in die Küche getragen wurde. Sie drängten dem Ausgang zu. Die Lehrerinnen und Dr. Scholten blieben noch sitzen.
»Wie lange warst du unterwegs, Lene?«, fragte Frau Krase.
»Zwei volle Tage hat die Fahrt mit dem Zug gedauert. In Wien hatten wir fast vier Stunden Aufenthalt.«
»Wir müssen jetzt wohl«, sagte Frau Lötsche.
Dr. Scholten und Frau Brüggen folgten ihr durch den langen dunklen Flur. Ganz am Ende, hinter einer schweren Doppeltür, befand sich das Büro des Schulleiters. Dr. Scholten klopfte an und sie traten ein. Direktor Aumann saß an seinem Schreibtisch. Hinter ihm an der Wand hing ein großes Hitlerfoto.
»Sie hatten uns gebeten …«, erinnerte Frau Lötsche ihn.
Mit einer Handbewegung forderte der Direktor sie auf, an dem runden Tisch vor dem Fenster Platz zu nehmen. Er räusperte sich und sagte: »Sie wissen selbst, Kollegin Brüggen, dass wir Ihre Nichte nicht hierbehalten können. Die Vorschriften sind eindeutig. Die Kleine ist zu jung für unsere Oberschule.«
Dr. Scholten meldete sich zu Wort: »Nun lassen Sie Frau Brüggen doch erst einmal berichten, wie sie dazu gekommen ist, Ruth Zarski mitzubringen.«
»Das ist schnell erzählt.« Frau Brüggen sprach leise. »Wir haben es doch letztes Jahr im Mai alle gehört. Die Möhnetalsperre ist von britischen Bombern zerstört worden. Meine Schwester, Cilli Zarski, hatte Ruth bei unserer Cousine Ursula in einem Dorf hinter Schwerte untergebracht. In Oberhausen und den Ruhrgebietsstädten waren ja längst alle Schulen geschlossen. Das Haus meiner Cousine liegt nicht weit von der Ruhr entfernt. Die riesige Flutwelle, die sich aus der Talsperre ruhrabwärts wälzte, hat das ganze Flusstal verwüstet. Es soll an die tausend Tote gegeben haben.«
»Das ist alles hinlänglich bekannt«, unterbrach der Direktor sie. »Kommen Sie bitte zur Sache.«
»Meine Cousine Ursula war zum Glück rechtzeitig gewarnt worden. Sie konnte ihre beiden eigenen Kinder und auch die kleine Ruth in Sicherheit bringen. Aber das Vieh ist ertrunken und das Haus nicht mehr bewohnbar.«
»Und Ruth?«, drängte der Direktor.
»Meine Cousine hat dem Kind eine Karte um den Hals gehängt und seinen Namen und die Adresse in Oberhausen daraufgeschrieben. Ihre eigenen Kinder konnte sie für einen Tag bei Bekannten unterbringen. Ein Bauer nahm meine Cousine und Ruth auf seinem Pferdewagen mit zum Bahnhof nach Schwerte. Dort hat sie eine Fahrkarte für Ruth gelöst und ihr eingeschärft, dass sie in Dortmund eine Schaffnerin bitten sollte, ihr zu zeigen, von welchem Bahnsteig der Zug nach Oberhausen abfährt.«
»Aber sie ist doch noch ein Kind! Allein auf eine solche Reise!«, rief Frau Lötsche aus.
»Wäre Ihnen eine bessere Lösung eingefallen?«, erwiderte Frau Brüggen bitter. »Jedenfalls ist Ruth heil angekommen. Meine Schwester Cilli hat sich ausgemalt, was ihrer Tochter auf der Fahrt alles hätte passieren können, und hat sich geweigert, Ruth noch einmal wegzulassen. Sie wollte sie bei sich in Oberhausen behalten.«
»Aber die Schule«, sagte Frau Lötsche. »Sollte das Kind denn überhaupt keine Schule mehr von innen sehen?«
»Meine Schwester war fest entschlossen, Ruth nicht mehr wegzuschicken. Lieber hier ohne Schule mit mir umkommen, als irgendwo in der Fremde allein sterben, hat sie gesagt.«
»Ganz ohne Unterricht?«, fragte der Direktor unwirsch. »Immerhin haben wir seit hundert Jahren die allgemeine Schulpflicht. Das ist ein Gesetz. Da kann nicht jeder nach Lust und Laune …«
»Lust und Laune, Herr Direktor?«, unterbrach Frau Brüggen ihn. »Not und Verzweiflung wäre wohl treffender. Außerdem war da ja noch der alte Lehrer Mausberg. Der hat in der Wohnung neben meiner Schwester ein Zimmer zugewiesen bekommen, nachdem sein Haus zerbombt worden war. Herr Mausberg ist schon vor Jahren pensioniert worden. Der hat unsere Ruth jeden Morgen unterrichtet. Vorige Woche haben sie dann den Angriff auf unsere Stadt geflogen. Zuerst regnete es Brandbomben. Dann wurden von einer zweiten Bomberwelle Sprengbomben geworfen. Meine Schwester war mit Ruth rechtzeitig zum großen Bunker gerannt. Als sie nach Stunden zurückkonnte, war das Haus nur noch ein schwelender Trümmerberg. Herr Mausberg und alle Bewohner des Hauses, die im Luftschutzkeller geblieben waren, sind umgekommen. Meine Schwester hat sich in dem kleinen Stall hinter dem Haus mehr schlecht als recht eingerichtet.«
»Und das Kind?«, fragte Dr. Scholten.
»Mein Schwager Heinz hat vor dem Krieg zwei Ziegen in dem Stall gehalten. Der Futtertrog war noch da. Den hat meine Schwester mit Heu gefüllt. Dort konnte Ruth schlafen.«
»Auf Heu und auf Stroh, das hatten wir doch schon mal«, sagte der Direktor, aber niemand lachte.
»Ich habe meiner Schwester zugeredet wie einem kranken Gaul und ihr vorgeschlagen, dass ich Ruth nach Maria Quell mitnehme. Zuerst hat sie sich geweigert. ›Der Heinz in Russland, Irmgard bei euch weit hinter Wien, unser Albert in der Tschechei. Nein, die Ruth nimmt mir niemand weg‹, hat sie gesagt. Ich habe ihr geschildert, wie gut Ruth bei uns untergebracht werden könne. Hier sei sie wirklich sicher aufgehoben.«
»Aber wie lange noch?«, sagte Dr. Scholten leise. »Seit letztem Winter und dem Desaster von Stalingrad kennt man an der Ostfront nur noch eine Richtung: Rückzug nach Westen.«
Der Direktor fuhr ihn an: »Unterlassen Sie bitte diese zersetzenden Bemerkungen, Herr Kollege. Wir werden die Russen zurückwerfen. Wenn es sein muss, bis hinter den Ural.«
»Nun, meine Schwester hat meinem Vorschlag schließlich zugestimmt, auch weil sie dienstverpflichtet ist und jeden Tag von sechs bis zwei zur Frühschicht in die Fabrik muss. Der Kollege Mausberg, bei dem Ruth vorher bleiben konnte, bis sie von der Arbeit kam, der … na, Sie wissen es ja. Ich musste meiner Schwester versprechen, dass ich das Kind wie meinen Augapfel hüte. Deshalb ist meine Nichte jetzt hier und wird auch bei uns bleiben.«
Es blieb eine Weile still in der Runde. Schließlich räusperte sich der Direktor und sagte: »Trotzdem. Es ist verboten …«
Dr. Scholten fiel ihm ins Wort: »Es gibt aber auch etwas, das über den Verboten steht. Einen Notstand sozusagen. Ich schlage vor, wir suchen nach einer Lösung, das Kind irgendwie hier unterzubringen. Sie haben doch sogar Esther Salm als externe Schülerin aufgenommen.«
»Damals war ich noch ganz neu hier, Herr Kollege. Ich kannte die Vorschriften noch nicht. Sie hatten mich nicht hinreichend informiert. Heute ist das anders. Jetzt trage ich die Verantwortung für diese Schule, Herr Kollege. Ich werde mir keine Laus in den Pelz setzen.« Aus einem Stapel von Briefen zog er ein Blatt heraus. »Hier ist eine Ankündigung von der zuständigen Zentrale in Wien. In diesen Tagen wird unser Lager inspiziert. Der Verantwortliche von der Partei kommt mit einer Kommission. Stellen Sie sich den Skandal vor, wenn auffällt, dass …«
»Ich verstehe Ihre Sorgen, Herr Direktor«, sagte Frau Brüggen. »Aber die Mädchen der ersten Klasse haben wir doch ausquartiert. Das Tannenhaus liegt abseits, am Ende der Straße. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ruth unter den Mädchen dort auffällt.«
»Und während des Unterrichts, was geschieht dann mit dem Kind?«
»Ruth könnte zunächst in die vierte Klasse der Dorfschule im Tal gehen.«
Dr. Scholten fand den Plan nicht schlecht. »Bei Esther Salm vom Haus oben am Berg hatten wir nicht so große Bedenken. Wir haben sie aufgenommen, obwohl das, wie Sie sagen, auch an den Vorschriften vorbei geschehen ist.«
»Ja, zum Teufel. Das macht mir Kopfschmerzen genug.« Der Direktor blätterte nervös in seinen Papieren. Schließlich schlug er mit der flachen Hand auf die Schreibtischplatte. »Machen Sie, was Sie wollen. Aber ich weiß von nichts. Ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür.« Er setzte seine Brille auf und begann, die Dienstpost zu öffnen. Die beiden Frauen verließen das Büro. Dr. Scholten blieb noch da. Der Direktor schaute auf und fragte: »Sonst noch was?«
»Tja, Herr Aumann. Mir ist etwas zu Ohren gekommen, vielleicht nur ein Gerücht, aber ich möchte Sie doch danach fragen. Es heißt, die Lagermädelführerin habe sich in Wien über mich beschwert, weil ich gelegentlich in der Kirche von Maria Quell die Orgel spiele.«
»Ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, Dr. Scholten, dass die engen Kontakte zu den Patres nicht erwünscht sind. Wir sollen unseren Schülerinnen ein Vorbild sein. Tatsächlich stelle ich fest, dass immer wieder das eine oder andere Mädchen in das Kloster läuft. Auf Ihren Spuren sozusagen. Was auch immer dort geschieht, etwas mehr Distanz wäre angebracht.«
»Orgel spielen ist, so weit ich weiß, nicht verboten.«
»Das nicht. Was mich betrifft, kann ich Sie beruhigen. Ich werde der Kommission selbstverständlich bestätigen, dass Sie Ihren Unterricht nicht vernachlässigen. Dennoch, man wird Ihre Kontakte wahrscheinlich missbilligen.«
»Danke. Ich werde einfach abwarten.«
An diesem Vormittag war Irmgard für die ersten beiden Stunden vom Unterricht befreit worden. Sie sollte ihre Schwester durch das Haus führen. Irmgard tat das nur widerwillig. Das fehlt mir gerade noch, dass ich die Kleine bemuttern soll, dachte sie. Sie fragte Ruth, ob es von zu Hause Neuigkeiten gäbe. Vor wenigen Tagen war ein langer Brief angekommen, in dem die Mutter geschildert hatte, wie es nach dem letzten schweren Bombenangriff in der Stadt aussah. Mehr wusste Ruth auch nicht. Beim Rundgang durch den Quellenhof staunte Ruth über die langen Flure und die vielen hohen Räume.
»Bevor wir hier eingewiesen worden sind, war der Quellenhof ein Hotel«, sagte Irmgard.
»Wer hat denn hier gewohnt?«
»Leute aus Wien und aus der ganzen Gegend. Viele Kranke auch. Die wollten hier etwas für ihre Gesundheit tun.«
»Ein Krankenhaus?«
»Nein. Ein Kurhaus. Im Tiefgeschoss sind Baderäume und sogar ein Schwimmbecken. Das Wasser hier soll sehr gesund sein.« Sie stiegen über eine breite, schön geschwungene Treppe ins zweite Obergeschoss.
»Hier sind unsere Stuben«, sagte Irmgard. Sie öffnete eine Doppeltür. Helles Licht flutete durch zwei große Fenster.
»Das ist mein Bett.« Irmgard zeigte auf eins der zwei Doppelstockbetten. »Das untere Bett ist frei.«
»Da könnte ich ja schlafen«, sagte Ruth.
»Das fehlte gerade noch. Du bei uns Großen. Wahrscheinlich wohnst du bei den Mädchen aus der fünften Klasse im Tannenhaus.« Irmgard sah, dass Ruth ängstlich dreinschaute. Trotzdem, es war ihr recht, dass die Schwester in dem anderen Haus untergebracht werden sollte. Die Kleine, wie sie in der Familie hieß, war von der Mutter stets gehätschelt worden. Ruth hatte dicke dunkelblonde Haare, die sich über der Stirn kräuselten. Jeder, der zu Besuch kam, bestaunte ihre langen Zöpfe. Irmgard stand oft am Rande. Manchmal hatte sie die Aufmerksamkeit der Mutter erzwingen wollen und sich auffällig benommen, hatte in der Küche ein Rad geschlagen oder war auf den Händen gelaufen. »Irmgard«, hatte die Mutter dann vorwurfsvoll gesagt, »Irmgard, benimm dich.« Einmal hatte sie sich beim Äpfelschälen absichtlich in den Finger geschnitten. Die Mutter hatte ein Pflaster auf die Wunde geklebt und gesagt: »Ungeschicktes Fleisch muss weg.« Da erst hatte Irmgard zu weinen angefangen. Und jetzt sollte sich in Maria Quell wieder alles um die Kleine drehen? Nein, danke, dachte Irmgard. Gut, dass sie im Tannenhaus untergebracht wird. »Das Tannenhaus ist nicht weit von hier. Es liegt am Ende der Straße, gleich am Wald. In der Freizeit am Nachmittag können wir uns sehen. Wenn wir nicht …«
»Wenn wir nicht?«, wiederholte Ruth.
»Na, oft machen wir mit der LMF Spiele und mit Dr. Scholten auch manchmal lange Wanderungen. Bald wird Schnee liegen und die LMF hat uns versprochen, dass sie uns dann das Skilaufen beibringt.«
»LMF?«
»Lagermädelführerin. Sie heißt Käthe Malik.«
Die Doppelstockbetten erinnerten Ruth an die Schlafstätten in dem Luftschutzkeller in Oberhausen. In diesem schönen Hotelzimmer standen sie wie Fremdkörper und passten nicht zu den übrigen Möbeln.
Zur Einrichtung gehörten zwei breite Einzelbetten, ein großer Kleiderschrank und zwei schmale Spinde, dazu einige Hocker und ein Tisch vor dem Fenster. Das Waschbecken an der Wand neben der Tür machte Ruth neugierig. Sie öffnete die beiden Wasserhähne. »Wasser im Schlafzimmer«, rief sie überrascht.
»Ja.« Irmgard fiel ein, wie sehr auch sie darüber gestaunt hatte, als sie im Sommer nach Maria Quell gekommen war. Zu Hause gab es nur einen Spülstein in der Küche und Oma Zarski, die am Rand von Oberhausen wohnte, musste das Wasser sogar aus dem einzigen Kran der Etage im Flur holen.
Als Irmgard sagte, dass einige Räume sogar ein eigenes Badezimmer hätten, rief Ruth: »Das glaube ich erst, wenn du es mir zeigst.«
»Das geht nicht. In den Zimmern mit Bad wohnen nämlich die Lehrerinnen und Lehrer.«
Im Erdgeschoss läutete eine Glocke.
»Pause«, sagte Irmgard. »Ich muss gleich zum Unterricht.« Blöd, dass mir jetzt die Kleine wie ein Hündchen folgt, dachte sie.
Sie gingen hinunter. Für die Mädchen wurde an einem langen Tisch Tee ausgeschenkt und jede Schülerin konnte sich einen Apfel nehmen.
Frau Brüggen ging auf ihre Nichten zu und zog sie beiseite. Sie sagte zu Ruth: »Irmgard weiß es schon, aber du, Ruth, musst dich auch daran halten; wenn du mich ansprichst, sag bitte nicht Tante Lene zu mir. Wie alle Schülerinnen nennst du mich Frau Brüggen. Es gibt sonst nur dummes Gerede und es wird behauptet, ihr würdet vorgezogen. Ist das klar?«
Ruth nickte.
»Anna Mohrmann ist heute zum Pfortendienst eingeteilt. Du hast beim Frühstück neben ihr gesessen. Bei ihr kannst du zunächst bleiben. Sie weiß schon Bescheid. Warte hier. Sie wird dich gleich abholen.«
Wieder läutete die Glocke. Die Flure leerten sich.
»Bis später«, sagte Irmgard und ging mit Frau Brüggen zum Unterricht.
Ruth stand allein in dem dämmrigen Flur. Der Tisch wurde abgeräumt und von zwei Frauen weggetragen. Die ältere der beiden drehte sich um und entdeckte Ruth. Sie setzte den Tisch ab und sagte zu der anderen Frau:
»Lutka, ruf die Vroni. Trag mit ihr den Tisch in den Speisesaal. Ich geh zu dem Kind.« Sie suchte von den Äpfeln, die übrig geblieben waren, einen besonders schönen aus und brachte ihn Ruth.
»Magst den?«, fragte sie.
Ruth nickte und nahm den Apfel.
»Komm mit. Ich zeig dir mein Reich.« Sie nahm Ruth bei der Hand und ging mit ihr durch den Speisesaal in die große Küche. Ruth hatte noch nie einen so gewaltigen Herd gesehen. Er nahm die ganze Mitte des Raums ein. Aus mehreren großen Töpfen dampfte und zischte es. Andere Töpfe, Tiegel und Pfannen standen in einem Regal an der Wand und daneben hingen, der Größe nach aufgereiht, Schöpfkellen und Schaumlöffel. Alles blinkte und blitzte.
»Na, was sagst dazu?«, fragte die Frau.
»Wir hatten zu Hause auch eine schöne Küche«, antwortete Ruth, »aber jetzt liegt alles unter den Trümmern.«
»Diese Terrorangriffe sind eine Schande«, sagte die Frau leise, »aber nach dem Endsieg soll alles schöner wiederaufgebaut werden.« Dann rief sie die beiden Küchenhilfen. »Das ist die Vroni. Sie kommt aus dem Dorf.«
Vroni machte einen Knicks, als sie Ruth die Hand gab.
»Und hier die Lutka. Die ist im vorigen Jahr aus Polen hierher. . .« Die Frau zögerte kurz. »Na, die Lutka haben sie her zu mir gebracht.«
»Und wer sind Sie?«, fragte Ruth.
»Na, die Hauswirtin bin ich. Ich koche und sorge dafür, dass bei euch Leib und Seele zusammenbleiben.«
Ein Mädchen von etwa dreizehn Jahren stürmte in die Küche und rief: »Frau Zitzelshauser, haben Sie nicht dieses neue …« Dann erblickte sie Ruth. Erleichtert atmete sie auf. »Da bist du ja. Ich hab dich gesucht. Ich bin die Anna. Komm mit. Ich hab heute Pfortendienst.«
In der weitläufigen Eingangshalle gab es eine lang gezogene Theke. An der Wand dahinter stand ein hoher Schrank mit Türen, kleinen Schubladen, einem Schlüsselbrett und einem Regal mit vielen, vielen schmalen Einschüben.
»Was ist das?«, fragte Ruth.
»Für jedes Zimmer gibt es ein Fach. Siehst du die Nummern?«
»Von 1 bis 275«, rief Ruth. »Das gibt’s ja gar nicht! Ein Haus mit 275 Zimmern?«
Anna erklärte es ihr. »Das Haus hat drei Etagen. Ein Teil der Räume steht leer. Im Erdgeschoss fängt es mit Zimmer Nummer 1 an und geht bis 25. Die erste Etage beginnt mit 101 und die zweite mit 201. Zweiundsiebzig Zimmer also.«
»Müssten aber fünfundsiebzig sein. Auf jeder Etage bis fünfundzwanzig.«
»Rechnen kannst du ja. Eigentlich stimmt es auch. Aber hier im Quellenhof gibt es kein Zimmer mit der Nummer 13. Manche Gäste wollen so ein Zimmer nicht. Soll Unglück bringen.«
»Glaubst du das?«
Anna ging mit Ruth zur hinteren Tür der Halle. Ein langer eiserner Schlüssel hing an einem Haken an der Wand daneben. Anna steckte ihn ins Schloss und öffnete die Tür. Von einer Terrasse aus führte ein Weg bergan direkt auf das Portal einer Kirche zu.
»Das ist die Wallfahrtskirche Maria Quell«, sagte Anna. »Und das Haus daneben ist das Kloster. Da wohnen aber nur noch Pater Martin und Pater Lukas. Alle anderen sind als Sanitäter eingezogen worden. Ich bin zu Pater Martin hochgelaufen und hab ihn gefragt, was er davon hält, dass die Dreizehn Unglück bringen soll. Der Pater hat gesagt, so was ist Aberglaube und der reine Hokuspokus. Aber was sollte Frau Zitzelshauser machen, wenn es die Gäste grault, ein Zimmer mit der Nummer 13 zu beziehen?«
Der Wind wehte durch die Tür ins Haus. »Zu Pater Martin können wir übrigens immer gehen, wenn uns der Schuh drückt«, sagte sie noch, dann schloss sie die Tür.
»Wir müssen jetzt ins Kabuff. Es liegt hinter dem Empfang und ist für den Pfortendienst. Da ist geheizt. In der Halle würdest du bald zu einem Eiszapfen.«
In dem kleinen Raum gab es ein Fenster, durch das man den Eingang beobachten konnte. Die Einrichtung bestand aus einem blauen Sessel und einem abgewetzten roten Plüschsofa.
»Warum muss hier immer jemand sitzen?«, fragte Ruth.
»Es könnten Fremde kommen. Oder Besucher, die sich im Haus nicht auskennen. Und wir Mädchen dürfen auch nicht nach draußen, wann wir wollen. Nur in den Freistunden am Nachmittag können wir das Haus verlassen.«
»Was ist das für eine Treppe auf der anderen Straßenseite?«, fragte Ruth.
»Komm, ich zeig sie dir.« Anna öffnete die Eingangstür. Zwei Treppenläufe mit vielen steinernen Stufen führten an beiden Seiten eines Beetes vorbei hinunter zu einem runden Platz.
»Im Sommer haben bis dort unten Rosen geblüht. Wir spielen manchmal Theater. Die Zuschauer sitzen dann auf den Stufen. Das kleine Haus hinter dem Platz, das ist die Orangerie.«
»Die was?«
»Früher war die Orangerie eine Art Wintergarten. Dort konnten die Gäste spazieren gehen und sitzen, wenn es draußen schon kalt und kahl war. Aber jetzt steht dort nur Gerümpel, glaub ich.« Sie gingen in den Pfortenraum zurück. Anna nahm ihr Strickzeug zur Hand und setzte sich in den Sessel. Ruth stand ein wenig verloren da. Düstere Gedanken überfielen sie. Keiner kümmert sich um mich, dachte sie. Irmgard ist froh, wenn ich nicht mehr in diesem Haus bin, Mutter ist weit weg und aus Tante Lene ist auf einmal Frau Brüggen geworden. Sie schniefte und griff nach ihrem Taschentuch.
Anna legte das Strickzeug in den Schoß. »Musst nicht traurig sein, Ruth. Die ersten Tage sind uns allen schwergefallen. Am besten, du setzt dich auf unser Kummersofa. Die Ecke links ist ein Zauberplatz. Wenn du dich da hinsetzt, geht es dir bald besser.« Sie legte ihren Arm um Ruths Schulter. »Noch ein paar Tage, dann wirst du dich bestimmt heimisch fühlen.«
Das glaubte Ruth nicht so recht, aber es tat ihr gut, dass Anna mit ihr redete.
»Wird ein Schal für meine Zwillingsschwester Lydia«, sagte Anna und zeigte Ruth das Strickzeug.
Ruth wunderte sich. »Hat die auch vorhin mit uns am Tisch gesessen?«
»Warum fragst du?«
»Ich hab beim Frühstück kein Mädchen am Tisch gesehen, das so aussieht wie du, Anna.«
»Es gibt auch Zwillinge, die sich nicht ähnlich sind. Lydia ist die schmale Blonde, die mir gegenübergesessen hat. Du darfst dich nicht wundern, wenn sie dich nicht begrüßt und dir wahrscheinlich auch nicht die Hand gibt. Sie ist, na, wie soll ich sagen, sie zuckt immer gleich zurück, wenn jemand sie berühren will. Aber jetzt darfst du mich nicht mehr stören. Ich stricke ein kompliziertes Muster und muss die Maschen zählen.«
Es war still im Haus. Die Stricknadeln klapperten leise. Eine Strähne ihres dunkelbraunen Haars fiel Anna immer wieder ins Gesicht und sie warf sie mit einer heftigen Bewegung ihres Kopfs zurück. Die dichten dunklen Augenbrauen und eine senkrechte Falte über der Nasenwurzel ließen Anna älter aussehen, als sie wahrscheinlich war. Ruth wurde schläfrig. Es war eine lange, beschwerliche Fahrt in überfüllten Zügen und ein mühsamer Weg vom Bahnhof bis hinauf zum Quellenhof gewesen. Sie schlief ein. Selbst die Glocke, die zum Mittagessen läutete, hörte sie nicht. Anna musste sie ein wenig an der Schulter rütteln. Ruth schreckte auf.
»Alarm?«, rief sie.
Anna stutzte. Alarm? Doch dann fiel ihr ein, wie es in Oberhausen gewesen sein musste. Wenn die Sirenen aufheulten, mussten sie in den Luftschutzkeller. Immer schnell, schnell. Keine Zeit, langsam wach zu werden. »Nein, nein, Ruth. Kein Alarm. Mittagessen. Komm, wir gehen in den Speisesaal.«
Die Mädchen stellten sich hinter ihre Stühle. Frau Lötsche rief vom Lehrertisch aus: »Guten Appetit«, und die Mädchen antworteten im Chor: »Danke gleichfalls.«
Alle setzten sich. Nur Ruth blieb stehen. Sie bekreuzigte sich und begann, ein Tischgebet zu murmeln. So war sie es von zu Hause her gewohnt. Einige Mädchen kicherten und Ruth schwieg verlegen.
Irmgard zupfte an Ruths Jacke und tuschelte: »Setz dich endlich.«
Auch Frau Lötsche hatte Ruth beten sehen. Nach dem Essen ging sie zu ihr an den Tisch und sagte: »Ich muss später hinüber ins Tannenhaus. Du kannst dann mit mir kommen. Nimm deine Sachen mit. Pünktlich um drei in der Halle.«
»Ich kann ja den Koffer tragen«, bot Irmgard an.
»Nein. Ich möchte mit deiner Schwester allein gehen. Wenn du meinst, dass der Koffer für die Kleine zu schwer ist, kannst du ihn ja in der Freistunde schon mal ins Tannenhaus bringen.« Sie ging wieder weg.
»Ist es im Tannenhaus so ähnlich wie hier, Irmgard?«, fragte Ruth.
»Na ja. Das Tannenhaus liegt etwas abseits.«
»Gibt’s da auch fließendes Wasser in den Zimmern?«
»Nein. Die Kinder waschen sich in einem Brunnenhaus. Weißt du, das Tannenhaus war, bevor wir nach Maria Quell kamen, eine einfache Herberge für ärmere Wallfahrer. Aber du wirst dich dort bestimmt wohlfühlen.«
»Schade«, sagte Ruth. »Ich fand das gut, das mit dem Waschbecken im Zimmer.«
»Alles Gewohnheit«, erwiderte Irmgard. »Sei pünktlich um drei in der Halle. Die Lötsche kann biestig sein.«
Schon lange vor der Zeit wartete Ruth auf die Lehrerin. Auf die Minute genau, als von der nahen Kirche her die Glocke drei Uhr schlug, betrat Frau Lötsche die Halle. Ihre Absätze klapperten auf dem Steinboden. Sie trug ein grünes Lodencape. Eine dunkelbraune Pelzkappe bedeckte ihre weißblonden Haare bis auf ein paar Fransen im Nacken und den Pony, der ihr bis weit in die Stirn reichte.
»Also dann«, sagte sie. Mit kurzen, schnellen Schritten ging sie los. Ruth musste sich sputen, um mitzuhalten.
»Ich wollte kurz mit dir sprechen, Ruth Zarski. Heute vor dem Essen habe ich dich beten sehen. Hier wird am Tisch nicht gebetet. Das gilt auch für dich. Für niemanden wird eine Extrawurst gebraten. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir wünschen uns Guten Appetit und damit hat sich’s. Keiner tanzt aus der Reihe. Richte dich bitte danach.«
»Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich soll das Beten nicht vergessen. Und meine Mutter …«
»Deine Mutter ist in ihren vier Wänden zuständig. Hier bestimmt die Lagerleitung, was zu tun ist. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Klar?« Als Ruth nicht antwortete, fragte sie noch einmal, diesmal lauter und schärfer: »Klar?«
Ruth schwieg.
Frau Lötsche lachte auf. »Na, wir haben es mit deiner großen Schwester geschafft und wir werden auch dich auf Vordermann bringen, du kleiner Dickkopf.«
Die wenigen Häuser in der Nähe des Klosters lagen wie aufgereiht an der Straße. Der Quellenhof war, wenn man von der Kirche absah, das bei Weitem größte Gebäude. Die Straße führte leicht ansteigend am Berghang entlang und verschwand schließlich im Wald. Oberhalb der Straße war ein kleines Haus an den Hang gebaut. Tief im Tal sah man eine größere Zahl von Häusern, in der Mitte die Kirche mit einem Zwiebelturm: das Dorf. Der kleine Bahnhof am Rand des Dorfs war neben der Landstraße die einzige Verbindung in die Stadt, ja sogar nach Wien und weiter in die große, weite Welt. Ruth hätte gern gewusst, was hinter dem Berg war, aber sie traute sich nicht, die Lehrerin anzusprechen. Sie waren schon an den Häusern vorbei, als links ein Schotterweg abzweigte, der zu einem niedrigen holzverkleideten Haus führte, das sich unter ein schweres Dach duckte. Schmale Gauben zogen sich über die gesamte Breite des Daches. Den großen Hof vor dem Haus umgab ein niedriger Holzzaun. Ein Laubengang führte zu einem einstöckigen Nebengebäude mit Flachdach. An einem hohen Mast flatterte eine Hakenkreuzfahne. Frau Lötsche und Ruth betraten den Hof. Die Haustür öffnete sich und die Lagermädelführerin kam ihnen entgegen.
»Heil Hitler, Käthe«, grüßte Frau Lötsche. »Da ist die kleine Zarski. Ihre Schwester hat den Koffer schon hergebracht.« Sie betraten ein winziges Büro.
»Erklär mir doch bitte, Karin, wie wir die Kleine hier im Tannenhaus eingliedern sollen«, sagte Frau Malik.
»Der Direktor hat angeordnet, dass Ruth vorläufig hier mitläuft. Nichts Besonderes also. Am Vormittag geht sie ins Dorf zur Schule. Dort weiß man schon Bescheid.«
»Gut. Ich habe mir gedacht, dass Esther Salm das Kind beim ersten Mal begleiten kann und ihm zeigt, wie man zur Dorfschule kommt.«
»Ja, das reicht vollkommen, Käthe. Verlaufen kann man sich ja nicht auf dem Weg ins Tal. Ich will noch kurz Frau Krase sprechen, damit sie Esther morgen in den ersten beiden Stunden vom Unterricht befreit.«
»Ja, Karin. Ich hole sie her.« Frau Malik fasste Ruth an der Schulter und ging mit ihr hinaus. »Denk daran, Zarski, was ich dir gesagt habe. Keine Extrawurst!«, rief Frau Lötsche ihnen nach.
Die Lagermädelführerin sagte: »Du kannst Käthe zu mir sagen, Ruth. Wenn du nicht zurechtkommst, ich kann dir helfen.«
»Gibt es eigentlich viele Lehrerinnen und Lehrer hier, Käthe?«
»Schon. Vielleicht dreizehn oder vierzehn? Genau weiß ich es selber nicht. Aber die meisten wohnen nicht im Quellenhof oder im Tannenhaus. Die haben ein Privatzimmer im Ort und versorgen sich selbst.«
Das Tannenhaus mit seinen dunklen Holzdecken und vertäfelten Wänden kam Ruth düster und unheimlich vor. Käthe Malik brachte sie in den Tagesraum. Dort waren auch die anderen Mädchen aus der Unterklasse. Sie saßen an den Tischen, machten ihre Hausaufgaben, schrieben Briefe, lasen oder spielten miteinander. Einige sahen kurz auf, als Käthe Malik mit dem fremden Mädchen hereinkam.
»Hört mal her«, rief die LMF. »Ich bringe euch eine Neue.« Sie wandte sich an Ruth. »Sag den Mädchen deinen Namen.«
»Ich heiße Ruth.«
»Weiter! Ruth …«
Sie stockte und sagte schließlich: »Ruth Erika Gesine Zarski.«
Einige Mädchen lachten. »Wie ’ne Prinzessin«, rief eine vom hinteren Tisch.
»Was soll das?«, fragte Frau Malik.
»Na, Prinzessinnen haben auch meistens mehrere Vornamen.«
Frau Malik sagte: »Ruth kommt wie ihr aus Oberhausen. Im Ruhrgebiet gibt es außer euch keine Prinzessinnen.« Sie mahnte die Mädchen: »Nehmt Ruth freundschaftlich auf. Sie schläft in Stube 8.«
Die Mädchen am Tisch beim Fenster murmelten unwillig. »Muss das sein? … Bei uns ist kein Bett mehr frei … Sowieso viel zu eng.«
»Ihr seid hier nicht im Paradies.« Die Stimme von Frau Malik klang ein wenig schrill. »Ein Bett wird dazugestellt. Ich erwarte von euch, dass ihr euch kameradschaftlich verhaltet.«
Zwei Lehrerinnen saßen in einer Fensternische. Sie waren dabei, Klassenarbeiten zu korrigieren. »Ruhe bitte«, rief die eine. »Silentium heißt Ruhe.«
Frau Malik sprach sie an: »Frau Krase, die Lötsche wartet im Büro und will Sie sprechen.«
Die Lehrerin blickte auf. »Sie meinen sicher Frau Lötsche.«
Der Lagermädelführerin schoss die Röte ins Gesicht. »Ganz recht, Frau Lötsche.« Sie drehte sich abrupt um und verließ mit Ruth den Raum. »Dumme Kuh«, sagte sie leise.
»Warum müssen die Mädchen still sein?«, fragte Ruth.
»Nach der Mittagspause wird für die Schule gearbeitet. Dann schweigen alle neunzig Minuten lang. Silentium …«
»Ach ja. Das heißt, dann herrscht Ruhe«, ergänzte Ruth.
Im Wirtschaftsraum wies Frau Malik zwei Männer an, die dort an einem Tisch saßen, ein zusätzliches Bett in Stube 8 aufzustellen. Es dauerte eine Weile, bis die beiden verstanden hatten, was sie tun sollten.
»Den Koffer dort nehmt ihr auch mit. Und zwar sofort. Hopphopp.«
Die Männer standen träge auf und verließen den Raum.
»Das sind Franzosen«, sagte Frau Malik. »Kriegsgefangene. Die hatten mich schon längst verstanden. Aber sie stellen sich erst mal dumm.«
Eine Frau kam herein. Alles an ihr war dick und rund. Ihre Haare hatte sie zu einem großen Knoten mitten auf dem Kopf zusammengesteckt. Sie trug eine grellrote Kittelschürze, die sich über ihrem schweren Leib spannte. Aus schmalen Augenschlitzen blickte sie kurz auf das Kind.
»Frau Hirzel, das ist Ruth Zarski. Sie muss hier untergebracht werden.«
Frau Hirzel brummte vor sich hin, ging zu einem großen Wandschrank, nahm ein weißes Betttuch und einen blau-weiß karierten Bettbezug heraus und warf alles auf den Tisch.
»Sonst noch was, Frau Führerin?«, fragte sie unwirsch.
Frau Malik antwortete nicht. Sie legte sich die Wäsche über den Arm. »Komm, Ruth, ich zeig dir die Stube.«
Die Franzosen trugen ein schmales Bettgestell die Treppe hinauf. Frau Malik und Ruth folgten ihnen. In Stube 8 wurden die Möbel eng zusammengerückt und Ruths Bett wurde an der Wand unter dem Fenster aufgestellt.
»Matratze auch?«, fragte der ältere.
»Soll das Kind etwa auf den Brettern schlafen?«
Die Männer ließen sich Zeit und Ruth begann, ihre Sachen in ein Spind einzuräumen. Mehrmals rückte Frau Malik Ruths Wäsche so zurecht, dass der Stapel wie abgezirkelt lag, Kante genau auf Kante.
»Achte darauf, dass das immer so ist«, sagte sie. »Hier wird Ordnung gehalten. Im Spind genauso wie bei euch Schülerinnen. Jeden Morgen nach dem Flaggenappell wird der Spind überprüft. Was nicht in Reih und Glied liegt, wird aufs Bett geworfen und muss neu eingeräumt werden. Mach’s von Anfang an, wie es sein soll. Dann ersparst du dir viel Ärger.«
Einer der Männer trug einen großen Sack, vollgestopft mit Stroh, herein. Frau Malik drückte ihn in dem Bettgestell zurecht und fuhr mit dem Handrücken darüber. »Haferstroh, Ruth. Du hast Glück gehabt. Das pikt nicht so wie Gerstenstroh.«
»Das soll die Matratze sein?«, fragte Ruth verwundert.
»Hast du Schlaraffia-Matratzen erwartet? Du wirst schon merken, man schläft gut auf dem Strohsack. Du kennst doch sicher das Lied Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh, sie verkaufen ihre Federn und schlafen auf Stroh.«
»Schläfst du auch auf ’nem Strohsack, Käthe?«
Frau Malik lachte. »Ich habe mein Zimmer drüben im Quellenhof. Dort gibt es so etwas nicht. Hier im Tannenhaus geht es bescheidener zu.« Sie bezog das Bett. Kein Fältchen kräuselte das Betttuch. Makellos glatt lagen Oberbett und Kissen. »So muss es sein, Ruth. Die anderen Mädchen hier in der Stube werden dir sicher in den ersten Tagen helfen. Aber bald ist dir alles in Fleisch und Blut übergegangen. Weißt du, wo so viele Kinder zusammenwohnen, da muss alles genau geregelt sein. Sonst würdet ihr bald wie im Schweinestall hausen.«
Frau Malik ging zur Tür. »Ich muss zurück zum Quellenhof. Sieh dich inzwischen ein wenig im Haus um. Du kannst auch zu den anderen gehen. Vorerst besuchst du die Dorfschule. Morgen nach dem Frühstück geht es los. Esther Salm wird dich begleiten. Und vergiss nicht, deine Schultasche zu packen.«
Ruth hörte Frau Maliks Schritte auf der Treppe. Bedrückt setzte sie sich auf einen Hocker. Sie fühlte sich verlassen. Warum kam ihre Schwester nicht und schaute nach ihr? Sie fing an zu weinen. Erst als die Mädchen aus dem Tagesraum stürmten und lärmten, wischte sie sich die Tränen ab.
Die Kommission aus Wien, die das KLV-Lager Maria Quell überprüfen sollte, traf schon am nächsten Morgen ein und damit einen Tag früher als erwartet. Ein älterer, schnauzbärtiger Genosse von der Gauleitung aus Wien stellte sich als Kurt Ballnigel vor. Er war der Einzige, der die braune Parteiuniform trug. Die Namen der anderen Mitglieder der Kommission wurden kurz genannt: Parteigenosse Manatschek, Frau Mensing, Frau Luschnigg und Frau Minwald. Sie sagten wenig, wollten allerdings von Direktor Aumann sofort durch das Gebäude geführt werden. »Durch alle Räume«, befahl Kurt Ballnigel. Das Mittagessen wurde ihnen auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin in einem kleinen Raum neben dem Speisesaal serviert. Selbst den Direktor forderten sie auf, den Raum zu verlassen. Sie hätten intern einige Dinge zu besprechen. Nur die Lagermädelführerin baten sie für eine Viertelstunde herein. Dann blieben sie wieder unter sich. Als sich herausstellte, dass die Kommission nicht die Absicht hatte, am Spätnachmittag nach Wien zurückzufahren, lud der Direktor sie nach dem Abendessen auf ein Glas Wein in das Sprechzimmer ein. Aber Ballnigel und seine Leute verabschiedeten sich bereits nach kurzer Zeit mit der Ankündigung, dass am nächsten Morgen das Tannenhaus überprüft werden solle. Am Nachmittag sei dann die Schlusskonferenz angesetzt, bei der alle Lehrpersonen anwesend zu sein hätten, auch die, die nicht im Haus wohnten. Abschließend seien noch einige Einzelgespräche zu führen.
Direktor Aumann rief das Kollegium trotz der vorgerückten Stunde in sein Büro und teilte allen mit, was ihnen wahrscheinlich bevorstand. Ausdrücklich wies er Frau Krase vom Tannenhaus an, die kleine Zarski und auch Esther Salm nicht zu erwähnen. Frau Krase beruhigte ihn mit dem Hinweis, dass sie die beiden gleich in der Frühe ins Dorf in die Schule schicken werde. Die Salm werde der Zarski den Weg zeigen.
Der Direktor entließ das Kollegium bis auf Dr. Scholten und Frau Lötsche und beriet mit beiden, wie sie sich während der Konferenz verhalten sollten. Schließlich sagte er: »Also, wir lassen die Leute reden und werden ihre Fragen nur kurz beantworten. Dr. Scholten kann einen Überblick über den Unterricht und den Stundenplan geben. Sie, Frau Lötsche, übernehmen das Thema der nationalsozialistischen Erziehung unserer Mädchen. Erwähnen Sie auf jeden Fall die Feierstunde, die wir für den 9. November vorbereitet haben, und wie wir versuchen werden, den Schülerinnen zu vermitteln, dass viele Helden unserer jungen Nation 1923 beim Marsch auf die Feldherrnhalle in München grausam niedergeschossen worden sind.«
»Ja, das werde ich machen, Herr Direktor. Ich werde auch darauf hinweisen, dass unser Chor unter Leitung des Kollegen Dr. Scholten die festliche Stunde mit vaterländischen Liedern bereichern wird.«
Wenn sie auch durch und durch linientreu ist, dachte Dr. Scholten, kollegial ist sie ja doch.
Der Direktor stand auf. »Lassen wir es also auf uns zukommen.« Er öffnete die Türen, hob den Arm und rief: »Heil Hitler.« Die Lehrerin und der Lehrer erwiderten den Gruß. Das war laut genug, dachte Direktor Aumann. Die Kommission wird es hoffentlich gehört haben.
Esther Salm hatte den Auftrag bekommen, mit Ruth hinunter zur Schule zu gehen. Wenn sie sich sputeten, konnten sie die drei Kilometer in einer halben Stunde schaffen. Zuerst liefen sie stumm nebeneinanderher, doch schließlich fragte Ruth: »Warum bist du nicht im Tannenhaus?«
»Weil ich bei meiner Mutter wohne. In dem Haus, das da oben am Hang liegt. Das haben wir gemietet.«
»Stammst du aus dieser Gegend?«
»Nein. Aber wegen der Bombenangriffe …« Esther verstummte. Es schien ihr unangenehm zu sein, dass Ruth sie ausfragte.
»Und dann bist du doch in unsere Lagerschule gekommen?«
»Erst war ich in der Dorfschule. Deshalb weiß ich auch den Weg. Ich bin acht Monate lang jeden Schultag runter- und wieder hochgelaufen. Aber als das vierte Schuljahr zu Ende ging, ist meine Lehrerin Frau John mit mir nach Maria Quell gegangen. Der Weg ist steil und Frau John ist ziemlich alt. Das Atmen fällt ihr schwer. Sie hat mich nach Hause begleitet. Meiner Mutter hat sie vorgeschlagen, ich sollte nach den Osterferien hier oben in die KLV-Schule gehen. Ich habe nämlich gute Noten. Meine Mutter und Frau John sind noch am selben Nachmittag zum Quellenhof gegangen. Direktor Aumann war erst ein paar Tage vorher mit ein paar neuen Schülerinnen aus Oberhausen hier angekommen. Er ist jetzt der Leiter der Schule. Vorher hat Dr. Scholten das gemacht. Frau John hat dem Direktor mein Zeugnis auf den Schreibtisch gelegt. Er hat es durchgesehen und gefragt, warum ich nicht auf eine richtige Oberschule gehe. Aber die nächste ist in der Stadt, fast dreißig Kilometer weg. Ich hätte morgens um sechs von hier wegfahren müssen und wäre erst nach drei am Nachmittag wieder zurückgekommen. Und dann noch der lange Fußweg. Frau John hat gesagt, die KLV-Schule wäre die einzige Möglichkeit für mich, überhaupt eine Oberschule zu besuchen. Der Direktor hat lange überlegt und ich habe schon gedacht, er weist mich zurück, aber dann hat er schließlich zugestimmt. Und jetzt bin ich schon länger als ein halbes Jahr in der fünften Klasse.«
Esther brachte Ruth in das Schulgebäude neben der Kirche und blieb gleich vor der ersten Tür stehen.
»Frau Johns Klasse ist immer in diesem Raum«, sagte sie. »Die Lehrerin ist aus Berlin hierher in die Ostmark versetzt worden.« Sie klopfte an und wartete, bis ein Mädchen die Tür öffnete.
»Ist die Salm und noch eine andere«, rief das Kind in die Klasse hinein und schloss die Tür wieder.
Es dauerte eine Weile, bis die Lehrerin zu den beiden auf den Flur kam. Frau John war eine kleine, magere Frau. Sie ging gebeugt und hatte einen runden Rücken. Die schwarzen Haare waren straff nach hinten gekämmt und zu einem kleinen Knoten zusammengesteckt. Ihre Haut war von vielen Falten durchzogen. Die schmale, gerade Nase schien ein wenig zu lang zu sein für ihr kleines Gesicht. Aus ihren sanften dunkelbraunen Augen schaute sie freundlich auf die Kinder und gab ihnen die Hand. »Na, Esther, wen bringst du denn da?«
»Herr Direktor Aumann schickt uns. Ruth Zarski soll hier bis Ostern in die vierte Klasse gehen. Sie wohnt oben im Tannenhaus.«
»Na, Ruth, dann wollen wir mal sehen, ob sich für dich noch ein Platz findet.« Frau John hatte ihre Hand schon auf die Türklinke gelegt, als sie sich noch einmal zu Esther umdrehte. »Willst du auch noch ein Stündchen in deiner alten Klasse bleiben?«
»Ich soll bald zurück sein, Frau John.«
»Kommst du zurecht dort oben?«
»Schon, Frau John.«
»Gut. Du hörst, es ist laut wie immer, wenn ich den Raum verlassen habe. Kaum ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen.«
Sie führte Ruth in das Klassenzimmer. Sofort wurde es still. Lange Schulbänke standen dicht hintereinander. Die ersten reichten bis unmittelbar vor das Pult. Jede Bank hatte Platz für vier Kinder.
»Das ist Ruth Zarski«, sagte Frau John. »Sie kommt zu den Viertklässlern. Dort, auf den Eckplatz neben Resi, kann sie sich hinsetzen.«
Ruth schob ihre Schultasche unter die Bank. Sie hatte Zeit, sich umzuschauen. Es fiel ihr nicht schwer, dem Unterricht zu folgen. Sooft sie aber auch aufzeigte, Frau John schien sie zu übersehen.
Bald hatte sie herausgefunden, dass sich nicht nur die vierte Klasse in dem Raum befand, sondern auch einige Mädchen und Jungen aus den nächsthöheren Klassen. Trotz der Enge war der Raum beinahe wohnlich eingerichtet. Auf dem breiten Fensterbrett standen Blumen und sogar ein Aquarium mit Goldfischen. Als die Pause anfing, liefen die Kinder auf den Hof.
Frau John sagte zu Ruth: »Bleib du hier. Ich möchte mit dir reden.« Sie breitete eine weiße Serviette auf dem Pult aus, nahm ihr Pausenbrot aus der Tasche und begann zu frühstücken. »Hast du auch ein Brot mitbekommen?« Ruth schüttelte den Kopf. Frau John brach ihre Schnitte in zwei Teile und gab Ruth eins davon.
Sie merkte, dass Ruth nicht so recht wusste, was sie tun sollte. »Iss nur«, sagte sie. Dann stellte sie ein paar Fragen, wo Ruth zu Hause sei, aus welcher Familie sie komme, welche Schule sie besucht habe und ob sie gern zur Schule gegangen sei.
»Ich bin zuletzt gar nicht zur Schule gegangen, weil ja in Oberhausen alle Schulen geschlossen sind. Aber der alte Lehrer Mausberg hatte ein Zimmer bei uns im Haus. Der hat mich jeden Morgen unterrichtet.«
»Und, hast du was gelernt bei ihm?«
Ruth nickte. »Er war ein sehr guter Lehrer.«
»Na, das wollen wir erst mal sehen.«
Nun stellte sie Ruth Aufgaben aus dem kleinen und großen Einmaleins, fragte nach der Wort- und der Satzlehre, wollte wissen, welche deutschen Ströme in die Nordsee fließen, zeigte schließlich zur Fensterbank und fragte: »Wie heißen die Pflanzen, die dort stehen?«
Ruth kannte das Fleißige Lieschen und die Clivia. Aber die in die Höhe geschossenen Gewächse, die an Stäben fast bis zum Fensterkreuz hochrankten, waren ihr unbekannt.
»Diese Pflanzen kennst du auch«, sagte Frau John. »Das sind Stangenbohnen. Die haben zwei Kinder aus dem vierten Jahrgang gepflanzt und messen nun jeden Morgen nach, um wie viele Zentimeter sie in die Höhe geklettert sind.« Sie zeigte auf eine Tabelle an der Seitentafel.
Als die Klingel zum Pausenende schellte, sagte Frau John: »Du hast nicht übertrieben, Ruth, dieser Herr Mausberg war wirklich ein sehr guter Lehrer. Er hat dir viel beigebracht. Wenn du ihm einen Brief schreibst, bestell ihm einen Gruß von mir. Machst du das?«
»Das geht nicht«, antwortete Ruth. »Herr Mausberg ist bei dem letzten Bombenangriff in unserem Keller verschüttet worden. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben.«
Die Kinder kamen zurück in die Klasse. Frau John nahm nun immer mal wieder auch Ruth an die Reihe. Es fiel Ruth leicht, die richtigen Antworten zu geben. Nach dem Unterricht hielt Frau John Ruth für einen Augenblick zurück. Sie blätterte in einem schweren, dicken Buch. Ruth sah, dass zwischen den Seiten getrocknete Blumen lagen. Frau John nahm vorsichtig eine blassblaue Blüte heraus und legte sie in einen Umschlag. Den gab sie dem Kind und sagte: »Herr Mausberg war ein sehr, sehr guter Lehrer. Wenn du deiner Mutter schreibst, dann schick ihr diesen Umschlag mit. Sie soll die Blüte mit einem schönen Gruß von mir auf sein Grab legen.«
Frau John, die im Unterricht manchmal ziemlich barsch mit den Kindern umging und nie duldete, dass jemand störte, zeigte sich auf einmal von einer ganz anderen Seite. Da wusste Ruth, dass sie für Frau John durchs Feuer gehen würde.
Die Schlusskonferenz im Quellenhof verlief glimpflicher, als der Direktor befürchtet hatte. Von der Kommission wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich die Lagermädelführerin für die Nachmittagsveranstaltungen zuständig sei. Sie trüge die Verantwortung dafür. Sie allein. Die Lehrpersonen hätten sich tunlichst nicht einzumischen. Dies war ganz im Sinn von Herrn Aumann. So stand es schließlich in den Vorschriften, über die sich Dr. Scholten so oft hinweggesetzt hatte. Das Wort in der Kommission führte Kurt Ballnigel. Er verlas gegen Ende der Besprechung einige neue Verordnungen. An Weihnachten sollte auf alte germanische Traditionen zurückgegriffen werden. An die Wintersonnenwende sei zu erinnern, die ja auch viel älter und vernünftiger sei als das reaktionäre Christfest. Der Flaggenappell sei ebenso regelmäßig durchzuführen wie auch der Dienst in der Hitlerjugend. Die nationalen Feiertage müssten würdig begangen werden. Und schließlich erinnerte er noch einmal daran, dass die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von Lehrerschaft und Lagerführung unbedingt zu beachten seien. »Ich sagte es ja bereits: Die Lehrerschaft ist nur für den Unterricht am Morgen zuständig.«
»Gilt das auch für die Wandertage, die wir einmal im Monat durchführen?«, fragte Dr. Scholten.
»Waren nie erlaubt und werden ab sofort eingestellt.«
»Wir haben weit über hundert Mädchen in unserem Lager«, warf Frau Lötsche ein. »Wie sollen wir uns verhalten, wenn die LMF uns bittet, sie bei den Freizeitveranstaltungen und den nationalen Feierstunden zu unterstützen?« Sie wollte noch die Gedenkstunde an die Helden des Marschs auf die Feldherrnhalle am 9. November 1923 erwähnen, doch ihr wurde das Wort abgeschnitten.
»Nur wenn Frau Malik Sie einsetzen will und ausdrücklich Ihre Mithilfe anfordert, nur dann sind Sie gefragt.«
Nun mischte sich Frau Luschnigg aus der Kommission ein. »Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass auch die von Ihnen verschiedentlich veranstalteten Literaturabende nicht erwünscht sind. Vor allem nachdem wir erfahren haben, welche Bücher dafür ausgewählt worden sind.«
Dr. Scholten, der die Mädchen gelegentlich zu einem literarischen Gespräch eingeladen hatte, wollte widersprechen, doch Herr Ballnigel sagte: »Ausdrücklich möchte ich die tadellose Führung der Personalakten, die bis auf den Pfennig stimmende Lagerkasse, die Übersichtlichkeit der Verwaltungsvorschriften und insgesamt die Ordnung im Büro des Herrn Direktor bestätigen. Das soll bei dem Vorgänger von Herrn Aumann nicht immer so gewesen sein. Damit ist wohl alles gesagt. Halt. Noch eine Nachricht, die Sie freuen wird. Den wiederholten Bitten der Schulleitung, schon aus der Zeit vor Direktor Aumann, haben die zuständigen Stellen stattgegeben. In der nächsten Woche kommt aus Ihrer Stadt im Ruhrgebiet eine Rotkreuzschwester in den Quellenhof. Wenn ein Mädchen mal Schnupfen hat, kann ihr besser geholfen werden. Die Schwester heißt … ach, einen Augenblick bitte.« Er zog einen Briefbogen aus dem Ärmelaufschlag seiner Jacke und las: »Nora van Middelbeck. Genau die hatten Sie, Dr. Scholten, ja wiederholt angefordert und darauf hingewiesen, dass diese Schwester auch durchaus bereit sei, in dieses Nest hier zu kommen. Diese van Middelbeck scheint ja eine Adelige zu sein.«
Dr. Scholten war überrascht, dass tatsächlich Schwester Nora nach Maria Quell beordert worden war. Er kannte Frau van Middelbeck aus dem Chor, den er in Oberhausen geleitet hatte.
»Eine heilkundige Schwester ist bei den Zuständen im Tannenhaus …«, sagte Frau Krase. »Ich meine die sanitären Einrichtungen und die Schlafräume …«
»Weil es dort Strohsäcke gibt und fließendes Wasser nur im Waschhaus?«, vergewisserte sich Herr Ballnigel.
»Ja, zum Beispiel. Die Mädchen müssen immer hinüberlaufen, wenn sie sich waschen wollen. Und das sogar im Winter.«
Die Mitglieder der Kommission standen auf. Ballnigel sagte: »Von Strohsäcken ist noch niemand krank geworden. Ich habe in meiner Kindheit immer nur auf einem Strohsack geschlafen. Fragen Sie doch mal Ihre Großeltern. Die könnten Ihnen das Gleiche erzählen. Und denken Sie an die Erfahrung der Bewegung: Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Und an das Wort unseres Führers natürlich: Hart wie Kruppstahl soll unsere Jugend werden.« Er wandte sich an Dr. Scholten. »Mit Ihnen, Herr Doktor, muss ich noch ein Wörtchen unter vier Augen reden.«
Alle anderen verließen den Raum.
Ballnigel setzte sich auf Direktor Aumanns Stuhl, streckte die Beine weit von sich und sagte: »Man hat mir gemeldet, dass Sie einen engen Kontakt zu Kirche und Kloster dort oben pflegen. Zu eng, wie ich meine. Sie sind doch Parteigenosse.«
Er stand auf, trat direkt vor Dr. Scholten und tippte auf das Parteiabzeichen an dessen Jackenaufschlag. »Sie spielen die Orgel, ja, Sie erlauben sich sogar, in den Gottesdiensten gelegentlich den Vorbeter zu machen. Haben Sie vergessen, dass Sie für Ihre Zöglinge ein Vorbild sein müssen?«
»Ich wüsste nicht, dass es Gesetze oder Verordnungen gibt, die das, was ich tue, untersagen.«
»Gesetze! Verordnungen!« Ballnigel wurde laut. »Ich scheiße auf Ihre Scheinargumente. Es geht darum, dass Sie durch Ihr Verhalten die Erziehung der Mädchen in unserem nationalen Sinne sabotieren. Ich rate Ihnen, Ihre renitente Haltung zu überdenken und zu ändern. Bei erneuten Klagen werden wir mit Ihnen Schlitten fahren, Herr Doktor.«
Noch bevor Dr. Scholten etwas entgegnen konnte, drehte sich Ballnigel um, riss die Türen auf und ging über den Flur zum Ausgang. Die Stiefelabsätze schlugen hart auf die Fliesen.
Dr. Scholten stand wie erstarrt. Irgendwann kam Frau Krase herein und sagte: »Wir warten auf Sie, Herr Doktor. Die Kommission ist gerade mit dem Auto abgefahren. Der Direktor hat eine Flasche Cognac aufgemacht. Beutegut aus Frankreich. Er lädt uns alle zu einer kleinen Stärkung ein.«
Dr. Scholten sagte leise: »Das ist jetzt genau das Richtige. Das alles ist ja nur noch im Suff zu ertragen.«
Frau Krase lachte. »Das müssen ausgerechnet Sie sagen, Herr Doktor, Sie, der in der vorigen Woche noch behauptet hat, er habe sich noch niemals in seinem Leben einen Rausch angetrunken.«
»Jetzt habe ich einen nie gekannten gewaltigen Durst, Frau Kollegin«, sagte Dr. Scholten, hakte sich bei Frau Krase unter und ging mit ihr zu den anderen.
Es war ein kalter, klarer Tag. Ein paar Mädchen standen, eingemummt in ihre Wintermäntel, auf der Terrasse. Die Luft zitterte von einem tiefen Brummen. Die Mädchen beobachteten, wie hoch über dem Berg Bombergeschwader in sechs großen Pulks auf Wien zuflogen.
»Das sind mindestens dreihundert Flugzeuge«, sagte Irmgard zu Anna. »Lauter viermotorige Maschinen.«
Anna versuchte, die im Sonnenlicht silbern glänzenden Flugzeuge eines Pulks zu zählen, doch trotz der Kondensstreifen, die die Maschinen wie Kometenschweife hinter sich herzogen, gelang ihr das nicht. »Mindestens dreihundert«, bestätigte sie. »Fliegende Festungen. Amerikaner. Die armen Menschen, die dort leben, wo sie die Bomben abwerfen.«
Ruth, die gleich nach dem Silentium aus dem Tannenhaus herübergekommen war, fragte: »Müssen wir nicht in den Luftschutzraum, wenn sie kommen?«
»Nicht tagsüber. Nicht wenn wir sie dort weit über dem Berg fliegen sehen«, antwortete Irmgard. »Dann wollen sie nach Wien oder nach Wiener Neustadt.«
In das gleichmäßige Brummen der Pulks mischte sich ein anderer, schärferer Ton, setzte kurz aus, klang erneut auf, lauter als vorher.
»Da, da rechts vom Berg!«, rief Irmgard.
Nun sahen es alle. Viel größer als die sehr hoch fliegenden Bomber, langsamer auch, kam ein einzelnes Flugzeug ins Blickfeld, noch weit hinter den Türmen der Kirche, aber doch schon auf dieser Seite des Bergs. Es zog eine schwarzgraue Rauchfahne hinter sich her.
»Getroffen! Abschuss! Der kommt nicht mehr bis Wien!«, jubelten einige.
»Da, Fallschirme! Die sind abgesprungen«, sagte Anna. Ziemlich hoch über dem Flugzeug sah man zuerst vier weiße Fallschirme herunterschweben, einen Augenblick später einen fünften. »Einer fehlt noch! Die haben sechs Mann Besatzung.«
Die Maschine zog über dem Wald hinter dem Kloster ihre Bahn. Die Motoren stotterten.
»Da! Da springt noch einer.«
Der Fallschirm öffnete sich und wurde vom Wind in Richtung Quellenhof getrieben. Der Bomber sank immer tiefer und flog langsam und schwerfällig noch ein Stück über den Wald. Dann entschwand er den Blicken der Mädchen. Kurz darauf klang eine Detonation wie ein Donnergrollen zu ihnen herüber. Eine schwarze Rauchwolke, gesäumt von einem brandroten Rand, stieg über die Baumwipfel hoch in das Blau des Himmels. Der Fallschirm war von einem leichten Wind erfasst worden und schwebte auf das Kloster zu. Die khakifarbene Uniform des Piloten war deutlich zu erkennen. Der Fallschirm sank immer tiefer und verschwand schließlich hinter dem Dach des Quellenhofs. Anna, Ruth und ein paar andere Mädchen rannten um das Haus herum zur Straße.
Frau Lötsche rief: »Zurück ins Haus!« Und als die Mädchen dem Befehl nicht gleich folgten, schrie sie: »Jetzt aber schnell! Oder wollt ihr Stubenarrest?«
Aber die Mädchen waren schon um die Ecke gebogen. Der Fallschirm lag keine zwanzig Meter entfernt mitten auf der Straße. Der Pilot war offenbar gestürzt, hatte sich aber aufgerappelt und befreite sich von den Halteleinen. Er schien benommen zu sein. Schwankend erreichte er auf der anderen Straßenseite die Treppe zur Orangerie und hockte sich auf die unterste Stufe.
»Guck mal«, flüsterte Irmgard. »Der ist noch ganz jung. Der ist nicht viel älter als wir.«
Anna überquerte die Straße. Die anderen folgten ihr zögernd. Der Pilot, ein Milchbart noch, nahm ein Zigarettenpäckchen aus der Brusttasche seiner Uniform, fingerte eine Zigarette heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen. Seine Hände zitterten so stark, dass es ihm nicht gelang, ein Streichholz anzureißen. Er versuchte es ein Mal, ein zweites Mal, dann fiel das Streichholz auf die Erde. Da nahm Anna ihm das Streichholzmäppchen aus der Hand. Er zuckte zusammen und schaute ängstlich auf. Anna hielt ihm ein brennendes Streichholz an die Zigarette und er sog den Rauch tief ein.
Inzwischen hatte auch Frau Lötsche die Straße überquert. »Bist du denn völlig verrückt geworden«, fuhr sie Anna an. »Das ist einer von denen, die ihre Bomben auf unsere Städte werfen. Auf eure Eltern.«
»Ist doch noch fast ein Junge«, sagte Anna.
Der Pilot stieß leise ein paar Worte hervor.
»Das ist kein Englisch, oder?« Frau Lötsche war überrascht.
»Nein.« Anna beugte sich zu ihm vor. Wieder flüsterte er etwas.
»Das ist, glaube ich, Polnisch«, sagte sie.
»Polnisch?«, wunderte sich Frau Lötsche. »Seit wann kannst du Polnisch?«
»Ich kann den Mann nicht genau verstehen, aber es ist Polnisch. Ich weiß, wie das klingt.«
»Lutka!«, rief Ruth, »Lutka kann ihn verstehen.« Sie rannte ins Haus und holte die Polin aus der Küche. Frau Zitzelshauser folgte ihnen.
Lutka sprach den Piloten an.
Er schaute auf und antwortete auf ihre Fragen.
Auch der Direktor kam und wies die Mädchen barsch in die Halle zurück. »Ich habe schon die Polizeistation im Dorf benachrichtigt«, sagte er. »Man hat mich informiert, dass die Beamten bereits unterwegs sind.«
Frau Lötsche stand hinter der Polin und befahl ihr: »Schluss jetzt, Lutka. Geh sofort ins Haus zurück.« Und zum Direktor gewandt, sagte sie: »Wer weiß, was die beiden miteinander bereden.«
Lutka weigerte sich und ließ nicht davon ab, mit dem jungen Piloten zu sprechen. »Mowa ojczysta, Sprache von Heimat«, sagte sie.
Frau Lötsche versuchte, Lutka an der Schulter wegzuziehen, aber Lutka schlug die Hand heftig weg und schimpfte laut auf die Lehrerin ein.
»Lauter polnische Flüche«, flüsterte Anna Irmgard zu.
Lutka und Frau Lötsche starrten sich wütend an.
Zwei Gendarmen kamen und sprangen von ihren Fahrrädern. Der ältere zog seine Pistole und richtete sie auf den Piloten. Der jüngere riss ihn hoch und durchsuchte ihn.
»Keine Waffen«, sagte er.
Der Pilot zog seinen Ausweis aus der Innentasche seiner Jacke und reichte ihn dem älteren Polizisten. Der setzte seine Brille auf und las: »Stan Bronski. Ist neunzehn Jahre alt. Kommt aus Ohio. Wir nehmen ihn mit.« Zu Direktor Aumann sagte er: »Sie können doch sicher Englisch sprechen. Sagen Sie ihm, dass er jetzt Kriegsgefangener ist.«
»Weiß er doch längst«, murmelte Anna.
Frau Lötsche wies sie zurecht. »Vorlautes Blag. Halt den Mund!«
Der Direktor sagte, er unterrichte Mathematik und Deutsche Geschichte und seine Englischkenntnisse seien begrenzt.
Anna sprang ein und stotterte etwas von »war« und »prisoner«.
»Ich sage ihm.« Lutka redete wieder mit dem Piloten.
»Hör auf damit!«, rief Frau Lötsche erbost.
»Nazi-Gans, dämliche«, fauchte Lutka. Ihre Augen funkelten und sie schien außer sich zu sein.
»Lutka, beherrsch dich!«, rief Frau Zitzelshauser.
»Jetzt reicht’s aber«, mischte der Direktor sich ein. »Sofort alle ins Haus.« Zu Frau Lötsche sagte er: »Das muss den Behörden gemeldet werden. Das wird ein Nachspiel haben.«
Der Polizist, der den Piloten durchsucht hatte, wandte sich an den Direktor. »Ist das wirklich nötig? Wenn man erregt ist, kommt einem schon mal ein falsches Wort über die Lippen.«
»Aber Kollege!«, tadelte ihn der andere Polizist. »Das können wir uns von einem Polackenweib nicht gefallen lassen.«
Frau Zitzelshauser schüttelte den Kopf. »Lutka, Lutka, was machst du nur für Sachen?«
»Ich will wegen des Polenmädchens nicht in Schwierigkeiten kommen«, sagte der Direktor. »Ich werde beim Ortsgruppenleiter anrufen.«
Als die Mädchen beim Abendessen saßen, fuhr ein Auto vor. Zwei Zivilbeamte stiegen aus und holten Lutka aus der Küche. Sie packten sie an den Armen und führten sie durch den Speisesaal hinaus. Frau Zitzelshauser rief ihnen nach, dass Lutka noch ihren Mantel holen müsse, doch die Männer winkten ab. Die Autotür wurde hinter Lutka zugeschlagen. Sie fuhren in Richtung Tal davon und verschwanden in der Dunkelheit.
»Das arme Ding«, sagte Frau Zitzelshauser leise. »Die kommt nie mehr zurück.« Sie machte sich Vorwürfe. Der Ortsgruppenleiter war ihr gut bekannt. Ihr Vater und er, der Loisl, hatten miteinander Karten gespielt. Wenn sie ihn angerufen hätte … Vielleicht hätte das genügt, um die Sache unter den Tisch fallen zu lassen.
Eines Tages wurde Ruth überraschend von Esther Salm eingeladen. Die Lagermädelführerin erlaubte ihr, bis zum Abend zu bleiben. Esther wohnte mit ihrer Mutter allein in dem Haus am Hang. Der Schotterweg dorthin zweigte von der Landstraße ab und führte ziemlich steil bergan. Man brauchte ungefähr zehn Minuten.
Frau Salm war eine schlanke Frau von etwa vierzig Jahren. Durch ihr kurz geschnittenes schwarzes Haar zogen sich die ersten grauen Strähnen. Die dunklen Augen wurden von schmalen Brauen hoch überwölbt. Frau Salm widmete sich zwar den Kindern, stellte ihnen auch ein paar Plätzchen hin und beteiligte sich ab und zu an ihren Spielen, aber Ruth fand, dass sie dabei merkwürdig ernst blieb. Selbst wenn sich ihre Lippen zu einem freundlichen Lächeln kräuselten, schauten ihre Augen stets ein wenig traurig.
Bei Ruths erstem Besuch hatte Frau Salm sie in ein längeres Gespräch verwickelt. Später sagte Esther zu Ruth: »Meine Mama hat dich ganz schön ausgefragt, nicht?«
»Hab ich nicht gemerkt, aber ich glaub, es stimmt«, antwortete Ruth. Am besten gefiel es Ruth, dass Esthers Mutter sich an das große schwarze Klavier setzte. Sie zündete die beiden Kerzen an, die vorn in den Halterungen angebracht waren, blätterte dann in Notenheften, schlug schließlich eines auf und begann zu spielen. Ruth hatte den Eindruck, dass sie überhaupt nicht auf die Noten schaute, sondern dass ihre Finger die Tasten wie im Traum berührten.