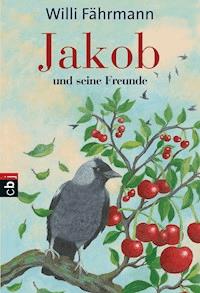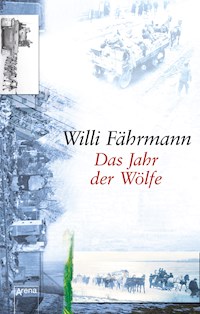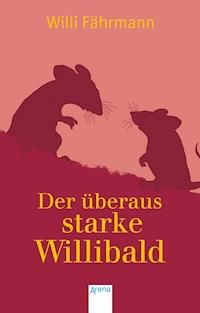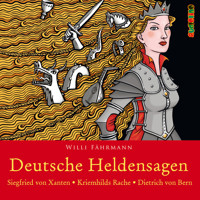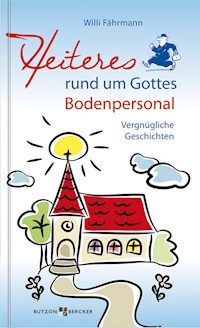5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bienmann-Saga
- Sprache: Deutsch
Berlin im Jahr 1919: Paul Bienmann findet den 13-jährigen Bruno, der verzweifelt neben der Leiche seines älteren Bruders kniet. Aus vorläufiger Fürsorge wird eine ständige Verantwortung. Als Bruno Jahre später die Spur des Offiziers entdeckt, der seinen Bruder erschossen hat, muss er sich entscheiden: für die ersehnte Rache oder für seinen Freund Paul und dessen Verlobte Franziska, deren gemeinsame Zukunft durch eine solche Tat zerstört würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Willi Fährmann,geboren 1929 in Duisburg, lebt heute in Xanten am Niederrhein.Mit seinem Gesamtwerk, für das ihm neben zahlreichen Einzelauszeichnungender Große Preis der deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteraturund der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen wurden, gehört erzu den profiliertesten Autoren der deutschen Kinder- und Jugendliteratur.Seine im Arena Verlag erschienenen Bücher haben längst eine Auflagenhöhevon einer Million überschritten.
Titel
Willi Fährmann
Zeit zu hassen,Zeit zu lieben
»Preis der Leseratten des ZDF«Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012© 1985 by Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80211-4www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
1
Sie rannten über den Platz, hetzten in wilder Flucht auf die Straßen und Gassen zu, die in die Richtung der Arbeiterviertel führten.
Einige schlüpften auch in Toreinfahrten oder rüttelten an Haustüren. Sie wollten sich in den verwinkelten Hinterhäusern und finsteren Höfen verbergen. Flüche und verzweifelte Schreie klangen auf, wirre Kommandos wurden gegeben, die hohen Häusermauern rund um den Platz warfen den Peitschenknall ziellos abgegebener Schüsse zurück.
Inmitten des Lärms, zunächst kaum wahrnehmbar, wuchs ein Geräusch, wie ferner Trommelschlag erst, härter dann und näher und näher, Eisen schlug auf Stein, Stiefeltritte. Links und rechts an den Häuserzeilen der Hauptstraße entlang marschierten Kolonnen. Die Spitzen erreichten den Platz, Soldaten in feldgrauen Uniformen, Stahlhelm an Stahlhelm. Deutlich waren sie im ersten Morgenlicht zu erkennen. Sie kamen wie Sieger daher, aufrecht, ohne besonders auf Deckung zu achten, wollten versprengte Gruppen der Aufständischen jagen. Eine scharfe Stimme schrie Befehle. Die Kolonnen schwärmten geordnet aus, die Flügel schneller als die Mitte. Die Soldaten trugen ihr Gewehr schussbereit unter dem Arm und einige schleppten Maschinengewehre mit sich. Die Backen einer Zange umschlossen den Platz. Aber es gab nichts mehr zu greifen. Die rebellierenden Arbeiter, die Spartakisten, alle, die bereit gewesen waren, einen anderen Staat zu erzwingen, hatten sich verlaufen. Nur noch ein Junge war zurückgeblieben. Er kniete mitten auf dem Platz neben einem Mann, der lang ausgestreckt auf dem Basaltpflaster lag. Der Mann trug eine abgerissene Matrosenuniform. Der Junge starrte voller Angst auf die heranrückenden Soldaten. Einige feuerten ihre Gewehre ab, zielten nach den letzten Fliehenden, schossen blind in die Toreinfahrten hinein, Kugeln prallten von den Häuserwänden und sirrten durch die Luft. Die Männer achteten nicht auf den Jungen. Sie erreichten die Mitte des Platzes, liefen an ihm vorüber und strebten den gegenüberliegenden Häusern zu. Einer jedoch, ein Offizier offenbar, schon einige Schritte an dem Jungen vorbei, kehrte zurück und zerrte den Jungen am Arm von dem Matrosen fort. Dieser Matrose zog mit letzter Kraft eine Handgranate aus dem Gürtel. Er versuchte vergebens, sie zum Munde zu führen, um die Abreißschnur mit den Zähnen zu ziehen. Schlaff sank sein Arm nieder und die Handgranate entglitt ihm. Der Offizier, die Pistole in der linken Hand, schoss zweimal. Lang ausgestreckt und regungslos lag der Matrose auf dem Pflaster.
Der Offizier blieb einen Augenblick unschlüssig stehen, stülpte den Stahlhelm nach vorn vom Kopf und wischte sich mit dem Ärmel die Stirn. Dann drehte er sich zu dem Jungen. Der duckte sich nieder. Er redete auf den Jungen ein, doch der rührte sich nicht. Schließlich zog der Offizier eine flache Flasche aus der Seitentasche, nahm hastig einen Schluck und rannte weiter, schnell jetzt, und suchte Anschluss an seine Truppe zu gewinnen. Im Laufen setzte er den Stahlhelm wieder auf.
Der Junge raffte ein Transparent, das irgendwer weggeworfen hatte, vom Boden auf, kroch auf allen vieren zu dem Matrosen zurück und bedeckte dessen Leib und Beine mit dem Tuch. Dann setzte er sich auf das Pflaster und bettete den Kopf des Toten in seinen Schoß.
Die Fliehenden waren längst verschwunden. Der Tritt der Soldaten verhallte. Der Platz lag ruhig in der Dämmerung des 12. Januar. Von fern läutete eine Glocke zum Frühgottesdienst. Paul hatte alles aus einem sicheren Versteck mit angesehen. Als der Lärm aufwallte, die abgerissenen Gestalten über den Platz strömten und fortrannten, da hatte er gewusst, was kommen würde. Die letzten Kriegsjahre hatten es ihm beigebracht, Deckung zu suchen. Manchmal ertappte er sich dabei, wie er in völlig friedlichen Situationen nach Türlöchern Ausschau hielt oder nach niedrigen Mauern. Bei seinem letzten Urlaub in Liebenberg hatte er sich jede Bodenwelle eingeprägt, jeden Graben längs der Landstraßen wahrgenommen, obwohl der Krieg gegen Rußland schon über einen Monat zu Ende gewesen war und Ostpreußen nichts mehr befürchten musste.
Als die ersten Schüsse peitschten, hatte er sich durch einen ebenerdigen Fensterspalt in einen Keller gezwängt. Aus diesem Schlupfloch heraus hatte er mit angesehen, wie zwei Kompanien des Majors von Stephani die geschlagenen Spartakisten und den bunt zusammengewürfelten Haufen von Arbeitern jagten. Sieben Tage lang war in Berlin Revolution. An diesem Sonntag, dem 12. Januar 1919, hatten Ebert und seine Anhänger gesiegt.
Der Nieselregen hatte aufgehört. Der Himmel war heller geworden. Einige dunkle Wolken zogen schnell über die Hausdächer hin.
Paul kroch aus dem Keller, klopfte sich den Schmutz von den Kleidern und ging, zögernd erst, schließlich aber entschlossen, auf den Jungen zu, der da unbeweglich in der Morgenkälte hockte. Erst als Paul dicht vor ihm stand, schaute der Junge mit aufgerissenen Augen hoch, starr vor Angst.
Aber dann huschte Leben über sein Gesicht. Er hob die Hand und rief: »Mensch, Bienmann, Paul! Gott sei Dank!«
Paul erkannte den Jungen nicht, wohl aber den, der da lag mit dem spitzen Totengesicht, die Augen noch geöffnet. Sein Körper war halb von dem Transparent bedeckt. Die Aufschrift war deutlich zu lesen:
»Nicht schießen, Brüder!«
Paul beugte sich hinunter und drückte dem Toten die Lider zu. Wilhelm Kurpek lag da, wenig älter als er. In Liebenberg war Paul mit ihm aufgewachsen. Er hatte ein paar Häuser die Dorfstraße abwärts gewohnt. Wilhelm Kurpek, ein Freund aus Pauls Kindertagen.
»Und wer bist du?«, fragte Paul den Jungen.
»Ich bin Bruno, der Bruder vom Wilhelm. Kennst du mich denn nicht mehr?«
Bruno war Kurpeks Jüngster, der Einzige, der außer Wilhelm noch übrig geblieben war. Paul hatte einen dicklichen Knirps aus der Nachbarschaft vor Augen, der diesem aufgeschossenen Jungen nicht ähnlich sah.
»Wer du bist, das habe ich gleich gesehen«, sagte der Junge.
Ein Flachwagen wurde von einem knochigen Pferd über den Platz gezogen. Drei Männer saßen dicht beieinander vorn auf dem Bock. Der, der die Zügel hielt, lenkte das Fuhrwerk bis hin zu der Gruppe. Als er Paul und den Jungen erreicht hatte, zog er die Zügel straff und rief: »Hüh!«
Zwei sprangen herab und beugten sich über den daliegenden Mann. Der größere sagte: »Noch einer. Diese verdammten Truppen haben die Revolution in Blut erstickt.«
Vom Bock herunter fragte der Fuhrmann: »Was ist mit dem da? Kennt ihr ihn? Wisst ihr, wohin damit?«
Paul schaute den Jungen an. »Wo wohnt ihr?«, fragte er.
Der Junge stand auf und hob die Schultern. »Seit Tagen wohnen wir nirgendwo«, antwortete er. Er deutete in die Richtung, in der die Soldaten verschwunden waren. »Sie haben uns vor sich hergetrieben.«
»Na, dann los«, befahl der vom Bock herunter. Die beiden Männer fassten die Leiche und warfen sie zu den anderen, die bereits auf dem Karren lagen. Der Junge klammerte sich an Paul, wandte aber das Gesicht nicht ab, sondern verfolgte jede Bewegung der Männer genau. Paul spürte durch die dicke Jacke hindurch das Zittern des Jungen.
»Name, Alter?«, fragte der Mann auf dem Bock.
»Kurpek, Wilhelm«, antwortete Paul anstelle des Jungen. »Einundzwanzig wird er sein, stammt wie ich aus Liebenberg, Kreis Ortelsburg.«
»Er wäre nächste Woche zweiundzwanzig geworden«, sagte der Junge leise.
Die beiden Männer sprangen auf die Ladefläche und streuten aus einem Sack Kalk über den Toten. Inzwischen hatte der Fuhrmann die dürftigen Angaben mit einem Bleistift in einer schwarzen Kladde notiert.
»Zum Friedhof«, sagte er, bevor er das Pferd antrieb.
Paul stand noch eine Weile, den Jungen an sich gedrückt, und konnte seinen Blick lange nicht von dem tellergroßen Blutfleck losreißen, Blut, das auf das Pflaster gesickert war. »Nicht schießen, Brüder!« Neben dem Transparent lag Wilhelms Matrosenmütze. Der Junge hob sie auf.
»Was nun?«, fragte er.
»Du gehst erst mal mit mir, Bruno«, versuchte Paul ihn zu beruhigen. »Später sehen wir dann schon, was wird.« Paul hoffte, dass seine beiden Zimmergenossen bereits unterwegs sein würden. Seit Tagen zogen sie morgens zu ihrer Arbeitsstelle, aber keine Hand rührte sich bei der AEG. Selbst am Sonntag hielten die Arbeiter das Werk besetzt. Die Spartakisten, die Arbeiterräte, die Vertrauensleute hatten mit ihren Ideen, mit ihren Reden eine ungeheure Zustimmung gefunden. Genau wusste niemand mehr zu sagen, ob es überhaupt ein Spartakisten-Aufstand war, der da in der ersten Januarhälfte ausgebrochen war. Waren die radikalen Spartakisten nicht nur der Funke in einem Benzinfass gewesen? Der Kaiser saß sicher in Holland. Die Fürstenherrschaft in den Ländern war weggefegt worden. Was sollte werden?
Es kam Paul darauf an, den Jungen zunächst einmal unbemerkt an der Zimmertür der Wohnungswirtin vorbeizuschmuggeln. In Ruhe wollte er nachdenken, bevor ihm ausführliche Erklärungen abverlangt wurden.
Kurz nach acht lief er die Treppen des Hinterhauses bis zum zweiten Stock hinauf. Er hatte dem Jungen eingeschärft, leise zu sein. Der lange, fensterlose Flur lag düster. Frau Podolskis Küchentür stand wie üblich einen Spaltbreit offen und warf eine Lichtschranke quer durch den Flur.
»Ich bin’s, der Paul, Frau Podolski«, sagte Paul im Vorbeigehen.
»Bist spät dran heut«, antwortete sie träge aus der Küche.
»Es gab wieder Krawalle. In der Lindenstraße war allerhand los. Sie sollen den ›Vorwärts‹ gestürmt haben«, rief er, schob den Jungen in die Kammer und wartete einen Augenblick. Manchmal öffnete die Zimmerwirtin die Küchentür vollends, blieb im Türrahmen stehen und wollte mit ihm reden. Diesmal aber hörte er kein Stühlerücken, kein Schlurfen der Filzpantoffeln.
Er folgte dem Jungen in die Kammer. Durch das schmale Fenster fiel das Morgenlicht. Drei Betten standen in dem engen Raum. Ein riesiger dunkler Kleiderschrank füllte die Stirnwand. Pauls Bett war ordentlich gemacht. Die anderen Betten lagen zerwühlt und so, wie die Schläfer herausgestiegen waren.
»Krieche in ein Bett«, flüsterte Paul. »Ich werde gleich Brot und Kaffee bringen. Verhalt dich still.« Paul hängte Mütze und Jacke an einen Kleiderhaken, nahm aus dem Schrank Handtuch und Seife und ging zurück in den Flur. Dort befand sich, der Kammertür gegenüber, ein Messingkran über einem ziemlich großen steinernen Becken. Er wusch sich und prüfte mit den Fingerspitzen seinen Bart. »Geht noch«, befand er. Dann klopfte er an die Küchentür und trat ein.
Frau Podolski saß in ihrem bunten Morgenkittel am Tisch und las die Zeitung. Die Frau mochte um die fünfzig sein. Ihr Haar war straff zurückgekämmt und zu einem Knoten gebunden.
»Der Kaffee steht auf dem Herd«, sagte sie, ohne aufzublicken. Er schüttete sich die große Blechtasse randvoll. Heiß und dunkel war das Gebräu, aber das war das Einzige, was an echten Kaffee erinnerte. Frau Podolski nahm geröstete Getreidekörner, Malzkaffee eben. Brot, ein kleines Töpfchen Schmalz und ein großes Messer lagen auf der blank gescheuerten Tischplatte. Paul schnitt drei dicke Scheiben herunter, setzte an, eine vierte zu nehmen, da fing er den missbilligenden Blick von Frau Podolski auf und zögerte. Sie brummte: »Das sind mir vielleicht Sieger. Lassen uns glatt verhungern. Die Menschen fallen um wie die Fliegen. Hungertote in Berlin! Hat da der Mensch noch Töne? Der Krieg ist längst aus und Kinder müssen vor Hunger und Kälte sterben. Und Alte auch. Ist das nicht zum Heulen? Und drüben auf der anderen Seite des großen Teiches wissen sie nicht, wohin mit all ihrem Weizen. Füttern doch wahrhaftig die Schweine damit. Verdammt sollen sie sein! Ist ne verdrehte Welt, Paul, ist ne völlig verdrehte Welt.«
Paul kratzte dünn Schmalz auf das Brot.
»Was war mit den Krawallen?«, fragte sie.
»Ich habe nur das Ende gesehen. Quer über den Platz sind sie gerannt, zerstreute Spartakusleute, Soldaten vom Freikorps.«
»Haben die Kerle die Nase denn immer noch nicht voll? Erst die Schießerei am Heiligen Abend und jetzt seit Tagen nichts als Aufruhr. Das neue Jahr fängt ja gut an.«
Sie schlürfte geräuschvoll von ihrem Kaffee.
»Vier Jahre Schießerei, das war doch wohl genug, oder?«
»Viel zu viel. Jeder Schuss war zu viel«, stimmte er ihr zu.
Sie faltete die Zeitung zusammen. Paul erkannte die Weihnachtsnummer der »Roten Fahne«. »Eberts Blutweihnacht«, hieß die riesige Schlagzeile.
»Was die Radikalen nur gegen den Ebert haben«, sagte Frau Podolski. »Ist doch ein anständiger Mann. Die sollen den mal lassen, dann können wir in Berlin bald wieder in Ruhe über die Straße gehen. Na, nächsten Sonntag ist Wahl. Ich könnte den Ebert glatt wählen.«
»Ich nehme meinen Kaffee mit«, sagte Paul. »Ich bin müde. Wir haben heute Nacht schwer geschuftet. Eine Lokomotive musste bis zum Morgen repariert sein.«
Frau Podolski blickte über ihren Brillenrand.
»Bist so aufgedreht, Paul«, sagte sie. »Versau mir nicht das Bettzeug. Frühstücken im Bett, das ist was für feine Herrschaften, aber doch nicht für unsereinen«, maulte sie hinter ihm her.
Bis an die Ohren hatte sich Bruno unter das Federbett verkrochen. Sein Gesicht war verschmiert. Er hatte geweint.
Paul teilte Kaffee und Brot mit ihm. »Nach elf kommt die Podolski«, sagte er. »Sie richtet dann das Zimmer her. Schlaf nur, Bruno. Ich lasse mir bis dahin etwas einfallen.«
Als er merkte, dass Bruno ihn unentwegt anstarrte, fügte er hinzu: »Hab keine Angst, Junge. Der Wilhelm war mein Freund. Du bist sein Bruder. Wir Liebenberger halten zusammen. Werd ich dich etwa im Stich lassen?«
Bruno drehte sich zur Wand. Paul deckte ihm den Rücken zu und legte sich auf sein Bett. Er überlegte hin und her. Es war eine verzwickte Situation. Die Kurpeks hatten sich damals, als die Russen 1914 über die Grenze nach Ostpreußen eindrangen, in Richtung Ortelsburg aus dem Staube gemacht. Sie waren jedoch von der Front überrollt worden. Seitdem blieben sie verschollen. Einige im Dorf munkelten, die Kurpeks hätten Schulden gehabt. Sie hätten die Gelegenheit zum französischen Abschied genutzt. Dem Pack habe ja nicht einmal mehr das Hemd am Hintern gehört. Aber die Lästerzungen verstummten, als das Land wieder frei war und der achtjährige Bruno und sein Bruder Wilhelm, kaum siebzehn, allein zurückkehrten. Die beiden Jungen waren damals auf den Wagen der Warczaks aufgesprungen. Die Warczaks waren mit den Kurpeks über drei Ecken verschwägert und wohnten zwei Häuser weiter die Dorfstraße abwärts. Die beiden Jungen hatten seit dem Tage der Flucht von ihren Eltern und Geschwistern nichts mehr gehört und gesehen. Weil keine anderen Verwandten in Liebenberg lebten, blieben Bruno und Wilhelm bei den Warczaks. Knapp ein Jahr später musste Wilhelm zu den Soldaten. Er hatte es durchgesetzt, zur Marine zu kommen.
Der alte Lehrer Kolukken bot an, den Bruno bei sich aufzunehmen, weil er selbst keine Kinder habe. Der Junge habe einen hellen Verstand und aus dem könne, wenn er brav bleibe, wohl ein Pfarrer werden. »Oder ein Lehrer, wenn er weniger brav bleibt«, hatte der alte Warczak gesagt und dem Jungen die Wahl gelassen, zum Lehrer zu gehen und später ein Studierter zu werden oder bei den Warczaks zu bleiben und, wenn die Zeit dafür komme, ein Handwerk zu lernen, vielleicht Zimmermann bei Lukas Bienmann zu werden.
Der Junge kannte den alten Lehrer Kolukken als einen aufbrausenden grobschlächtigen Mann, der oft seinen Ledergürtel von der Hose nahm und die Kinder versohlte. Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Er blieb bei den Warczaks.
»Weiß der Kuckuck«, murmelte Paul, halb schon im Schlaf, »weiß der Kuckuck, wie der Junge nach Berlin gekommen ist.« Ihm fiel ein, dass er 1917 noch ein paar Tage Urlaub in Liebenberg verbracht hatte. Er war mit seinem Vater auf den Bau gezogen. Der alte Lukas Bienmann war froh, für ein paar Tage seinen Sohn in der Kolonne zu haben, der einen schweren Sparren allein schleppen konnte. Auf dem Bau hatte Paul mit dem Warczak geredet und nach Wilhelm Kurpek gefragt. Der Warczak war wütend geworden und hatte gesagt, der Wilhelm sei ein verdammter Roter, und von einem, der schlecht über seinen Kaiser rede, wolle er nichts mehr wissen. Von Bruno war nicht die Rede gewesen.
Und nun hatte er den Bruno aufgelesen. Wie eine Laus im Pelz. Du kommst daran und weißt nicht, wie du sie wieder loswerden sollst, dachte er, bevor er in einen flachen Schlaf sank.
Erschrocken fuhr er hoch, als Frau Podolski einen wüsten Fluch ausstieß und schrie: »Perunje, wer hat mir dieses verdammte Kuckucksei ins Nest gelegt?«
Ihre schwarzen Augen, in einem Faltengespinst tief eingebettet, funkelten. Sie riss das Oberbett weg. Auf dem Strohsack lag der Junge und machte sich so klein, dass er beinahe in seinem Hemd verschwand.
»Ich habe ihn mitgebracht«, bekannte Paul. Er befürchtete, dass sie ihn nun aus Kost und Logis feuern würde. Zu seiner Verwunderung geschah das nicht. Sie schaute das Häufchen Elend an. Schreck und Härte wichen aus ihrem Gesicht. Sie warf dem Jungen die Zudecke wieder über den Körper und sagte: »Kommt in die Küche, ihr zwei. Wir werden darüber reden.«
Mit einem Rest Groll in der Stimme fügte sie hinzu: »Wirst hoffentlich eine gute Erklärung dafür haben, du Satan!«
»Wasche dich sauber und kämme dich ordentlich«, sagte Paul zu Bruno. »Auf so etwas legt sie Wert.«
Als die Wanduhr zwölf schlug, hatte Paul Brunos Geschichte erzählt. Die Lücken hatte der Junge mit wenigen Sätzen gefüllt. Der Wilhelm habe ihn von Ostpreußen mit nach Berlin genommen. Sein Bruder sei Arbeiter bei der AEG gewesen. Vor ein paar Tagen hätten sie ihre gute Schlafstelle in Pankow verloren, weil die Wirtin mit den Roten nichts mehr zu tun haben wollte. Sie hätten sich in einem verlassenen Bahnwärterhäuschen eingerichtet. Viermal sei er mit dem Wilhelm losgezogen. Der Bruder habe zu den Spartakisten und zu ihrem Führer Karl Liebknecht gehört. Er wollte, dass alles ganz anders werde in Deutschland. Eine Räterepublik müsse erkämpft werden.
»Alle Macht den Räten!«, schloss der Junge. Glanz war in seine Augen getreten. »Alle Macht den Räten, das hat der Wilhelm immer gesagt.«
Frau Podolski hatte gespannt zugehört. »Euer Lehrer hatte recht, damals in eurem Dorf. Hast ein helles Köpfchen, Junge. Aber dein Bruder, der hat sich nicht klar ausgedrückt. ›Alle Macht den Räten‹, hat er gesagt. Gemeint hat er aber bestimmt: ›Alle Macht den Roten‹, Diktatur statt Demokratie.«
Als der Junge seine Lippen trotzig zusammenpresste, sagte sie: »Bürschchen, bei mir wäre er auch rausgeflogen.«
Sie dachte eine Weile nach. Schließlich sagte sie: »Aber der Paul Bienmann, der ist anders. Der ist ein besonnener Mann. Wenn der nen Taler für dich zahlt, drei Mark die Woche, dann kannst du von mir aus hier wohnen.«
So wurde Paul die Entscheidung, was mit dem Bruno Kurpek geschehen sollte, aus der Hand genommen.
»Wie eine Laus im Pelz«, murmelte er.
Frau Podolski füllte das Mittagessen aus einem großen Topf auf die Teller. Es gab Sauerkraut und weil es Sonntag war, legte sie jedem ein Stück Rippchen dazu.
»Viel Knochen, wenig Fleisch«, sagte sie. »Drei Stunden hab ich angestanden dafür. Jämmerliche Zeiten.« Sie zuckte die Schultern.
Bruno aß, als ob er tagelang nichts mehr zwischen die Zähne bekommen hätte.
»Junge, Junge«, sagte Frau Podolski, »ich glaube, drei Mark für einen solchen Vielfraß sind entschieden zu wenig.«
»Es hat geschmeckt wie früher in Liebenberg«, sagte der Junge.
Frau Podolski schien das zu gefallen. Jedenfalls sang sie leise vor sich hin, als sie später die Teller abwusch und der Junge wie selbstverständlich das Trockentuch nahm.
2
Frau Podolski machte sich stadtfein, wie sie es ausdrückte. Die vier Kostgänger saßen noch in der Küche rund um den Frühstückstisch.
»Wir werden uns diesen 19. Januar 1919 merken müssen«, sagte Robert, ein blonder, untersetzter Mann von etwa dreißig Jahren.
»Aber sicher«, stimmte Frau Podolski zu. »Zum ersten Male dürfen wir Frauen in diesem Jahr zur Wahl gehen.«
»Ich dachte mehr an das Rosinenweißbrot, das Sie gebacken haben«, versuchte Robert sie zu necken.
»Es hat herrlich geschmeckt«, schwärmte Bruno. »Seit Jahren habe ich kein Rosinenbrot mehr gegessen.«
»Rundherum hungern alle, leben von der Hand in den Mund, und Frau Podolski kann Rosinenbrot auf den Tisch stellen«, wunderte sich Eduard.
Frau Podolski freute sich offenbar über sein Lob. Eduard Pietz war nämlich ein wortkarger Geselle. Er hatte in seinem zweiten Lehrjahr einen Arbeitsunfall gehabt und war gehbehindert, kaum merklich zwar, aber zum Militär hatten sie ihn nicht geholt.
»Eure Frau Podolski hat für so etwas die richtige Nase«, prahlte die Zimmerwirtin. »Die weiß, wo es langgehen soll.« Sie holte tief Atem und fügte hinzu: »Anders als ihr Radikalinskis. Viel Geschrei und nichts dahinter.«
»Streichen Sie auf dem Wahlzettel alles durch, Frau Podolski, und schreiben Sie drauf: ›Die neue KPD!‹ Sie werden sehen, wir krempeln den Staat um«, riet Robert ihr. »Die Diktatur des Proletariats …«
»So weit kommt es noch«, unterbrach Frau Podolski ihn. »Ich bin für eine Republik. Keiner soll mir diktieren. Kein Kaiser und kein Proletariat. Mehrheiten sollen entscheiden.«
»Lass sie doch, Robert«, sagte Eduard. »Sie wählt, wenn ich das richtig sehe, sowieso das Zentrum.«
»Nee, Junge. Katholisch bin ich zwar, aber ob die, die da ganz vorn in den Kirchenbänken sitzen, ob die wissen, wie es uns Arbeitern zumute ist? Mein Mann hat schon die Sozis gewählt, als ihr noch eure Windeln voll gemacht habt. Vor Verdun ist er im Juni 1916 gefallen. Ich übernehme seine Stimme.«
Sie zeigte mit der ausgestreckten Hand auf ein braunes Soldatenfoto an der Wand, an dessen Rahmenecke sie ein schwarzes Bändchen befestigt hatte.
»Ich denke, ich wähle den Ebert.«
»Friedrich Ebert hat so eine schöne Frisur und einen treuen Seehundsblick«, lachte Paul Bienmann. »Auf den fliegen die Frauen.«
»Ebert schafft Ruhe und Ordnung, du Milchbart. Und überhaupt, die Wahl ist schließlich geheim. Was geht es euch an, wohin ich mein Kreuzchen male.« Sie schob davon.
»Aufgetakelte alte Fregatte«, schimpfte Eduard hinter ihr her.
»Lasst sie«, lachte Paul. »So altmodisch sie auch ist, die Fregatte schießt aus allen Rohren.«
Für Eduard schien es kein Spaß zu sein. »So Leute wie die Podolski, die sorgen dafür, dass alles beim Alten bleibt. Die Kommissköppe, die Richter, die Lehrer, die Beamten, alles bleibt wie vor dem Krieg. Nur, wo sonst der Kaiser saß, da setzen sich jetzt andere hin. Meint ihr denn, die Offiziere, die Freikorps, die Herren von und zu, die wollen eine Demokratie? Die würden alle lieber heute als morgen ihren Kaiser wieder auf den Thron setzen.«
Paul ließ sich nicht weiter auf politische Gespräche mit Eduard ein. Immer zog er den Kürzeren und kam sich vor wie ein Blödkopf. Er verstand einfach nicht, was Eduard eigentlich wollte, wie das werden solle, wenn die Arbeiter- und Soldatenräte allein am Ruder wären. Die einen sagten Hü, die anderen sagten Hott.
»Ich gehe auch los«, sagte Paul. Er zog seine Jacke über und schlang sich den Wollschal um den Hals. »Vergiss deine Mütze nicht«, sagte er zu dem Jungen. »Es ist kalt heute.«
Bruno zog die Matrosenkappe seines Bruders aus der Tasche. Sie war ihm zu groß, aber das machte ihm nichts aus.
Eduard sagte: »Der Wilhelm, das war ein Genosse von echtem Schrot und Korn. Der würde sich im Grab herumdrehen, Bruno, wenn er sehen könnte, dass du mit dem Bienmann herumziehst.«
»Lass den Wilhelm aus dem Spiel!«, rief Paul. »Der Wilhelm war mein Freund. Und euch, euch ist doch der Junge gleichgültig.«
»Jaja, geh du nur und wähle, was dir deine Pfaffen sagen! Nur immer schön zahm«, schrie Robert den beiden in den Flur nach und schlug die Küchentür heftig zu.
»Wenn ich wählen dürfte, ich wüsste schon, welche Partei ich ankreuzen würde«, sagte Paul mehr zu sich selbst als zu dem Jungen.
»Welche denn?«, fragte Bruno.
»Geheime Wahl!«, lachte Paul. »Und außerdem werde ich erst am 22. März volljährig.«
Sie gingen in die Messe. Die Kirche war ziemlich voll. Sie blieben hinten stehen. Von der Predigt war dort kaum ein Wort zu verstehen und der Weihrauchduft, den Paul gern roch, hatte sich fern von Altar und Kanzel längst verflüchtigt.
»Seit ich mit dem Wilhelm aus Liebenberg weg bin, war ich überhaupt nicht mehr in der Kirche«, sagte Bruno.
»Hat dir was gefehlt?«, fragte Paul.
Der Junge schwieg, sagte aber dann doch: »Eigentlich habe ich es erst richtig in der vorigen Woche auf dem Platz gemerkt. Oder auch bei der Schießerei beim Vorwärts-Haus in der Lindenstraße. Ganz plötzlich spürst du es. Du willst vielleicht gar nicht, aber auf einmal betest du.«
»Merk dir’s«, sagte Paul. »Schade, dass der Sonnenschein heute nicht gepredigt hat. Ich hätte mich bis nach vorn vorgedrängt.«
»Wer ist das denn?«, fragte der Junge. »Ist das der Bischof?«
Paul lachte laut auf. »Nee, Bruno, das bestimmt nicht. Aber mir, mir hat er die Arbeit beschafft. Als ich hier in Berlin ziemlich ratlos ankam, da hat die Podolski mich zu ihm geschickt. ›Das ist ein ganz Besonderer‹, hat sie gesagt. ›Der hat ein Herz für Leute, die in Druck sind.‹«
»Weiter«, drängte Bruno, als Paul verstummte.
»Nichts weiter. Er hat so eine ulkige Sprache. Soll ein Mann aus dem Rheinland sein. Er hat viermal telefoniert und dann sagte er: ›Kannst dich bei dem Werkmeister Weber bei Borsig vorstellen. Sagst, du kommst vom schwarzen Sonnenschein.‹ Einen Zettel mit einer Adresse hat er mir in die Hand gegeben. Der Weber hat mich angeschaut und gesagt: ›Gut, wenn du vom Sonnenschein kommst, dann will ich’s mit dir versuchen.‹«
Vor der Kirche boten ein paar Jungen Zeitungen an. Paul zählte sein Geld und kaufte eine.
»Für ein Bier und eine Brause reicht es noch«, stellte er fest. »Komm, wir gehen da drüben in die Kneipe.«
In »Olgas Quelle« war ziemlich viel los. Im Saal der Wirtschaft war ein Wahllokal eingerichtet worden.
Sie drängten sich an einen Tisch in der Nähe der Theke. Paul begann ein Gespräch mit den Leuten. Der Junge blätterte in der Zeitung. Auf einmal boxte er Paul gegen die Rippen, zeigte auf ein Foto und rief: »Das ist er, Paul! Das ist er ganz bestimmt!«
Paul löste sich nun unwillig aus dem Gespräch. »Sei nicht lästig«, schimpfte er. »Trink deine Brause und bleib still.«
Der Junge aber starrte auf das Foto und stieß aufgeregt hervor: »Der hat meinen Bruder erschossen«, und deutete mit dem Finger auf ein Foto, auf dem eine Gruppe von Soldaten abgebildet war, die in Reih und Glied hinter einem Offizier hermarschierten. Der Junge zeigte auf einen anderen Offizier, der neben der Kolonne herging. »Das ist er«, sagte er.
Paul fand das Foto ziemlich unscharf, aber er musste zugeben, dass die Gestalt der ähnelte, die in der Nacht zum Sonntag auf Wilhelm geschossen hatte.
»Ich habe ihm ins Gesicht geschaut«, behauptete Bruno. »Eine Narbe lief quer über die rechte Schläfe bis in die Haare hinein. Niemals werde ich sein Gesicht vergessen.«
Die anderen Gäste am Tisch waren aufmerksam geworden. Paul erklärte ihnen mit ein paar Sätzen, dass der Junge in der Nacht zum vergangenen Sonntag bei seinem schwer verwundeten Bruder gesessen hätte und was dann auf dem Platz geschehen war.
»Bluthunde! Das sind Bluthunde«, sagte einer erbittert und fingerte erregt an den Knöpfen seiner schwarzen Wolljacke. »Und der Noske an der Spitze ist der allerschärfste Hund.«
Ein älterer Mann mit einem kurzen Bürstenhaarschnitt widersprach heftig. »Hör auf damit! In den Freikorps sind mehr anständige Kerle als bei den Revoluzzern.«
»Wie du an diesem Beispiel siehst«, höhnte der in der Wolljacke. »Einen Mann, der schwer verwundet daliegt, ganz einfach abzuknallen! Pfui Deibel!«
»Und die Handgranate, die der Revoluzzer aus dem Gürtel zog, das ist wohl gar nichts, wie?«, ereiferte sich der, der den Freikorps gut gesinnt war. Er nahm die Zeitung und las die Bildunterschrift vor: »Gestern schlug so manches deutsche Herz höher. Das Freikorps Werwolf marschierte. Endlich sorgen famose Truppen dafür, dass wieder Ordnung und Disziplin einkehren.«
»Die Toten legen sie in Reih und Glied ins Massengrab. Das ist ihre Ordnung«, schrie einer.
»Wenn ihr euch prügeln wollt, geht nach draußen«, rief die Wirtin Olga und zeigte mit dem ausgestreckten Arm zur Tür. Der, der die Freikorps verteidigt hatte, stand auf, rief: »Was sollen die Soldaten denn machen, wenn sie aus dem Hinterhalt angegriffen werden?«, und ging wütend weg.
»Hau ab! Zusammengeschossen haben sie unsere Revolution!«, schallte es ihm nach.
Die Zeitung ging von Hand zu Hand, einige Bemerkungen wurden gemacht, aber dann wechselten die Männer das Thema. Es waren bei den Kämpfen in diesen Januartagen so viele Hunderte umgekommen, Kanonen waren eingesetzt worden und Maschinengewehre. Straßenschlachten am Alexanderplatz, in der Friedrichstraße, der Lindenstraße und an vielen Orten waren entbrannt und die Regierungstruppen hatten schließlich das Verlagshaus des »Vorwärts« gestürmt, nachdem fünf Arbeiter, die mit einer weißen Fahne aus dem Gebäude kamen und verhandeln wollten, erschossen worden waren.
Bruno nahm sein Taschenmesser heraus und schnitt sorgfältig das Foto aus der Zeitung. Der Offizier, den der Junge meinte, war wirklich nur undeutlich zu erkennen, aber Bruno schien seiner Sache ganz sicher zu sein. »Ich werde ihn anzeigen. Laut werde ich ›Mörder!‹ schreien, wenn er mir begegnet!«
Seine Augen, viel zu groß in dem mageren Hungergesicht, waren dunkel vor Erregung. Bruno trug unter dem Pullover einen speckigen Brustbeutel aus Leder. Bruno zog den Beutel hervor. Sorgfältig faltete er das Zeitungsfoto zusammen und steckte es hinein.
Sie zogen los. Paul, ungefähr einen Meter fünfundsiebzig groß, kräftig und ein wenig gedrungen, hatte seinen Arm um den Jungen gelegt, der ihm kaum bis an die Schulter reichte und neben ihm noch dünner aussah, als er in Wirklichkeit war.
Was fange ich bloß mit dem Kind an?, grübelte Paul und murmelte: »Wenn ich nur eine Ahnung hätte, wo die Warczaks sind.«
Bruno hatte ihn verstanden und sagte: »Der Hubert Warczak ist schon lange weg aus Liebenberg. Mit Sack und Pack ist er damals ins Ruhrgebiet gegangen. In Gelsenkirchen hatte Onkel Warczak Verwandte. Dort wollte der Hubert hin.«
»Meinst du, du könntest bei dem Hubert Warczak unterkommen?«, fragte Paul.
»Lieber möchte ich bei dir bleiben, Paul«, sagte der Junge leise.
In den folgenden Tagen rannte der Junge von einer amtlichen Stelle zur anderen. Er versuchte herauszufinden, wohin die Männer auf dem Planwagen die Leiche seines Bruders gebracht hatten.
»Ich will wenigstens wissen, wo er verscharrt worden ist«, hatte er verbissen gesagt, wenn Frau Podolski oder Paul ihn davon abzubringen versuchten. Aber wohin er auch lief, wen er auch fragte, niemand konnte ihm eine Auskunft geben. In den Ämtern schaute man flüchtig in die Listen, zuckte die Schultern, schüttelte die Köpfe, wies ihm die Tür, wenn er zudringlicher wurde. Vier Friedhöfe hatte er abgesucht. Auf zweien hatte er riesige Grabhügel gefunden.
»Hier liegen viele, viele.« Das war das Einzige, was er aus einem alten Totengräber herausbekommen hatte.
»Ohne Pfarrer, ohne einen letzten Segen in die Erde!«, klagte Frau Podolski. »Wie ein Stück Vieh, ganz einfach ins Loch geworfen. Schrecklich. Nicht einmal mehr vor den Toten ziehen sie ihren Hut!«
Schließlich gab der Junge es auf, nach seinem toten Bruder zu forschen. »Aber der Mörder, der kommt mir nicht davon«, sagte Bruno wohl zehnmal am Tag.
Paul fühlte sich oft einsam in der riesigen Stadt. Sicher, er hatte Arbeit in der Lokomotivfabrik Borsig gefunden. Ein großer Staatsauftrag ließ den Betrieb auf Volldampf laufen. Die Koststelle bei Frau Podolski war auch nicht übel, wenn er davon absah, dass es in seinem Zimmer immer noch scharf nach dem Kammerjäger roch, der die Wanzen wenigstens für eine Weile ausgeräuchert hatte. Zwei lange Briefe hatte Paul inzwischen an seine Eltern geschrieben. Er hatte danach gefragt, ob man im Dorf die Anschrift des jungen Warczak in Gelsenkirchen kenne, hatte von seiner Arbeit berichtet und von der riesigen Stadt. Das hatte auf dem Papier alles sehr schön ausgesehen und sein Vater hatte ihm in einem kurzen Brief geantwortet und geschrieben, dass er stolz sei auf seinen Sohn, der in dieser schwierigen Zeit Boden unter die Füße bekommen hätte. Hubert Warczaks Adresse hatte er ganz unten auf dem Briefbogen notiert.
Pauls Briefe zeigten aber nicht, wie ihm eigentlich zumute war. Immer wieder ertappte er sich dabei, dass er mit dem Jungen über Liebenberg sprach, über das Dorf an der Grenze, in dem sie aufgewachsen waren. Jeder hatte dort von jedem gewusst, sie kannten die Standplätze der guten Apfelbäume und jene Stellen im Wald, an denen nach einem warmen Sommerregen die Pfifferlinge aus dem Boden schossen.
Ja, selbst bei den Soldaten war es anders gewesen als in Berlin. Da hatte die Angst ihnen beigebracht, dass einer auf den anderen angewiesen war. Paul dachte oft an seinen Unteroffizier Karl Schneider, einen Mann aus dem Süddeutschen. Der war nur drei Jahre älter als er selbst. Schon in den ersten Kriegstagen im August 1914 war Karl eingezogen worden. Er erzählte dem Jungen von diesem seinem besten Freund, der auch Schlosser gelernt hatte. In Berlin, so hatten sie ausgemacht, wollten sie sich nach dem Krieg gemeinsam eine Arbeit suchen. Aber dann war alles anders gekommen. Zwei Tage bevor die Truppen in Frankreich den Befehl bekamen, die Kämpfe einzustellen und nach Deutschland zurückzumarschieren, hatte es den Karl erwischt. Ein Schrapnellsplitter hatte ihm den linken Oberarm aufgeschnitten. Nicht so schlimm wie 1916 an der Somme, als es beinahe mit ihm aus gewesen wäre.
»Fleischwunde«, hatte der Sanitäter gesagt. Geblutet hatte Karl wie ein Stück Vieh, aber dort an der Front, da klang »Fleischwunde« so, als ob sich einer in Friedenszeiten einen Holzsplitter unter den Nagel reißt. Der Sanitäter hatte Karl einen Pressverband angelegt und ihm die Richtung zum Verbandsplatz gezeigt. Seitdem war Karl dem Paul aus den Augen gekommen.
Was von Pauls Kompanie übrig geblieben war, das war mit den Armeen quer durch Deutschland gezogen, teils mit Viehwagen der Eisenbahn, teils auch zu Fuß. Am 10. Dezember 1918 marschierten die ersten Felddivisionen in Berlin ein. Ihre Waffen führten sie mit sich. Paul hatte noch zwanzig Schuss scharfe Munition in den Patronentaschen am Koppel und seinen Karabiner über der Schulter. Am Brandenburger Tor hatte der Oberbürgermeister Wermuth sie empfangen. Der Reichskanzler Friedrich Ebert hatte sogar eine Rede gehalten. Die war Paul ans Herz gegangen, obwohl in den Kriegsjahren so manche großen Worte verschlissen worden waren.
»Kein Feind hat euch überwunden«, rief der Kanzler den Soldaten zu. »Nun liegt Deutschlands Einheit in eurer Hand!«
Aber zu viel hatte in der Hand der Soldaten gelegen, in zu viel Dreck und Blut hatten sie greifen müssen, zu viele Tote hatten sie verscharrt, zu viele grobe Kreuze in flache Grabhügel gedrückt, zu selten hatten sie Brot in den Händen gehalten und zu selten Blumen.
Jedenfalls hatte Paul es an diesem Dezembertag so gemacht wie die meisten anderen Soldaten auch. Er hatte seine Waffen auf einen Haufen geworfen und sich nach einer Schlafstelle und nach Arbeit umgesehen. Die Waffen waren allerdings nicht auf diesem Haufen liegen geblieben. Paul wusste, dass Eduard und Robert im Kleiderschrank Karabiner stehen hatten. Mehr als hundert Schuss Munition lagen im Wäschefach versteckt.
Wenn vom Krieg die Rede war, dann konnte Bruno nicht genug erfahren. Paul sprach dann wie zu sich selbst, sprang aber mit heißem Kopf plötzlich auf und beschimpfte sich: »Warum komme ich nicht davon los? Ich will vergessen, Bruno, vergessen will ich das alles, verstehst du?«
Meist knallte er dann die Tür hinter sich zu und lief hinaus.
»Er hat wieder geschossen, nicht wahr?«, sagte dann Frau Podolski, wenn Bruno zu ihr in die Küche ging. Bruno nickte und sie fügte hinzu: »Ich hab den Knall gehört.«
An einem solchen Tag im Februar, bei Borsig wurde seit drei Tagen gestreikt, ging Paul schon am Vormittag zu »Olgas Quelle« hinüber. Es standen nur wenige Männer an der Theke. Pauls Augen mussten sich erst an das trübe Licht in der Gaststube gewöhnen. Er hörte, dass im Saal etwas los war. Stimmengewirr drang bis in die Gaststube herein.
»Die Sozis streiten mit denen vom Spartakus«, erklärte die Wirtin. »Hoffentlich bleibt’s bei den Wortschlachten. Von Saalschlachten habe ich allmählich die Nase voll.«
Paul ließ sich ein Bier zapfen und schlenderte zur Saaltür. Ungefähr dreißig Männer saßen auf den Stühlen, einige rittlings, die hielten ihr Bier in der Hand und stützten das Glas auf die Stuhllehne. Sie kehrten Paul den Rücken zu und schauten auf zwei Männer, die sich jeder auf einen Tisch gestellt hatten und heftig debattierten. Es waren die alten Themen: Räterepublik durch eine Revolution oder eine Wahlrepublik, wie Ebert sie wollte. Als die beiden Kampfhähne sich »Arbeiterverräter« und »bolschewistischer Wirrkopf« beschimpften und die Zuhörer schon aufgeputscht von den Sitzen sprangen, da zog ein Mann den Sozialdemokraten, der bisher geredet hatte, vom Tisch und trat an seine Stelle.
»Genossen«, sagte er ganz ruhig, »was denkt ihr wohl, wer sich am meisten freute, wenn er wüsste, wie uneinig wir Arbeiter sind?«
Paul hätte am liebsten »Karl!« geschrien, aber er biss sich auf die Lippen und hörte zu, was Karl Schneider sagte. Dem gelang es ziemlich schnell, die Männer nachdenklich zu machen.
Er rief: »Erinnert ihr euch noch an August 1914? Habt ihr vergessen, wie wir damals in den Krieg gezogen sind? Gejubelt haben wir und begeistert waren wir alle!«
»Du vielleicht«, versuchte der Spartakusmann noch einmal die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber aus der Zuhörerschar wurde »Ruhe!« geschrien und: »Lasst den Mann reden!«
»Wir haben unseren Verstand damals ausgeschaltet«, fuhr Karl fort. »Wir sind wie Blinde ins Elend marschiert.«
»Du hast doch bestimmt in der Etappe gesessen, du Klugscheißer!«, rief der Spartakist.
»Hat er nicht!«, rief Paul laut.
Die Gesichter wandten sich ihm zu.
»Karl Schneider war vom ersten bis zum letzten Tag an der Front. Er war zweimal verwundet. Ich hab oft genug neben ihm im Dreck gelegen. Ich kann’s bezeugen.«
»Mensch, Paul!«, rief Karl überrascht, aber dann fuhr er fort: »Genossen, was geschieht in diesen Wochen in Berlin und in ganz Deutschland? Wieder ist die Begeisterung groß. Wieder wird wenig nachgedacht und viel geschrien. Wieder bezahlen wir das alles mit unserem Blut. Ich bin dafür, dass wir den Frieden nicht genauso falsch beginnen, wie wir den Krieg angefangen haben. Lasst uns überlegen, lasst uns nachdenken und kühl handeln. Was wir brauchen, das ist ein neues Recht, eine neue Verfassung. Ich bin dafür, dass wir mit dem Verstand kämpfen und nicht mit der Faust.«
»Bravo!«, riefen einige und: »Sehr richtig!«
»In vielen Parteien sitzen Arbeiter, in der USPD, im Zentrum und in der Partei, der ich angehöre, in der SPD. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Interessen vertreten werden, dass Gerechtigkeit endlich auch für uns Arbeiter geschaffen wird, für uns und für das ganze Volk.«
»Bravo!«, stimmten die meisten zu. Andere aber sagten auch: »Er ist ein Träumer. Ohne Gewalt geht nichts in diesem Land.«
Die Versammlung begann sich zu zerstreuen. Karl drängte sich zwischen den Männern durch bis hin zu Paul. Der schüttelte Karl die Hand und schlug ihm auf die Schulter, doch Karl schrie auf und sagte: »Mensch, Paul, denk an meine Verwundung.«
Sie setzten sich an einen Tisch in der Ecke der Gaststätte und begannen zu erzählen, wie es ihnen in den letzten Monaten ergangen war. Sie vergaßen alles rund um sich herum. So bemerkten sie nicht, dass sich Bruno an den Nachbartisch gesetzt hatte und begierig den Worten lauschte, die von Paul und Karl herüberdrangen. Schnell hatte er heraus, wer der hagere Mann sein konnte, der da bei Paul saß. Sein schwäbischer Dialekt, die scharfen Gesichtszüge, der auf und nieder springende Adamsapfel, Paul hatte oft genug seinen Freund Karl beschrieben. Zuerst empfand Bruno so etwas wie Zurücksetzung, aber dann hatte Karl ihn doch in seinen Bann gezogen und das beklemmende Gefühl, der Fremde könne ihm etwas wegnehmen, wich allmählich. Endlich entdeckte Paul den Jungen.
»Bruno, Salzknabe, was willst du denn hier?«, fragte er aufgeräumt.
Bruno antwortete: »Frau Podolski hat mich vor einer Stunde losgeschickt. Ich soll dich zum Mittagessen holen. Aber ich wollte euch nicht stören.«
»Heute ist mir ganz gleichgültig, was die Podolski sagt, mein Junge.«
Paul zog seine Uhr aus der Westentasche. »Aber es ist schon fast zwei Uhr.« Er überlegte einen Augenblick, zeigte auf die leer getrunkenen Biergläser und sagte: »Karl, ich bin pleite. Kein weiteres Bier also. Ich schlage vor, geh mit auf meine Bude oder, wenn es da zu kalt ist, in Podolskis Küche. Die Frau ist gar nicht so giftig, wie sie sich gibt.«
»Gut«, stimmte Karl zu. »Wir können dann in Ruhe besprechen, wie es mit uns weitergehen soll.«
Frau Podolski hatte bereits das Geschirr gespült und die eiserne Platte des Kochherdes blank geputzt. Sie saß am Küchentisch und kramte in Papieren, die in einem Schuhkarton lagen. Als sie die Männer im Flur hörte, rief sie: »Sind Sie es, Paul?«
»Meist redet sie den Paul mit ›du‹ an«, sagte Bruno. »Aber sie hat sicher gehört, dass wir jemand mitbringen. Dann tut sie immer ganz vornehm.«
Paul betrat die Küche. Karl und der Junge blieben im Türrahmen stehen.
»Es zieht. Schließ die Tür, Junge. Und nimm die Matrosenmütze vom Kopf.«
Karl schien das als Einladung zu verstehen. Frau Podolski sagte: »Ich habe nichts gegen Besuch, aber noch einen Kostgänger, Paul, schieben Sie mir bitte nicht unter.«
»Das ist Karl Schneider, Frau Podolski. Wir waren im Krieg lange zusammen.«
Diese Vorstellung verstärkte Frau Podolskis Misstrauen. Karl aber sagte: »Keine Sorge, Frau Podolski. Ich wohne drüben in Moabit in der Wohnung von einem Landsmann, der vor ein paar Wochen ins Ruhrgebiet gezogen ist. Der Paul und ich wollen nur miteinander reden.«
»Mittagessen gibt es um diese Zeit sowieso nicht mehr«, knurrte Frau Podolski und schaute missbilligend auf die Wanduhr.
Eigentlich wollten Paul und Karl von der Zukunft sprechen, aber dann fielen Worte wie Marne und Somme und Verdun und Flandern. Die Erinnerungen stürzten über sie her. Sie fragten nach Namen von Soldaten und Offizieren und was wohl aus ihnen geworden war.
Als die Rede auf Flandern kam, da zog Frau Podolski, die bis dahin schweigsam am Tisch gesessen hatte, ein Foto aus dem Schuhkarton und reichte es den Männern hinüber. Es zeigte einen jungen Mann mit einem Kindergesicht und gewellten blonden Haaren. Er trug die feldgraue Infanterieuniform und stand da in voller Ausrüstung, den Tornister auf dem Rücken, die ledernen Patronentaschen am Koppel, den Brotbeutel, das Blechkochgeschirr, die Feldflasche, den kleinen Spaten und den Karabiner neben den Schuh gestellt.
»Ein Mausergewehr 98«, sagte Bruno und deutete auf das Foto.
»Schlimm genug, dass die Kinder so etwas heute genau wissen.« Frau Podolski schüttelte den Kopf.
Die Männer sahen sich das Foto an. Frau Podolski erklärte: »Das hat mein Bruder Bastian machen lassen, bevor er nach sage und schreibe acht Wochen Ausbildung gleich von der Kaserne ins Feuer geschickt worden ist. Im Herbst 1914 ist er vor Langemarck in Flandern gefallen. Schüler war er noch. Meine Eltern haben sich jahrelang krummgelegt, damit er auf das Gymnasium gehen konnte. Er sollte mal studieren. Aber er war nicht zu halten, als der Krieg ausbrach. Freiwillig hat er sich gemeldet und er war glücklich, als sie ihn nahmen.«
Sie knüpfte ein schmales Briefbündel auf und legte das blassblaue Seidenband sorgfältig zusammen. Den obersten Brief nahm sie herunter, zog ihn aus dem Umschlag und las. Das Papier zitterte ein wenig in ihren Händen. Sie seufzte und schob Karl den Brief zu. »Waren Sie auch in Flandern?«
»Ja«, antwortete Karl. »Ich habe den ganzen Schlamassel bei Diksmuide von Anfang an mitgemacht.«
Als er merkte, dass sie damit nichts anzufangen wusste, ergänzte er: »Diksmuide, nördlich von Langemarck, mehr die Yser abwärts, aufs Meer zu.« Karl begann, den Brief leise vorzulesen. Nur der erste Teil stammte von Bastian selbst:
»Liebe Mama!Ich weiß nicht, ob ich noch lebe, wenn du meinen Brief erhältst. Die letzten Oktobertage waren schrecklich. Genauso stelle ich mir die Hölle vor. Im Viehwagen erst und dann nach gewaltigen Märschen kamen wir in Flandern an. Im Sturm wollten wir bis nach Dünkirchen vorstoßen und die Engländer ins Meer treiben. Aber es kam alles ganz anders. Erst waren wir wie von einer großen Spannung befreit, als wir hörten, der Feind liege dicht vor uns. Du wirst es nur schwer glauben, liebe Mama, aber als ich dann zum ersten Male schießen durfte, war es, als ob die Schüsse eine eiserne Fessel sprengten, die mir um die Brust gelegt war. Als der Trompeter das Signal ›Rückt vor!‹ blies, stürmte unser Bataillon, tausend Soldaten, Mann an Mann auf den Ort Bikschote zu. Im Sturmschritt ging es quer über einen endlosen Rübenacker. Der Lehmboden klebte an unseren Stiefeln, aber nicht die schlammige Erde stoppte unseren Sturmlauf. Wir waren schon ziemlich nah vor den ersten Häusern des Ortes, keine Deckung weit und breit. Die gelblich grünen Rübenblätter klatschten uns um die Stiefel. Da ging es auf einmal los, Maschinengewehre feuerten wie wild, tausend Gewehrschüsse, leichte Artillerie. Zischen, Donnern, explodierende Feuerbälle, und wir liefen oder fielen, wer weiß, nach welchem blinden Zufall, und wir liefen und wir fielen in den Tod. Der Kurt Bernstein neben mir wurde zu Boden gerissen, und links und rechts ein Schreien, Stolpern, Taumeln, Fallen. Der Trompeter blies schon längst nicht mehr, als ich mit wenigen Kameraden keuchend in einer flachen, schlammigen Erdmulde Schutz suchte.›Grabt euch ein, Jungs!‹, hat ein älterer Unteroffizier gesagt. Er war aus der 3. Kompanie und ich kannte ihn vom Sehen. Er selbst konnte den Spaten nicht mehr halten, er hatte einen Oberarmdurchschuss. Ich will es kurz machen, Mama. In der Nacht haben wir uns zurückgeschlichen. Es lag, Gott sei Dank, ein dünner Nebel über dem Acker. Erwin und ich haben den Unteroffizier mitgeschleppt. Er hatte so viel Blut verloren, dass er ganz matt war.In den folgenden Tagen sind wir noch zweimal gegen Bikschote angerannt, haben es genommen und wurden wieder zurückgetrieben. Nun haben wir zwei Tage Ruhe, ein wenig hinter den Linien. Endlich konnten wir uns satt essen. Es gab Reissuppe mit Hühnerfleisch, Suppe, so viel wir wollten. Aus unserem Regiment sind zwei von drei Mann gefallen, verwundet, vermisst. Aber heute ist es bis zur ursprünglichen Zahl wieder aufgefüllt worden, fast nur Schüler, Studenten, junge Leute. Lauter Freiwillige. Sie fragen uns, wie es da vorn ist. Sie sind so voller Zuversicht, voller Leben. Ich komme mir uralt vor, wenn ich sie sehe und sie so begeistert von Sieg und Vaterland reden höre.Mama, ich weiß, ich mache dir das Herz schwer, wenn ich das schreibe, aber es wird mir ein bisschen leichter, wenn ich nicht alles in mich hineinfressen muss. Wer weiß, vielleicht zerreiße ich diesen Brief. Der Sieg, sagt unser Feldwebel, frisst alle Angst auf. In der Morgendämmerung, so munkelt man, werden wir westlich von Langemarck wieder nach vorn geworfen. Wahnsinn, das wird auf unseren Kreuzen stehen.«
3
Karl hatte mit monotoner Stimme vorgelesen. Er schwieg und schluckte.
»Weiter«, bat Bruno. Es klang ein wenig heiser.
»Hier endet der Brief«, sagte Karl.
»Kein Gruß, kein Name?«, fragte der Junge.
»Sein Leutnant hat ein paar Zeilen daruntergeschrieben«, antwortete Karl und fuhr leise fort:
»Sehr geehrte Frau Grobelski!Ihr Sohn ist für Kaiser und Vaterland in Flandern gefallen. Tapfer ist er vorangestürmt. Laut haben unsere Jungen gesungen ›Deutschland, Deutschland über alles‹. Viele junge Helden haben das Los Ihres Sohnes geteilt. Süß ist es und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben.Eigentlich dürfte ich Ihnen den Brief Ihres Sohnes gar nicht zusenden. Aber darf ich die letzten Gedanken eines jungen Freiwilligen unterschlagen?Voller HochachtungIhr Peter von Holzen1. LeutnantP.S. Sie finden das Soldbuch, die Taschenuhr sowie die Brieftasche Ihres Sohnes in dem Päckchen.Geschrieben vor Langemarck, Ende November 1914.«
Karl faltete den Brief zusammen. Sie saßen um den Tisch und schwiegen lange. Schließlich rückte Frau Podolski ihren Stuhl zurück und stellte Tassen auf den Tisch. Bruno trug die große Emaillekanne mit Kaffee herbei. Die Kanne stand fast den ganzen Tag über hinten auf der Herdplatte. Bruno goss die Tassen randvoll.
»Sind sie denn wirklich mit einem Lied, mit dem ›Deutschland, Deutschland über alles‹ in das Feuer gerannt?«, stieß Frau Podolski hervor.
»Es kam damals häufiger vor, dass wir sangen, wenn wir vorwärts-stürmten.«
»Aber der schlammige Ackerboden, das schwere Gepäck auf dem Rücken und am Gürtel, das schnelle Laufen, wie kann da ein Mensch singen?«
»Es war die Angst, Frau Podolski. Die Angst war es. Wir haben versucht, die Angst totzuschreien.«
Sie schlürften den heißen Kaffee. Frau Podolski band die Briefe wieder zusammen. Bevor sie das Päckchen in die Schuhschachtel zurücklegte, nahm sie eine Taschenuhr heraus, zog sie auf, hielt sie ans Ohr und sagte: »Sie geht noch immer. Unser Bastian hat sie von seinem Paten bekommen, als er als Klassenbester die mittlere Reife machte.«
Dann aber packte sie die Schachtel ein und trug sie in den Küchenschrank. Karl erzählte später noch von Willi Rath, der auch aus dem Schwäbischen stammte. Er hatte als Schlossermeister Arbeit im Ruhrgebiet gefunden. Paul erinnerte sich, dass sie den Feldwebel Rath einmal hinter der Front getroffen hatten. Eine lange Nacht hindurch feierten sie das Wiedersehen damals. Es wurde geredet und getrunken und abenteuerliche Pläne für eine Zukunft nach dem Sieg waren geschmiedet worden.
»Der Willi«, sagte Karl, »der ist schon vor dem Krieg Leiter einer ganzen Abteilung in einer Schiffswerft am Rhein gewesen. Der wird mir sicher Arbeit beschaffen können.«
»Ich sollte vielleicht mit ins Ruhrgebiet ziehen«, sagte Paul.
»Der junge Warczak wohnt auch in Gelsenkirchen«, sagte Bruno.
»Berlin oder Ruhrgebiet, das sind beides Hexenkessel in dieser wilden Zeit«, warnte Frau Podolski. »Wenn ihr schon fortwollt, macht es doch wie die Nationalversammlung. Versucht es in Weimar oder in einer anderen ruhigen Stadt. Wo viele Menschen zusammengepfercht sind wie hier oder an Rhein und Ruhr, da liegen Lunten am Pulverfass.«
»Aber Arbeit gibt es dort eher«, verteidigte Karl seinen Plan. »Und wir wollen endlich etwas aufbauen.«
»Und Sie, Paul? Warum versuchen Sie nicht, in Ihrer Heimat wieder Fuß zu fassen? Ihr Vater, Ihr Bruder, die haben dort doch Land, eine Zimmerei und auch ein Fuhrgeschäft.«
»Sie haben den Bruno ja geschickt ausgehorcht«, lachte Paul. »Aber die ganze Geschichte hat Ihnen der Junge nicht erzählt. Bei uns ist der älteste Sohn alles, der jüngere ein Nichts. Er kann, wenn er sich damit abfindet, Knecht seines Bruders sein. Das Geschäft wird ›Lukas Bienmann und Sohn‹ heißen und der Sohn, das ist immer der, der zufällig zuerst geboren ist.«
Paul sprach mit einer gewissen Verbitterung. Nach einer Pause fügte er hinzu: »Immerhin hat mein Vater alle seine Söhne ein Handwerk lernen lassen. Handwerk hat goldenen Boden.«
»Ihr Vater ist ein kluger Mann«, lobte Frau Podolski. Sie öffnete die Schranktür, seufzte und sagte: »Ich hätte Sie, Herrn Schneider, gern zum Abendessen eingeladen, aber diese Siegermächte heben die Blockade nicht auf. Keine Nahrungsmittel nach Deutschland. Aushungern wollen sie uns. Das soll ein Mensch begreifen.«
»Ist schon gut, Frau Podolski«, antwortete Karl.
Paul und Karl verabredeten sich für den kommenden Sonntag bei Karl in Moabit. »Wir dürfen uns nicht wieder aus den Augen verlieren«, sagte Karl zum Abschied. »Ohne die alten Freunde ist es heutzutage schwer, sich durchzuschlagen.«
Als Frau Podolski ein paar Bratkartoffeln und eine wässrige Suppe auf den Tisch stellte, sagte sie: »Diesen Schneider, Paul, den sollten Sie festhalten. Ich habe einen Blick für Menschen.«
4
Frau Podolski hatte darauf gedrungen, dass Bruno wieder zur Schule ging. Schließlich schloss er sich den Jungen aus der Nachbarschaft an. Er kam zu Lehrer von Wichtel. Niemand wird behaupten wollen, von Wichtel habe keinen Humor. Wer eins dreiundneunzig groß ist, von Wichtel heißt und trotzdem Lehrer in Berlin-Lichtenberg wird, der kann ohne diese liebenswerteste aller menschlichen Eigenschaften nicht überleben.
Von Wichtel war der Meinung, in Zeiten, in denen vieles drunter und drüber gehe, sei es vor allem wichtig, den Schülern in der Schule beizubringen, was Ordnung heißt.
»Der Mensch muss einen festen Rahmen haben, wenn nicht alles aus den Fugen gehen soll.« Diese Worte konnte kein Schüler vergessen, der in seiner Klasse gewesen war. Den meisten hatte er diese Lehre mit dem Rohrstock eingebrannt, wobei die Handflächen, der Rücken und das Hinterteil gleicherweise berücksichtigt wurden. Von Wichtel schlug ganz selten im Zorn, aber seine Liste für den kalten Strafvollzug war ziemlich ausgefuchst. Keine Hausarbeiten: fünf Schläge; kein sauberes Taschentuch: drei Schläge; schmutzige Fingernägel: zwei Schläge; Fehler beim Abschreiben: je einen Schlag und so fort. Besonders hart verfuhr er mit Schülern, die sich in Schlägereien untereinander verwickelten.
»Man muss den Teufel mit Beelzebub austreiben«, sagte er dann. Deshalb hieß sein Rohrstock bei den Schülern auch Beelzebub.
Bruno war noch niemals von Lehrer Wichtel geschlagen worden. Er hatte ein sauberes Taschentuch, das er nie benutzte und trotzdem jede Woche wechselte. Frau Podolski hatte ihm aus dem Nachlass ihres Mannes einen Leinenfetzen überlassen, ehemals ein Fußlappen. Aus dem hatte Bruno zwei leidlich rechteckige Taschentücher geschnitten. Das Tuch, das er eine Woche lang allmorgendlich vorgezeigt hatte, wusch er unter dem Kran im Flur samstags sorgfältig aus, schrubbte mit einer Wurzelbürste daran herum, hängte es auf die Eisenstange, die rund um Frau Podolskis Herd lief, und fuhr mit dem heißen Bügeleisen darüber. Im Übrigen schnäuzte er sich, wie er es bei den meisten Männern in Liebenberg gesehen hatte. Und die trugen ihr Taschentuch nur im Sonntagsanzug zur Zierde mit sich. Seine Nägel waren sehr kurz geschnitten und in der Regel sauber.
Die Hausaufgaben waren ein größeres Problem. Was von Wichtel an Leistungen verlangte, das war für Bruno leicht zu schaffen. Aber wie sollte er an eine Schiefertafel, an einen Griffel kommen? Paul hatte ihm ein Stück Dachschiefer von Borsig mitgebracht, aber die Oberfläche war nicht ganz glatt und das Schreiben darauf ziemlich schwierig. Immerhin akzeptierte von Wichtel seine Bemühungen. Herzklopfen bis zum Hals hinauf hatte Bruno, als er dem Lehrer eines Tages eine in schöner Handschrift gefertigte Hausarbeit auf den unbedruckten Rändern einer Zeitung vorzeigte. Aber von Wichtel hatte seine Findigkeit gelobt, statt ihm die erwarteten Prügel zu verpassen. Nach dem Unterricht hatte er »den Kurpek« in der Klasse gehalten.
Bruno stand vor seinem Pult, ein kleines Zittern in den Knien. Von Wichtel schaute lange vor sich hin. Bruno dachte schon, er habe ihn vergessen, aber dann zog der Lehrer eine Schublade auf und schob dem Jungen ein Schreibheft über die Pultplatte, nahm eine Stahlfeder und einen alten Federhalter, ein Tintenfass voller Tinte, gut verkorkt, und sagte kein Wort dabei.
»Soll ich das für Sie irgendwohin tragen?«
Von Wichtel schüttelte den Kopf, schaute ihn an und sagte: »Nimm es für dich, Junge.« Dann räusperte er sich und fuhr barsch fort: »Aber mache mir keinen Tintenklecks in das Heft, Kurpek. Die Feder ist neu. Stecke sie erst ein paarmal in eine rohe Kartoffel, sonst perlt die Tinte ab.«
»Ja, Herr Lehrer«, sagte Bruno und wunderte sich, dass ein Lehrer so anders sein konnte, wenn er nicht vor der ganzen Klasse stand.
Bruno hatte eine klare Handschrift. »Wie gestochen«, lobte Lehrer von Wichtel. Wenn der Junge sich Mühe gab, dann glichen die Buchstaben, die er schrieb, aufs Haar jenen, die auf zwei großen Papptafeln gedruckt an der Wand der Klasse aufgehängt waren. Oberlehrer Kolukken in der Dorfschule in Liebenberg hatte seinerzeit scharf darauf geachtet, dass das Schönschreiben bei seinen Schülern nicht zu kurz kam. Er hatte sich, nachdem er schon vier Jahre lang pensioniert war, zu Beginn des Krieges bereit erklärt, wieder Dienst zu tun, weil der jüngere Lehrer die Kreide mit dem Karabiner vertauschen musste. Kolukken war es zu verdanken, dass die Liebenberger wegen ihrer Schreibkunst bis über die Kreisstadt Ortelsburg hinaus bekannt waren. Bruno jedenfalls kam das in der Berliner Freien Schule zu Gute. Sein kostbares Heft begann ein Musterheft zu werden.
Bei den 63 Jungen in der Klasse war Bruno nicht anerkannt. Wenn in der Turnhalle Mannschaften für ein Wettspiel gewählt wurden, stand Bruno oft und oft unter den Letzten, die eigentlich niemand wollte. Saubere Handschrift zählte nicht, Kraft und Geschicklichkeit waren gefordert. Aber Bruno war zu schlapp, um den schweren Medizinball weit zu schleudern. Auch beim Einzelturnen an den Geräten war es nicht viel besser. Ein Handstand gelang ihm nie. Laut lachten die Schüler, wenn er wie ein nasser Lappen am Reck hing oder sich mit zusammengebissenen Zähnen vergeblich bemühte, an einem der dicken Seile emporzuklettern, die von der Turnhallendecke herabhingen.
Da ging es selbst Karl Paschke noch besser, der zwar auch im Turnen eine Null war, der sich aber Respekt in der Klasse verschaffte, indem er die Prügel von Herrn von Wichtel in stoischer Ruhe ertrug.
Über diesen Karl Paschke ärgerte sich Lehrer von Wichtel, wenn er wieder einmal seine Hausaufgaben vergessen hatte. Karl verzog bei den dann fälligen Schlägen keine Miene. Das machte Herrn von Wichtel zornig. Er sagte: »Wir schreiben ein Übungsdiktat.« Einige kurze Sätze über das Rind als Wiederkäuer hatten es in sich. Labmagen, Schluckakt, Pansen, Mahlzähne waren die Rechtschreibklippen. Die Fehlerzahl musste unter das Diktat geschrieben werden. Keine Prügel? Nein. Von Wichtel verlangte vielmehr, dass die Eltern diese schlechte Leistung durch eigenhändige Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen hätten. Er verlagerte damit die Prügel ins Elternhaus.
Sehr aufmerksam betrachtete er am nächsten Morgen die Unterschriften. Drei hatten sie »vergessen«. Er erweiterte den Bußkatalog und verpasste diesen vergesslichen Schülern je drei Schläge auf die Finger. Karl Paschke gab freimütig zu, selbst tätig geworden zu sein. Sein Vater sei als Streikposten eingeteilt und seit drei Tagen nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter habe sich geweigert, zum Stift zu greifen. Fünf Schläge waren die Quittung und dazu die Mahnung, dass alle Verbrecher mit kleineren Sünden begonnen hätten, und Urkundenfälschung, das sei nun schon keine Kleinigkeit mehr.
In Bruno kroch die Angst vom Magen hoch. »Bruno Kurpek« stand in sauberer Schrift unter dem Diktat. In seiner Schrift.
»Sind deine Eltern sehr schlimm?«, fragte der Lehrer so leise, dass nur Bruno ihn verstehen konnte. Bruno war von dieser Frage überrascht und verwirrt. Er begann zu heulen.
»Wir reden später darüber«, sagte Herr von Wichtel. Er mahnte die Schüler, schön und richtig zu schreiben. Oft sei das lebenswichtig. Im Krieg habe er das häufig erfahren. »Man stelle sich nur einmal vor, die Melder hätten die Botschaften vom Stab unleserlich oder gar fehlerhaft in die vorderen Linien getragen. Lebensgefährlich wäre das ja gewesen, lebensgefährlich!« Wenn das Stichwort »vordere Linien« fiel, wussten die Schüler, was kam. Lehrer von Wichtel erzählte dann vom Krieg. Besonders eine Geschichte hatte es ihm angetan. An die zwanzigmal hatten die Schüler im siebten Schuljahr sie schon gehört. Sie begann: »Es war 1916 an der Somme. Die Engländer schossen sieben Tage lang Trommelfeuer.« Und dann beschrieb er genau die verschiedenen Kaliber, bis hin zu den schwersten Haubitzen, die Geschosse von eintausendvierhundert Pfund herüberjagten. Die 15-Zoll-Haubitzen habe man bereits am Fluggeräusch erkennen können und sie hätten Granattrichter hinterlassen, die oft zwei und mehr Meter tief gewesen seien. In aller Ausführlichkeit schilderte er die Angriffe, die dem Trommelfeuer folgten, die Grabenkämpfe. »Und dann, Jungens, ging es oft Mann gegen Mann. Ich hatte mich gerade über die Brustwehr unseres Grabens geschwungen und wollte in den Graben der Engländer stürmen, da rutschte ich mir nichts, dir nichts in einen ziemlich tiefen Granattrichter hinein. Und was meint ihr, was da geschah?«
Karl Paschke wusste zwar auch, dass diese Kunstpause von gespanntem Schülerschweigen gefüllt sein sollte, aber er wollte sich für die zu Beginn des Unterrichts empfangenen Prügel rächen und rief ziemlich laut: »Ich will mal raten, Herr Lehrer!«
Herr von Wichtel blickte scharf zu ihm hinüber, aber Karl Paschke störte das nicht. »Ich denke mir, da war schon einer drin, in dem Trichter. ’n Tommy war’s. Genau! Und was machte der? Er zog ne Zigarettenschachtel aus der Brusttasche und bot Ihnen eine an. Er selbst steckte sich auch eine zwischen die Lippen. Und Sie … na, Sie haben ihm Feuer gegeben. Sie haben dann ganz still die Zigaretten zu Ende geraucht. Er hat ›Good bye, old boy‹ gesagt und Sie ›Leb wohl, Kamerad!‹ Und dann sind Sie wieder rausgeklettert aus dem Trichter.«
Karl Paschke schaute den Lehrer an und als der immer noch verdutzt schwieg, da fragte er noch: »So war’s doch, Herr Lehrer, oder?«
Die Klasse wagte nicht, sich zu rühren. Das, was Karl da gemacht hatte, war in keinem Strafkatalog unterzubringen. Von Wichtel aber schluckte, lachte auf einmal laut und sagte: »Hab ich euch sicher schon mal erzählt, nicht wahr?« Er schmunzelte und drohte Paschke mit dem Zeigefinger. »Ein Witzbold, dieser Paschke! Will seinen eigenen Lehrer auf den Arm nehmen. Aber immerhin, er hat die Geschichte gut behalten.« Von Wichtel schüttelte den Kopf, dann aber fasste er sich und sagte: »Nun, wie auch immer. So ähnlich war’s. Aber was ist aus dieser Geschichte zu lernen?«
»Rauchen macht friedlich«, flüsterte Karl Paschke, aber er traute sich nicht, das laut zu sagen.
Leo Wefers meldete sich und kam an die Reihe.
»Wenn die Menschen verschiedener Völker nicht gegeneinander …« Hier stockte Leo, fuhr dann aber fort: ». …enn sie sich ergänzen, ich meine, der eine das Feuer, der andere die Zigaretten …«
»Schleimscheißer«, klang es aus den hinteren Bänken.
Leo wurde rot und verstummte.
»Genauso ist es«, bestätigte der Lehrer voll Eifer. »Gemeinsam und in Frieden.«