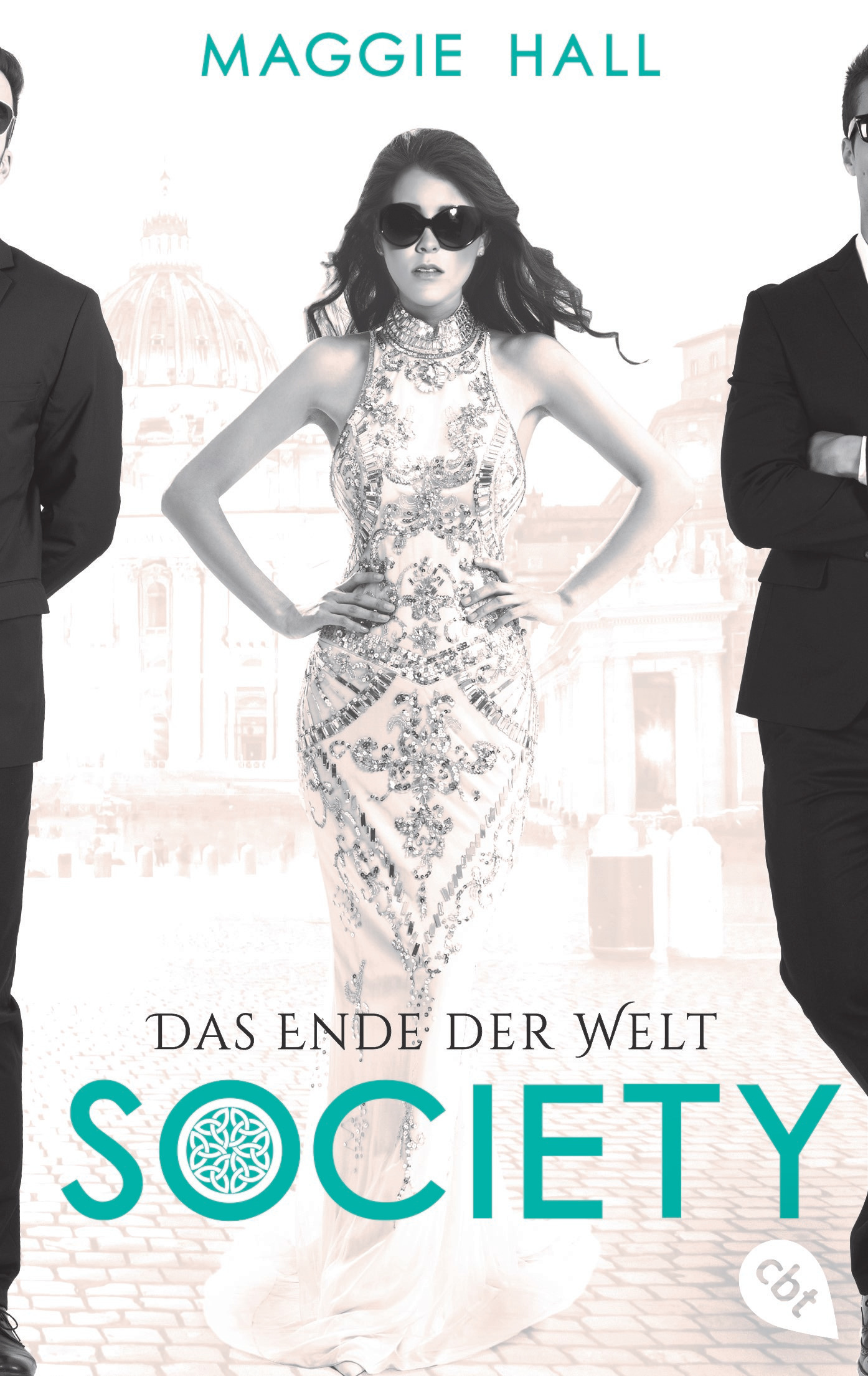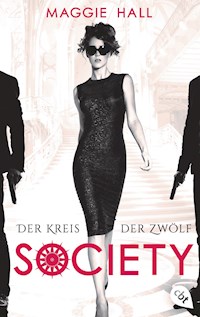6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Society-Reihe
- Sprache: Deutsch
Macht - Schicksal - Liebe - und eine Entscheidung über Leben und Tod!
Zwei Wochen. Länger hat es nicht gedauert, Averys Leben für immer zu verändern. Seitdem weiß sie, dass sie die Nachfahrin einer mächtigen Geheimgesellschaft ist und ihre Mutter von dieser entführt wurde. Sie hat sich in genau den verliebt, den sie nicht haben darf, und einen anderen kennengelernt, der ihr Schicksal sein soll. Und nun muss Avery herausfinden, wie sie ihre Mutter, sich selbst und mal eben den Rest der Welt rettet. Nachdem sie entschieden hat, wer ihre wahre Liebe ist: Stellan oder Jack?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DIE AUTORIN
© Andrew Hall
Maggie Hall widmet sich ihrem Faible für ferne Länder und außergewöhnliche Abenteuer, sooft sie kann. Sie hat schon mit Tigerbabys in Thailand gespielt, in Italien gelernt, Pasta zu machen, und ist im Zug durch Indien gereist. Wenn sie nicht gerade quer durch die Welt unterwegs ist, lebt sie mit ihrem Mann und ihren Katzen in Albuquerque, schaut Football, zeichnet und schreibt in ihrem Blog über Jugendbücher.
Von Maggie Hall ist bei cbj erschienen:
SOCIETY – Der Kreis der Zwölf (Band 1)
Mehr über cbj auf Instagram unter @hey_reader
Maggie Hall
SOCIETY
Die Karte des Schicksals
Aus dem Amerikanischen
von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Für Dahlia.
Ich bedaure all jene, die sich ohne dich durch die Verlagswelt – und das Leben – schlagen müssen. Zu meinem großen Glück muss ich das nicht.
Und für Sofia,
danke, dass du dir mit mir den Kopf zerbrichst und am Ende mit wertvollen Ratschlägen und Wein alles wieder in Ordnung bringst.
Erstmals als cbt Taschenbuch März 2020
© 2016 Margret Hall
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Map of Fates«
bei G. P. Putnam’s Sons, einem Verlag der Penguin Random House, New York
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Doris Attwood
Umschlaggestaltung: Suse Kopp, Hamburg
unter Verwendung der Abbildungen von© iStockphoto (MicrovOne, airrazab);
© GettyImages (lambada; 4x6; BJI); © plainpicture (goZooma/Antonina Gern)
MP · Herstellung: AS
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17880-2V001
www.cbj-verlag.de
KAPITEL 1
TOURISTEN STRÖMTENDIE steile Treppe zur Basilika Sacré-Cœur hinauf, deren Umrisse an eine Hochzeitstorte erinnerten. Ich presste mich gegen das Geländer, um ihnen aus dem Weg zu gehen. »Bist du sicher, dass wir ihn hier treffen sollen?«
»Auf dem ersten Treppenabsatz westlich des Karussells«, antwortete Jack. »Das ist hier.«
Fröhliche Akkordeonmusik ertönte ganz in der Nähe und ich kam mir vor wie in einem alten Charlie-Chaplin-Film.
»Er kommt zu spät«, sagte ich.
»Du kannst von Kriminellen keine geregelten Arbeitszeiten erwarten.« Jack setzte sich auf die niedrige Mauer, die den Treppenabsatz säumte. Ich ging ungeduldig vor ihm auf und ab und suchte die Gesichter nach jenem korpulenten Mann ab, dem wir vor einer Woche unsere Fotos gegeben hatten, konnte ihn in der üblichen Menschenmenge am Sonntagnachmittag jedoch nirgends entdecken.
Das Akkordeon auf der einige Meter entfernten Terrasse verstummte und zaghafter Applaus ertönte. Hier konnte man zu praktisch jeder Tageszeit Straßenkünstler bestaunen, die mit den unterschiedlichsten Instrumenten musizierten, völlig übertriebene Pantomimen-Shows zum Besten gaben oder Porträts von Touristen zeichneten. Das Viertel hatte sich zu einem Hafen für Schriftsteller und Künstler entwickelt, seit sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ersten Einwanderer hier angesiedelt hatten. Der Montmartre hatte schon Hemingway, Picasso und F. Scott Fitzgerald ein Zuhause geboten.
So wie jetzt auch uns.
Es war inzwischen zwei Wochen her, seit Jack und ich von der Hochzeit geflohen waren, bei der ich Luc Dauphin hätte heiraten sollen, woraufhin der Orden meine Mutter entführt und meinen Freund und Jacks Mentor, Mr Emerson, getötet hatte. Insgesamt also ein eher nicht so toller Tag.
Vor zwei Wochen endete auch unsere Jagd durch halb Europa, nach der uns nur das Armband geblieben war, das ich nun Tag und Nacht am Handgelenk trug, selbst wenn ich schlief. Ich hob den Arm und es erglänzte schwach in der Nachmittagssonne. Das breite Band aus mattem Gold hatte einst Napoleon Bonaparte gehört und war Teil einer Reihe von Hinweisen, die er hinterlassen hatte und die zum Grab von Alexander dem Großen führten.
Das Grab bzw. die Waffe gegen den Orden, die sich angeblich darin befand, war unser einziges Druckmittel, mit dem wir die Freilassung meiner Mom erreichen könnten. Der Orden würde alles dafür tun, damit diese Waffe nicht dem Kreis in die Hände fiel. Ein Teil der Inschrift auf dem Armband – Mein Zwilling und ich – deutete darauf hin, dass es noch ein weiteres identisches Schmuckstück gab. Um das Grab zu finden, mussten wir also erst noch das andere Armband finden.
Wir verkrochen uns nun schon seit zwei qualvollen Wochen in einer winzigen Wohnung am Montmartre und verbrachten unsere Tage damit, verschiedene Museen in ganz Paris und das Internet nach dem Zwilling des Armbands zu durchforsten.
Zwei Wochen, in denen mein Herz jedes Mal zu rasen begann, wenn das Telefon klingelte, weil ich Angst hatte, dass der Orden anrief und uns mitteilte, dass sie meine Mutter getötet hatten, weil wir nicht schnell genug gewesen waren. Ich hoffte jedoch, dass sie nichts dergleichen tun würden, solange wir noch aktiv suchten – warum sollten sie schließlich grundlos ihr eigenes Pfand aufgeben? Jack fürchtete hingegen, dass sie es vielleicht einfach aus einer Laune heraus tun und anschließend auch mich töten oder entführen würden. Für den Orden wäre dies nicht unbedingt die schlechtere Option, denn dann könnte niemand mehr Alexanders Grab finden.
Zumindest arbeitete der Orden bereits daran, dass der Kreis es nicht fand. Anfangs hatten ihre Attentate noch willkürlich gewirkt: ein saudi-arabisches Mitglied des Kreises. Liam Blackstone, ein amerikanischer Schauspieler. Dann ein Angriff auf die Familie Dauphin, bei dem einer der ungeborenen Zwillinge von Madame Dauphin gestorben war. In Wahrheit waren sie jedoch niemals willkürlich gewesen. Das Zwillingsmädchen wäre das erste Mädchen des Kreises mit violetten Augen gewesen – abgesehen von mir. Die restlichen Attentate zielten auf Söhne ab, die möglicherweise der Eine waren, um zu verhindern, dass sie mich heiraten und damit das Mandat erfüllen könnten, wodurch angeblich der Weg zum Grab enthüllt werden würde.
Seit zwei Wochen blickte ich deshalb ständig über meine Schulter und schaute mich nach dem Orden und dem Kreis um, der mich immer noch für sich allein wollte und Jack nach wie vor für einen Verräter hielt.
Ich rieb mir die Augen und ließ meinen Blick über die Menschenmenge schweifen. Genau wie der Rest von Paris gelang dem Montmartre der Spagat zwischen schmuddeliger Großstadt und märchenhafter Kulisse perfekt. Am Fuß der Treppe stand ein Wohnhaus, das an jedem anderen Ort als Schloss bezeichnet worden wäre. Es verfügte über breite gusseiserne Balkone und Türmchen aus dunklem Stein, die in krassem Kontrast zu den schmutzigen Souvenirläden im Erdgeschoss standen, in denen Postkarten, Schals und falsche Sonnenbrillen von Dior angeboten wurden, genau wie meine echte mit den riesigen Gläsern, die ich zur Tarnung trug.
Dieses Viertel war der höchste Punkt von Paris. Anfangs hatte ich eine gute halbe Stunde damit zugebracht, Notre-Dame zu suchen. Inzwischen entdeckte ich die Kathedrale auf Anhieb, obwohl ihre Zwillingstürme zwischen all den anderen cremefarbenen und grauen Gebäuden kaum zu erkennen waren.
»Du hast auch nichts gesehen, als du die Lage ausgekundschaftet hast, oder?«, fragte ich.
Jack schüttelte den Kopf.
Ich wusste, dass er wirklich gut darin war, für unsere Sicherheit zu sorgen. Trotzdem konnte ich einfach nicht aus meiner Haut und blieb übervorsichtig. Wir gingen nie ohne Sonnenbrille und Mütze vor die Tür und versuchten, uns von Orten wie Metrostationen fernzuhalten, an denen es Überwachungskameras gab. »Ich befürchte einfach die ganze Zeit, dass uns irgendjemand finden wird.«
Jack wiegte sich, die Hände auf das Geländer gestützt, vor und zurück, und das Kompass-Tattoo an seinem Unterarm spannte sich. »Ich weiß. Aber sie glauben wahrscheinlich, dass wir mittlerweile längst am anderen Ende der Welt sind, Dim Sum in Shanghai essen oder in Brasilien am Strand liegen. Wir wären schließlich nicht so dumm, praktisch direkt vor der Haustür der Dauphins herumzulungern, richtig?«
Das stimmte zwar, aber genau das war auch unser Problem – und der Grund, warum wir nun hier warteten. Wir hatten inzwischen wirklich ganz Paris durchsucht und seit dieser Woche schlichtweg nichts mehr zu tun, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Narbengesicht, einer der Handlanger des Ordens, rief alle paar Tage an, um sich nach unseren Fortschritten zu erkundigen. Gestern hatte er jedoch zum ersten Mal angespannt geklungen. Der Kommandant, sein Boss, wurde langsam nervös. Er meinte, sie hätten uns bereits zwei Wochen Zeit gegeben, um den Hinweisen zu folgen, und fand, zwei weitere sollten ausreichen.
Uns blieben also nur noch 14 Tage, um ihnen das Grab von Alexander dem Großen zu liefern, mehr nicht. 14 Tage, um etwas zu entdecken, wonach Archäologen und Schatzsucher seit Jahrhunderten ohne Erfolg suchten. Und wenn wir es nicht fanden, würden sie meine Mutter töten.
Nur noch 14 Tage.
Wir mussten weg aus Paris. Wir mussten herausfinden, wo Napoleon das Zwillingsarmband möglicherweise versteckt haben könnte, und dort danach suchen. Museen, Kunstsammlungen, historische Stätten … Es konnte überall auf der Welt sein.
Das Problem war nur, dass ich keinen Reisepass besaß und Jacks überwacht wurde – und sofern man nicht an Bord eines vom Kreis gecharterten Privatjets saß, benötigte man nun mal einen Pass, um das Land zu verlassen. Normalerweise half der Kreis Jack mit allem, was er brauchte, aber diesmal waren wir auf uns gestellt. Nach kurzer Recherche hatten wir direkt in unserer Nachbarschaft einen zwielichtigen Typen aufgespürt, der mit falschen Papieren handelte.
Von der Treppe ging eine schmale mit Cafés gesäumte Straße ab, aus denen sich wacklige Tische über die Pflastersteine ergossen. Dazwischen entdeckte ich endlich das bekannte Gesicht eines untersetzten Typen in fleckigem grauen T-Shirt und Kakihose.
Jack hüpfte von der Mauer und klopfte den Staub aus seiner dunklen Jeans. »Da ist er.«
Ich zog mir den Hut mit der breiten Krempe tiefer ins Gesicht. Wir stiegen die Stufen hinunter und gingen auf eine Bank in der Nähe des Karussells zu. Die Musik erstarb, und ein Haufen Kinder stieg ab, während die nächsten hinaufstürmten.
»Hast du sie?«, fragte Jack.
Der Mann keuchte und strich sich das fettige rote Haar aus dem Gesicht. »Es dauert länger als erwartet«, antwortete er mit starkem französischen Akzent auf Englisch. »Komplikationen.«
»Du hast gesagt, wir kriegen sie diese Woche«, erwiderte ich mit lauter werdender Stimme. »Wie lange noch?«
»Noch eine Woche.« Er wischte sich die Nase ab. »Vielleicht auch zwei.«
Ich biss wütend die Zähne zusammen. Hinter Jacks Schulter war der Akkordeonspieler von einer Opernsängerin abgelöst worden.
»Das ist zu lange«, erwiderte ich. »Geht das nicht schneller? Wir bezahlen auch mehr.« Ich versuchte genervt zu klingen, aber meine Stimme schwankte irgendwo zwischen niedergeschlagen und panisch.
»Non«, antwortete er. »Das ist unmöglich.«
Am liebsten hätte ich laut geflucht, mit irgendetwas um mich geworfen und losgeheult, aber stattdessen sagte ich nur: »Dann vergiss es.« Wir ließen ihn stehen und stiegen die unzähligen Stufen zu den Hügeln des Montmartre hinauf, ich immer zwei auf einmal nehmend. Eigentlich hatte ich so etwas beinahe erwartet – es wäre auch zu einfach gewesen.
»Hey«, sagte Jack und schloss zu mir auf. »Es wird alles gut, okay? Uns fällt schon irgendwas ein.«
Ich nickte stumm, ging aber nicht langsamer. Ich konnte spüren, dass er mich beobachtete. Uns bot sich noch eine andere Möglichkeit, um durch Europa reisen zu können, und Jack hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er sie für die beste Option hielt.
Die Saxons konnten uns helfen. Meine neu gefundene Familie.
Auch sie hatten wir seit zwei Wochen nicht mehr gesehen.
Trotzdem ließen mich die Gedanken an meinen Vater nicht los – und die Vorstellung, dass ich einen Bruder und eine Schwester hatte, von denen ich bis vor Kurzem gar nichts wusste. Es war ganz sicher nicht so, dass ich sie nicht kennenlernen oder ihnen die Chance geben wollte, uns zu helfen. Aber es stand einfach zu viel auf dem Spiel, um irgendein Risiko einzugehen. Konnte ich diesen Fremden wirklich vertrauen, wenn das Leben meiner Mutter am seidenen Faden hing?
Am obersten Treppenabsatz bremste Jack mich aus und nahm seine Sonnenbrille ab. Ich spannte mich unwillkürlich an. Im Moment war ich einfach nicht bereit für diese Diskussion. Aber er sagte nur: »Es muss noch andere Kriminelle in dieser Stadt geben, die uns kurzfristig falsche Pässe besorgen können. Wir ziehen einfach durch sämtliche schäbigen Kneipen, bis wir einen von ihnen finden, in Ordnung?«
Ein verzweifeltes Lachen entwich meiner Kehle, aber ich nickte und entspannte mich tatsächlich ein wenig. Vielleicht gab es ja wirklich noch eine andere Möglichkeit. Er nahm meine Hand und strich mit dem Daumen über meine Handfläche. Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus, wie immer, wenn er mich so berührte.
Jack bemerkte es und ließ meine Hand so abrupt los, dass sie an meiner Seite herunterfiel. Er setzte die Sonnenbrille wieder auf und wandte sich von der Treppe ab und einer kleinen Gasse zu. »Wir sollten auf dem Heimweg im Laden vorbeigehen. Wir haben keinen Kaffee mehr.«
Ich rieb mir die Arme, um die Gänsehaut zu vertreiben, und folgte ihm. Ich durfte nicht so empfinden.
Trotz allem, was passiert war, waren Jack und ich nicht zusammen. Wir waren kein Paar. Ganz sicher nicht.
Wir hatten gleich am Anfang darüber gesprochen. Es hätte uns einfach zu sehr abgelenkt. Er wollte mich nicht in eine unangenehme Lage bringen. Ganz gleich, was wir füreinander empfanden, es war am besten, unsere Beziehung auf Eis zu legen, bis es nicht mehr um Leben oder Tod ging.
Da waren wir absolut einer Meinung. Außerdem war es schon schlimm genug, dass er mir dabei half, mich vor den Saxons zu verstecken. Wenn sie auch noch herausgefunden hätten, dass irgendetwas zwischen uns lief …
Sicher, hin und wieder passierten uns kleine Ausrutscher. Erst letzte Woche, zum Beispiel. Wir saßen auf der Couch und wälzten Geschichtsbücher über Napoleon. Plötzlich dachten wir, in einem Museum in Österreich etwas entdeckt zu haben. Ohne nachzudenken, küsste ich ihn – und er erwiderte den Kuss, als hätte er sich in seinem ganzen Leben noch nie etwas sehnlicher gewünscht. Was die ganze Sache ein paar Minuten später natürlich nur umso peinlicher machte – er löste sich so abrupt von mir, als hätte er gerade ein furchtbares Verbrechen begangen. Am Ende war dann auch noch die Spur zu dem Museum in Österreich eine Sackgasse.
Jedenfalls waren Jack und ich nur noch Freunde. Kumpel. Zwei Leute, die zusammen wohnten und in ihrer winzigen Wohnung im selben Zimmer schliefen – aber in getrennten Betten. Zwei Leute, die wirklich zu vergessen versuchten, wie es sich anfühlte, mit dem Kopf auf der Brust des anderen aufzuwachen.
Aber vielleicht ging das auch nur mir so.
Ich schaute ihn an. Die kräftigen Augenbrauen wie Sturmwolken über seinen grauen Augen. Der eckige Kiefer. Die Strickmütze, die sein dunkles Haar verbarg.
Wir waren die perfekte Definition von: Es ist kompliziert.
»Ja.« Ich schob auch meine Sonnenbrille wieder nach oben. »Kaffee. Und einen neuen Pariser Urkundenfälscher. Alles wird gut.«
Wir hatten die Wohnung beinahe erreicht, als mein Handy klingelte. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie Jack seufzte.
Hinter uns lagen auch zwei Wochen mit Stellan. Obwohl er auf der anderen Seite von Paris war, bei den Dauphins, schien es, als lebe er mit uns in unserer kleinen Wohnung, seit wir herausgefunden hatten, dass er der verlorenen dreizehnten Blutlinie des Kreises der Zwölf angehörte. Außerdem war er der Eine, auch wenn dies außer uns niemand wusste. Er war der Erbe von Alexander dem Großen – und derjenige, den ich laut des uralten Mandats des Kreises heiraten musste, um Alexanders Grab finden zu können, auch wenn ich diesen Teil natürlich nicht eine Sekunde lang glaubte.
Ich nahm den Anruf entgegen. »Brauchst du irgendwas?«
»Ich hab mich nur gefragt, was ihr heute so treibt«, antwortete Stellan betont lässig. Eine Autohupe ertönte ein Stück entfernt von uns im selben Moment wie eine Hupe am anderen Ende der Leitung. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie Stellan sich in der Nähe des Louvre zwischen kleinen schwarzen Vespas hindurchschlängelte und irgendetwas für die Dauphins erledigte.
»Nichts Besonderes«, antwortete ich. Jack und ich blieben an der Bordsteinkante stehen, als ein roter Fiat vorbeiraste, über die Pflastersteine rumpelte und um unsere Hausecke mit dem überwucherten Garten bog.
Jack zog seine Mütze vom Kopf und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Er gab vor, dass er die ganze Sache für genauso lächerlich hielt wie ich und es überhaupt nichts bewirken würde, wenn ich Stellan heiratete. Aber er war im Kreis aufgewachsen. Die Vereinigung des Einen und des Mädchens mit den violetten Augen, von der im Mandat die Rede war, bedeutete für Jack eindeutig Heirat, genau wie für den Rest des Kreises. Und ich wusste, dass ihm das mehr zu schaffen machte, als er zugab.
»Wo seid ihr?«, fragte Stellan. In den vergangenen Wochen war mir sein leichter russischer Akzent ebenso vertraut geworden wie Jacks britischer.
»Warum?«, fragte ich misstrauisch zurück. »Wo bist du?«
Wir bogen auf unsere Straße ab, und dort stand er, an die Mauer vor unserer Wohnung gelehnt. Sein langer, schmaler Körper steckte in seiner üblichen Uniform aus enger Jeans, weit geschnittenem T-Shirt und Stiefeln. Er warf sich das blonde Haar aus dem Gesicht und grinste breit. Ich seufzte und steckte mein Handy zurück in die Tasche.
»Ihm ist schon klar, dass er hier keine Dauereinladung hat, oder?«, grummelte Jack.
»Das hab ich gehört«, rief Stellan.
Jack drängte sich, ohne Hallo zu sagen, an ihm vorbei und gab den Türcode zu unserem Gebäude ein. Der inzwischen vertraute Geruch von altem Holz folgte uns die Treppe hinauf. Jack hielt die Wohnungstür für mich auf und runzelte die Stirn. »Wir haben den Kaffee vergessen.«
»Ich kann später noch mal losgehen.«
»Nein, ich gehe gleich. Ist das okay?« Sein Blick huschte zu Stellan, der gerade die Wohnung betrat. Ich nickte. »Ich bin in einer Minute wieder da«, fügte Jack hinzu und schloss die Tür hinter sich.
»Es ist wirklich entzückend, wie ihr zwei hier Familie spielt.« Stellan ließ sich auf die Couch fallen und streckte die Arme über die Lehne aus. Die Wohnung hatte nur zwei Zimmer: ein Schlafzimmer von der Größe eines Kleiderschranks und dieses hier, das über eine Küchenzeile, einen kleinen Tisch und eine Couch verfügte, die unter den Fenstern zum sonnigen Innenhof stand.
Ich warf den Hut und die Sonnenbrille auf den Tisch und blickte zu unserer »Wand der Rätsel« hinüber, an der kopierte Seiten aus Napoleons Tagebuch hingen, das wir ebenfalls dank Mr Emersons Hinweisen entdeckt hatten. Außerdem pinnten dort die Inschrift des Armbands, Fotos des Wasserspeiers, der uns zu dem Tagebuch geführt hatte, und eine Weltkarte. Die Städte, in denen wir vielleicht etwas finden würden, hatte ich mit bunten Nadeln markiert und Broschüren verschiedener Museen sowie Notizen danebengehängt. Im Prinzip sah es so aus, als hausten hier durchgeknallte Verschwörungstheoretiker. Aber ich schätze, das war auch gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt.
»Wolltest du irgendwas Bestimmtes, oder bist du nur hier, um uns zu nerven?«, fragte ich über meine Schulter hinweg.
»Habt ihr endlich Fortschritte gemacht oder lief eure Idee mit den falschen Reisepässen nicht ganz nach Plan?«, fragte er zurück.
Mir krampfte sich schmerzhaft die Brust zusammen. »Ich muss wohl verpasst haben, dass du einen besseren Vorschlag hattest – oder uns angeboten hättest, den kompletten Kontinent allein nach dem zweiten Armband abzusuchen.«
Stellan trommelte mit den Fingern auf der Sofalehne herum. »Du weißt sehr wohl, dass ich eine bessere Idee habe …«
Ich schüttelte den Kopf und zog einen Zeitungsartikel aus meiner Handtasche, der uns vorhin aufgefallen war. Ein weiterer Hinweis für unsere durchgeknallte Verschwörungswand.
»Sag mir nur eins«, fügte Stellan nach einer Minute hinzu. Ich spürte, wie er mich beobachtete, während ich den Artikel an die Wand pinnte. »Ist es seinetwegen?«
»Was?« Ich wusste ganz genau, wovon er sprach.
»Du weißt, was ich meine, kuklachka. Weigerst du dich wegen deiner Gefühle für jemanden, den du eben erst kennengelernt hast, das Mandat zu erfüllen?«
Ich rieb mir das Gesicht. »Ich würde sagen, die eigentliche Frage ist doch, warum du mich heiraten willst. Das Grab von Alexander dem Großen ist seit Jahrhunderten verschollen. Ich leugne ja gar nicht, dass es in der Welt des Kreises etwas zu bedeuten hätte, wenn wir beide heiraten würden, aber eine Kirche und ein weißes Kleid erzeugen noch keine Magie.« Er wollte mir widersprechen, aber ich schnitt ihm das Wort ab. »Vereinigung bedeutet vielleicht etwas anderes als Heirat – etwas, das uns tatsächlich dabei helfen könnte, das Grab aufzuspüren. Aber bis wir herausfinden, ob dem so ist und was es damit genau auf sich hat, stehen unsere Chancen besser, wenn wir Hinweisen folgen, die jemand hinterlassen hat, der auch wirklich dort war, anstatt einander ewige Treue zu schwören. Schließlich haben wir diese Hinweise. Irgendwo dort draußen gibt es ein zweites Armband, das wir suchen müssen. Und wenn wir dann auch noch das Passwort finden, wird es uns sagen, wie wir zum Grab gelangen. Hoffe ich«, endete ich atemlos.
Das war noch so ein Problem: Das zweite Armband war nicht das Einzige, was uns noch fehlte. Ich schob den Daumen unter das Armband an meinem Handgelenk. Auf der Außenseite waren nur die Inschrift und die Dekorationen zu erkennen. Bei genauerer Betrachtung war uns jedoch aufgefallen, dass die Innenseite eine zusätzliche Ebene hatte. Es war in fünf identische Bänder unterteilt, die ich einzeln um mein Handgelenk drehen konnte und in die jeweils eine lange Reihe von Buchstaben eingraviert war. Wir vermuteten, dass es wie ein Kombinationsschloss funktionierte: Wenn wir die einzelnen Teile so verschoben, dass die Buchstaben entlang der vorgegebenen Linie das richtige Passwort bildeten, würde irgendetwas passieren. Wir hofften, dass dann auch die restlichen Buchstaben Worte bilden würden, die uns womöglich verrieten, wo sich das Grab befand.
Stellan rutschte an die Sofakante vor und bildete mit den Fingern ein Dreieck unter seinem Kinn. Im durch das Fenster hereinströmenden Gegenlicht sah es aus, als würde er rundum glühen. »Erstens möchte ich dich daran erinnern, dass ich feuerfeste Haut habe.«
Seine Hand wanderte zu den durchscheinenden Narben, die unter seinem Ausschnitt zu erkennen waren. Es stimmte. Als er im Keller der Dauphins ein brennendes Feuerzeug an seine Haut gehalten hatte, war sie kein bisschen angesengt. Der Eine, der durch Feuer geht und nicht verbrennt, hieß es im Mandat. Der Kreis wusste jedoch nicht, dass es so wörtlich zu verstehen war.
»Ich werde das Wort Zauberei nicht in den Mund nehmen, weil es eine wissenschaftliche Erklärung dafür geben muss, falls diese Eigenschaft bei mir in der Familie liegt«, fügte er hinzu. »Trotzdem bin ich mir sicher, dass mehr hinter der Sache steckt, als wir begreifen.«
Ich presste die Lippen zusammen und wandte mich wieder der Wand mit den Hinweisen zu.
»Und zweitens«, fuhr er fort, »falls irgendjemand im Kreis etwas von der dreizehnten Blutlinie erfährt – die du übrigens entdeckt hast, vielen Dank dafür – und du mir nicht den Rücken stärkst, bin ich tot, weil sie annehmen werden, dass ich einen Coup plane. Und selbst wenn es mir gelingen würde zu entkommen, wäre ich für den Rest meines Lebens auf der Flucht, genau wie meine Schwester.«
Stellans Akzent klang bei seinen letzten Worten stärker durch als üblich. Ich stellte mir das kleine blonde Mädchen auf dem Foto vor, das er mir gezeigt hatte: Anya. Kurz nachdem wir von der Hochzeit geflohen waren, hatte er dafür gesorgt, dass jemand in Russland seine Schwester versteckte, nur für den Fall. Ich wusste jedoch, dass er sich trotzdem Sorgen um sie machte.
»Aber wenn ich dich an meiner Seite hätte?«, sprach er weiter. »Wenn ich an das Mädchen gebunden wäre, das sie für ihre Rettung halten? Der Kreis hat zwar keinen alleinigen Anführer, aber du kommst dem immer noch am nächsten – und wenn wir beide zusammen wären, kämen wir dem am nächsten. Dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen und müsste nicht noch mehr Angst davor haben als ohnehin schon, dass mich vielleicht irgendjemand umbringt. Und darum will ich es tun.«
Aus irgendeinem Grund hatte ich die Sache noch nie so betrachtet. Die Anführerin des Kreises? Ich drückte eine der Pinnnadeln tiefer in die Wand. »Du glaubst, jemand hat vor, dich zu töten?«
Stellan sank auf der steifen grünen Couch zurück und ihr Quietschen durchschnitt die Stille. »In dieser Welt hat immer jemand vor, dich zu töten.«
Wir blickten beide zuerst zum Fenster und dann zur Tür. »Und überhaupt«, fragte er, »woher willst du eigentlich wissen, dass es bei der Vereinigung nicht um Heirat geht?«
»In Napoleons Tagebuch –«
»Stand nicht explizit, dass dem nicht so ist.«
»Ich weiß, was der Kreis glaubt. Aber warum hätte Napoleon überhaupt Hinweise hinterlassen sollen, wenn durch die Hochzeit zweier Menschen eine Art Bethlehem-Stern erschaffen wird, der den Weg zum Ziel weist?«, beharrte ich und gestikulierte in Richtung Wand.
»Ich meine ja nur.« Stellan stand von der Couch auf. »Du behauptest, dass du alles tun würdest, um deiner Mutter zu helfen. Aber obwohl du nur noch so wenig Zeit hast, bist du noch nicht einmal bereit, über die Vereinigung nachzudenken. Oder die Saxons um Hilfe zu bitten, wenn wir schon dabei sind.«
Ich versteifte mich. »Du auch noch? Sie sind meine Familie. Ich sollte diejenige sein, die entscheidet, was ich mit ihnen tun will oder auch nicht.«
Er hob einen Finger, um mich zum Schweigen zu bringen. »Sie sind dein Blut. Aber sie müssen nicht deine Familie sein, wenn du es nicht möchtest. Und vielleicht willst du das ja wirklich nicht.«
Ich zitterte. Draußen war es warm, aber diese alten Steingebäude speicherte die Kälte. »Was soll das nun wieder bedeuten? Natürlich will ich, dass sie meine Familie sind.« Ich wünschte nur, es wäre so einfach: dass Dinge wahr wurden, indem man sie sich einfach wünschte. Ich schloss die Finger fest um mein Medaillon, in dem sich das einzige Bild des Menschen befand, der immer meine Familie gewesen war. Des Menschen, der nun meine erste Priorität sein musste.
Wäre meine Mom hier, was täte sie dann? Würde sie den Saxons vertrauen? Würde sie versuchen, einen anderen Weg zu finden? Meine Mom war nie der Typ für Pro-und-Kontra-Listen gewesen. Wann immer ich eine Entscheidung treffen musste, riet sie mir, auf mein Herz zu hören, weil es ganz genau wisse, was ich wirklich wollte, und niemals falschliegen könne, wenn ich ihm folgte. Ich erinnerte sie dann jedoch immer daran, dass mein Herz wahrscheinlich niemals einen Mathekurs würde belegen wollen, obwohl ich ihn für meine Collegebewerbungen unbedingt brauchte. Allerdings half mir das im Augenblick auch nicht weiter. Alles, was mein Herz wollte, war, sie zu retten – ich wusste nur nicht, wie.
Stellan hob die Augenbrauen.
»Ich glaube einfach, dass ich diejenige sein sollte, die entscheidet, wen und wann ich heirate. Und vielleicht würden mich die Saxons ja nur mit jemandem verkuppeln, der noch schlimmer ist als du«, fügte ich schnippisch hinzu.
»Also, das war jetzt einfach nur unhöflich.« Stellan durchquerte den Raum und schob den schweren Vorhang zur Seite, den wir für gewöhnlich geschlossen hielten. Das sanfte Licht des Sonnenuntergangs fiel ins Zimmer, als er auf die Straße hinausblickte.
Ich fegte einen einsamen Brotkrümel von der Arbeitsplatte. »Wenn ich zu den Saxons gehe, helfen sie mir entweder … oder sie sperren mich ein und zwingen mich, den Höchstbietenden zu heiraten. Folglich ist es für mich am sichersten, das Grab auf eigene Faust zu finden.«
»Falls du es findest.«
Ich schnaubte entnervt. »Brauchen die Dauphins dich nicht für … irgendwas? Nein?«
»Sie will damit sagen, dass du hier nicht länger erwünscht bist.« Jack betrat die Wohnung und warf eine Packung Espressobohnen auf die Arbeitsplatte.
»Na schön.« Stellan ließ den Vorhang los und tauchte das Zimmer wieder in schummriges Licht. »Es war schön, euch zu sehen – wie immer. Wir reden morgen weiter.«
Und damit verschwand er. Was er gesagt hatte, steigerte meine Besorgnis jedoch nur umso mehr. Mein Plan, die Rätsel allein zu entschlüsseln und den Hinweisen zu folgen, ging offensichtlich nicht auf. Irgendetwas musste sich ändern.
Nach dem Abendessen saß ich auf der Couch, während sich Jack vor der Wand der Rätsel aufbaute und den neuen Artikel las, den ich vorhin dort aufgehängt hatte. Er handelte von einem Versteck mit napoleonischen Artefakten, das in der Nähe von Neu-Delhi in Indien entdeckt worden war.
»Das bedeutet also, dass Napoleon überall war«, sagte er.
Ich zuckte mit den Schultern. Wir wussten, dass wir nicht nur in Paris suchen konnten – falls wir jemals unsere Pässe bekämen –, aber die Liste mit möglichen Zielen für unsere Suche wuchs stetig weiter.
Ich vergrub das Gesicht in den Händen und spürte, wie sich die Couch bewegte, als Jack sich neben mich setzte.
»Na schön, die Möglichkeiten sind schier endlos«, begann er. »Aber einen Anhaltspunkt haben wir immerhin: Wir vermuten, dass Napoleon das zweite Armband oder weitere Hinweise an Orten versteckt hat, die ihm, dem Kreis oder Alexander etwas bedeuteten, richtig?«
Ich nickte. Wenn er gewollt hatte, dass jemand die Hinweise entdeckte, dann hätte er sie wohl kaum auf irgendeinem x-beliebigen Acker vergraben.
»Deshalb finden wir jetzt erst mal eine Möglichkeit, von hier wegzukommen, und dann suchen wir ganz methodisch in Städten, die eine gewisse Bedeutung für den Kreis haben. Oder an Alexander-Denkmalen. Wo immer wir können, solange uns noch Zeit bleibt«, fügte er hinzu.
Jack klang immer so ruhig. So logisch. Er erhob sich wieder und legte eine Hand auf meine Schulter, zog sie dann jedoch wieder zurück und stand ein wenig verlegen neben mir. »Ich gehe ins Bett.«
Nicht, hätte ich beinahe gesagt. Ich will jetzt nicht mit meinen Gedanken allein sein. Ich brauche jemanden. Ich brauche dich.
»Gute Nacht«, erwiderte ich stattdessen nur. Wenigstens hatte ich eine Menge Übung darin, meine wahren Gefühle zu verbergen – mich dazu zu zwingen, sie zu verbergen.
»Wie schon gesagt«, erwiderte er nach einem Moment, »es wird alles gut, okay? Wir finden eine Lösung.«
Ich nickte und versuchte, ihm zu glauben.
Er verschwand im Schlafzimmer und kickte im Gehen die Schuhe von den Füßen. Ich seufzte, zog eins der Geschichtsbücher aus dem Stapel auf dem Couchtisch und las zum tausendsten Mal alles über Napoleons Frankreich-Feldzug. Über Alexanders Zeit in Ägypten. Über Napoleons Außenposten in Nordfrankreich. Über Alexanders Eroberungen in Indien.
Ich schnappte mir mein Handy. Indien. Elefanten. Leuchtende Farben. Mit leuchtenden Farben bemalte Elefanten. Der Schatz Napoleons, den sie kürzlich gefunden hatten, befand sich in Delhi, nicht in Kalkutta, wo die in Indien ansässige Familie des Kreises lebte. Ich suchte nach bedeutenden Denkmälern in Kalkutta. Nach Tempeln. Nach dem Indischen Museum, in dem offensichtlich sowohl Artefakte von Alexander als auch europäische Kunst und Schmuck ausgestellt waren. Es war ein sehr schönes Gebäude, wirkte jedoch zu neu. Erbaut … ha! Erbaut 1814. Im selben Jahr, in dem Napoleon aus Frankreich verbannt worden war.
Ich kritzelte eine Notiz dazu auf ein Blatt Papier und pinnte es an die Wand. Vielleicht war Indien ja unser erstes Ziel, falls wir jemals einen Weg fanden, Paris zu verlassen.
Eine Sekunde lang stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn ich den Saxons vertrauen würde. Mit ihren Mitteln konnten wir überallhin gelangen. Außerdem, flüsterte eine leise Stimme in meinem Hinterkopf, wärst du dann wirklich ein Teil einer Familie. Meiner Familie. Ich versuchte nicht darüber nachzudenken, wie sehr ich mich in Wirklichkeit danach sehnte. Aber es war wie mit jedem anderen Verlangen auch: Je mehr ich es mir verwehrte, desto größer wurde es.
Ganz gleich, wie sehr ich es mir auch wünschte, es war die Sache nicht wert, das Leben meiner Mom dafür zu riskieren, sagte meine rationale Seite. Aber war das Risiko wirklich so groß?
Ich fuhr mir mit den Händen übers Gesicht. Für heute hatte ich genug. Ich musste wenigstens versuchen, ein bisschen zu schlafen.
Ich nahm die braunen Kontaktlinsen heraus, mit deren Hilfe ich meine violetten Augen verbarg, und schlich mich ins dunkle Schlafzimmer.
Jack hatte heute Morgen auch mein schmales, hartes Bett gemacht, die Laken exakt an den Ecken gefaltet und das Kopfkissen aufgeschüttelt und eingeschlagen. Genauso perfekt, wie er unsere Betten jeden Tag machte, sämtliches Geschirr spülte und anhand eines minutengenauen Zeitplans durch die Nachbarschaft patrouillierte, damit ihm nichts Ungewöhnliches entging. Alles war stets ordentlich und an seinem Platz, er selbst eingeschlossen – ein dunkler Hügel unter der Bettdecke, schlafend im silbernen Mondlicht. Genau, wie er es sollte. Genau, wie er es jede Nacht tat, während ich wach lag und an die Zimmerdecke starrte. Grübelte, mir Sorgen machte und versuchte, mein Hirn wenigstens so lange auszuschalten, dass ich die Augen schließen konnte, ohne all diese schrecklichen Dinge hinter meinen Lidern heraufzubeschwören.
Ich wappnete mich geistig für eine weitere lange, rastlose Nacht, als Jack sich plötzlich umdrehte. Im spärlichen Licht glänzte das Weiße in seinen Augen, als er einmal blinzelte, dann ein zweites Mal. Er hob die Bettdecke an, rutschte an den hinteren Rand seiner Matratze und machte auf seinem Bett einen Platz für mich frei, obwohl es kaum groß genug für einen war.
Ich zögerte nur eine Sekunde lang, bevor ich mein eigenes Bett ignorierte und dankbar in seines kletterte, den Kopf auf seine Brust legte und seinen Arm um mich schlang. In dieser Nacht musste ich nicht lange an die Decke starren.
Am nächsten Morgen, am ersten Tag der dritten Woche, erwachte ich noch immer in Jacks Armen. Er öffnete die Augen, als ich mich aufsetzte. »Morgen«, sagte er verschlafen. Sein Haar klebte an einer Seite seines Gesichts. Ich widerstand dem Drang, mit den Fingern hindurchzukämmen.
»Guten Morgen.« Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass ich endlich ein wenig Schlaf gefunden hatte, oder daran, dass ich wieder daran erinnert worden war, dass ich Jack wirklich etwas bedeutete – aber mit einem Mal wusste ich, was ich zu tun hatte. Es gab nur eine einzige Option, die wirklich Sinn ergab.
»Wir müssen die Saxons um Hilfe bitten«, sagte ich.
KAPITEL 2
MEIN VATERHATTE offensichtlich immer einen Jet auf Abruf bereitstehen. Am frühen Nachmittag, nur wenige Stunden nachdem ich ihn angerufen hatte, landeten Jack und ich am Flughafen Heathrow in London. Mein Magen grummelte nervös, was allerdings nicht nur an dem Flug lag. Als wir aus der Maschine stiegen, wartete auf der Rollbahn bereits ein glänzender schwarzer Helikopter auf uns.
»Miss West, nehme ich an? Und Jack Bishop?« Der Pilot musterte Jack kurz von oben bis unten, und ich konnte in seinen Augen erkennen, dass es nicht nur den Saxons missfiel, dass Jack mit mir davongelaufen war. Alle, die für sie arbeiteten, waren unglaublich loyal – was Jack getan hatte, war eigentlich unvorstellbar.
Ich warf Jack einen Blick zu. Zum allerersten Mal wirkte er ein wenig unsicher, was seinen Plan anging.
Ein Hüter – denn das war Jack für die Saxons, ebenso wie Stellan ein Hüter der Dauphins war – war mehr als nur ein Angestellter. Ein Hüter war eine Mischung aus Sicherheitschef, Berater und persönlichem Assistenten. Er gehörte beinahe zur Familie, weit mehr als irgendein Angestellter. Jede Familie hatte nur zwei Hüter: einen älteren und erfahreneren und seinen Stellvertreter, der sich noch in der Ausbildung befand und sich darauf vorbereitete, die Position des älteren Hüters zu übernehmen, sobald dieser die Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte … oder sobald ihm irgendetwas passierte. Diese Stellung hatten auch Jack und Stellan inne. Hüter erledigten die Aufgaben, die eine Familie keinem anderen anvertrauen wollte. Wenn der Hüter einer Familie plötzlich während der Erfüllung einer dieser Aufgaben verschwand – in diesem Fall war das ich –, blieb dies nicht ohne Konsequenzen.
Ganz davon zu schweigen, dass eine Romanze zwischen Angestellten und Familienmitgliedern absolut tabu war und dazu führen konnte, dass man sich des Angestellten deswegen »entledigte« – die gängige Umschreibung des Kreises für die Ermordung von Regelbrechern. Auch wenn Jack und ich in dieser Hinsicht nichts zu befürchten hatten, machte mich der durchdringende Blick des Piloten nervös.
Dann wandte sich der Mann jedoch mir zu. »Es gibt eine Planänderung in letzter Minute. Sie treffen Miss Lydia in der Stadt, bevor Sie zum Familiensitz zurückkehren.« Er reichte mir riesige gelbe Kopfhörer. »Bitte, Miss West, machen Sie es sich bequem.«
Eine Sekunde später krallte ich mich an den Armlehnen meines Sitzes fest und sah zu, wie die Erde unter mir immer weiter schrumpfte. Wir stiegen schnell über grüne und gelbe Felder auf und flogen Richtung London, das mit jeder Minute größer wurde. Wie durch Paris floss auch durch London ein Fluss, aber dennoch wirkte es neuer und moderner, eher wie eine Weltstadt. Hier gab es viel mehr glänzende Wolkenkratzer, die Straßen waren breiter, und auf dem gewaltigen Strom fuhren größere Schiffe. Die Stadt erstreckte sich, so weit das Auge reichte.
Wir flogen über leuchtend grüne Parks, über ein weißes Riesenrad, das so klein wirkte, als könne ich es um meinen Ringfinger tragen – »Das ist das London Eye«, hörte ich Jacks Stimme durch die Kopfhörer – und über eine Brücke, die einem Roman von Charles Dickens zu entstammen schien. »Die Tower Bridge«, erklärte Jack, während sie sich in der Mitte teilte, um ein Kreuzfahrtschiff passieren zu lassen.
Paris fühlte sich für mich inzwischen so vertraut an, dass diese neue Stadt ein viel größerer Schock für meine Sinne war, als ich es erwartet hatte. Wir flogen über Big Ben, das Parlament und das Britische Museum hinweg, von denen ich schon tausend Mal gehört hatte. Mom hätte es geliebt. Es gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, eine Tour durch jede neue Stadt zu machen, in die wir ziehen. Plötzlich fiel mir wieder ein, dass sie auch mal in London gelebt hatte. Hier war sie meinem Vater begegnet.
Nach gefühlt nicht einmal einer Sekunde landeten wir auf einem Dach im Stadtzentrum. Die Rotoren drehten sich immer noch, als Jack die Tür aufstieß und mir aus dem Hubschrauber half. Ich klammerte mich ein wenig länger an ihn, als ich es hätte tun sollen, bis sich meine wackligen Beine wieder etwas stabilisiert hatten.
Dann ließ er mich sehr abrupt los. Als ich mich umdrehte, erkannte ich, warum: Lydia Saxon kam über den Helikopterlandeplatz auf uns zu. Meine Schwester.
Ich war Lydia bisher nur einmal begegnet, beim Ball im Eiffelturm, als ich erfahren hatte, dass die Saxons meine Familie waren. In den vergangenen zwei Wochen hatte ich jedoch jede Gelegenheit genutzt, im Internet alles über sie zu erfahren. Als Verschleierungstaktik und um zu erklären, warum sie so unfassbar reich und so gut vernetzt waren, gaben die Saxons vor, entfernt mit dem britischen Königshaus verwandt zu sein, weswegen die Regenbogenpresse häufig über sie berichtete: Lydia, die ihren Zwillingsbruder Cole von einer Schlägerei in einer Kneipe fortriss. Beide Zwillinge – er in einem eleganten Anzug mit Weste, sie mit auffälligem Hut – bei der Taufe eines neuen royalen Babys. Mit jedem weiteren Foto, das ich von ihr sah, kam mir das Ganze nur umso surrealer vor. Und sie jetzt in Fleisch und Blut vor mir zu sehen, war noch eigenartiger.
Lydia trug einen klassischen kakifarbenen Trenchcoat über einem blauen Sommerkleid und hatte das Haar zu einem Knoten zusammengebunden. Ihre Augen sahen aus wie meine, abgesehen von der Farbe: ein bisschen zu groß und ein bisschen zu weit auseinanderstehend leuchteten sie unter dunklen Augenbrauen. Ihre Haut schimmerte olivfarben, während ich so blass war, dass ich beinahe durchsichtig wirkte. Als sie näher kam, erkannte ich, dass wir ohne ihre hohen Absätze vermutlich gleich groß gewesen wären.
Sie blieb direkt vor uns stehen. »Hi«, sagte sie und ließ ihre lange Halskette durch die Finger gleiten.
»Lydia.« Mir wurde bewusst, dass auch ich an meinem Medaillon herumspielte, und zwang mich, damit aufzuhören. Sollte ich sie umarmen? Ihr die Hand schütteln? Ich ließ beides. »Hi. Danke fürs Abholen. Ist alles in Ordnung? Ich dachte, wir wollten zu euch nach Hause?« Ich plapperte wild drauflos, während in meinem Kopf ein Katastrophenszenario nach dem anderen ablief: Das Sicherheitspersonal stand bereit, um mich in eine Zelle zu stecken. Sie hatten die Hochzeitszeremonie bereits in einer Kirche ganz in der Nähe vorbereitet und mir blieb keine Zeit mehr wegzulaufen.
Lydia schüttelte den Kopf. »Vaters Besprechung im Parlament dauert länger als gedacht. Er wollte dich eigentlich selbst abholen, aber jetzt soll ich dir erst mal alles zeigen. Sobald er fertig ist, treffen wir ihn zu Hause.« Ihre Augen weiteten sich. »Ist der Helikopter okay für dich? Ich war mir nicht sicher, weil du ja nicht daran gewöhnt bist, aber Vater meinte, damit geht es am schnellsten –«
»Alles bestens«, versicherte ich ihr und entspannte mich allmählich. Der Helikopter war die geringste meiner Sorgen.
Lydia schwankte auf den Fersen vor und zurück. Benahm sie sich vielleicht so eigenartig, weil sie genauso nervös war wie ich?
Als wolle sie meine Frage beantworten, blickte sie auf. »Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, wusste ich nicht, dass du meine Schwester bist«, sagte sie. »Trotzdem bin ich froh, dass du jetzt hier bist.«
Mein Herz explodierte vor Freude und Erleichterung in tausend Einzelteile. Ich musste mich regelrecht zwingen, nicht die Arme um sie zu schlingen. Dieses Gefühl – Glück? – war nach den letzten zwei Wochen ganz fremd für mich.
»Ich auch«, erwiderte ich. »Ich bin auch froh, hier zu sein.« Lydia grinste und mit einem Mal löste sich meine ganze Anspannung in Luft auf. Ich hatte eine Schwester. Ich hatte eine Familie. Und sie mussten mir helfen. Das machten Familien schließlich so, oder?
Lydia warf lachend einen Blick auf Jack, der sich ein paar Schritte entfernt hielt und ins Leere starrte. »Oh, hör schon auf«, sagte sie, ging zu ihm und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Genau wie es mir schon beim Ball aufgefallen war, schien sich Jack in ihrer Gesellschaft nicht annähernd so wohl zu fühlen wie Stellan mit seinem Schützling, Luc Dauphin.
»Lydia.« Jack verneigte sich förmlich.
»Vater ist nicht da. Du musst nicht so furchtbar steif sein«, sagte sie, und ich entspannte mich noch mehr. Lydia schien Jack die ganze Sache offensichtlich nicht übel zu nehmen. »Ich will alles über eure Abenteuer hören, die ihr zwei hinter euch habt.«
Sie nahm meinen Arm und zog Jack hinter uns her zu einem Fahrstuhl, der uns in eine mit dunklem Holz ausgekleidete Lobby direkt neben einer belebten Straße transportierte. Jack übernahm das Reden und fütterte sie mit einstudierten Erklärungen: dass wir nicht schon früher zu ihnen gekommen waren, weil ich Angst gehabt, er aber dennoch alles getan hat, um dafür zu sorgen, dass ich in Sicherheit war.
»Dann wart ihr die ganze Zeit in Paris?«, fragte Lydia, während ich zusah, wie ein roter Doppeldeckerbus auf der falschen Straßenseite vorbeifuhr, gefolgt von einer ganzen Reihe schwarzer Taxis, die aussahen wie Melonen.
»Ja«, antwortete ich und löste mich widerwillig von Londons Charme. »Genau, wie ich es deinem Vater … unserem Vater … Alistair …« Wie sollte ich ihn eigentlich nennen? »Wie ich ihm schon am Telefon gesagt habe, hat der Orden meine Mom, und ich habe versucht, ihr zu helfen. Paris schien mir dafür der beste Ort zu sein. Jetzt bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher, ob das wirklich der Fall ist.«
Lydia nickte. »Du hast gesagt, der Orden will, dass du das Grab findest? Und die Information über den Standort gegen deine Mum austauschst?«
Jack warf mir einen hastigen Blick zu. Wir hatten darüber gesprochen. Wir würden den Saxons fast alles erzählen.
»Das verlangen sie zumindest«, antwortete Jack. »Aber wir hoffen natürlich, dass wir sie trotzdem daran hindern können, das Grab zu betreten.«
Ein Stirnrunzeln huschte über Lydias Gesicht, verschwand jedoch sofort wieder. »Natürlich«, stimmte sie zu.
Ich berührte das Armband an meinem Handgelenk, das im Augenblick unter meiner Strickjacke versteckt war.
Ein paar Minuten lang gingen wir schweigend weiter. Ich konnte nicht anders, als mit großen Augen über diese Stadt zu staunen. Die imposanten Steintürme und schillernden Wolkenkratzer. Die leuchtend roten Telefonzellen und die glänzenden neuen Straßenschilder. Das Saubere und Moderne, das in starkem Kontrast zum gemütlichen, abgenutzten Charme der restlichen Stadt stand, so als würden sich die Gebäude am liebsten hinsetzen und eine Tasse Tee mit einem trinken.
Die Menschen waren hingegen genau wie in jeder anderen Großstadt auch: wuselnd, hastend, drängelnd. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob ich schon jemals so viele unterschiedliche Menschen an ein und demselben Ort gesehen hatte.
Man hörte zwar immer, wie multikulturell London war, aber ich hatte es mir nie richtig vorstellen können. Wir kamen an einer Gruppe asiatischer Geschäftsleute in teuren Anzügen vorbei, die neben ein paar Jugendlichen saßen, deren Akzent osteuropäisch klang. Sie waren eindeutig jünger als ich, aber ihre Vokuhilas und verwaschenen Jeans stammten aus einer Zeit, als es mich noch gar nicht gegeben hatte. Zwischen ihnen tollte ein Haufen Kindergartenkinder. Ein kleines indisches Mädchen mit entzückendem britischen Akzent schrie kreischend einen blassen rothaarigen Jungen an, weil es auch endlich das Springseil wollte.
Ich hatte schon ganz vergessen, wie es war, die Unterhaltungen auf den Straßen zu verstehen. Einen Moment lang blieb ich stehen und belauschte ein Pärchen, das darüber diskutierte, wohin es zum Abendessen gehen sollte, und staunte darüber, wie fremd meine eigene Muttersprache plötzlich klang.
Obwohl ich schon an so vielen verschiedenen Orten gewohnt hatte, gehörte ich theoretisch hierhin. Hier lebte meine Familie. London wäre mein Zuhause, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Meine Schwester fühlte sich auf diesen breiten, sauberen Straßen offensichtlich sehr wohl.
Wahrscheinlich hatte ich unterbewusst erwartet, irgendeine Verbindung zu dieser Stadt zu spüren.
Aber ich fühlte mich auch nicht anders als in jeder anderen fremden Stadt. Wenn man so häufig umzog wie Mom und ich, war Zuhause überall und nirgends. Man gewöhnte sich ebenso daran, sich die Haare in einem Days Inn Motel am Highway zu waschen, wie an die speziellen Eigenheiten jeder neuen Küche. Vermutlich war es mit Menschen genauso. Würde ich wirklich je das Gefühl haben, mehr zu den Saxons zu gehören als zu irgendjemandem sonst?
Wie aufs Stichwort nahm Lydia einen Anruf entgegen und teilte der Person am anderen Ende mit, dass wir fast da waren.
»Vater ist so weit«, verkündete sie. »Bringen wir dich nach Hause.«
KAPITEL 3
»ZUHAUSE« WAREIN umzäuntes Anwesen am Stadtrand von London. Ein breiter Fußweg führte von der Einfahrt zum Haus. Vom Helikopterlandeplatz auf dem Dach blickten wir über das Grundstück, das sich bis zu einem schillernden Swimmingpool, einem Reitstall und einer eigenen Rennstrecke ausdehnte, auf der ein einsames Fahrzeug kreiste. Zahlreiche Blumenbeete mit in der sanften Spätnachmittagsbrise schwankenden Wildblumen sorgten dafür, dass dieses Anwesen nicht zu förmlich wirkte.
Nachdem Jack uns aus dem Hubschrauber geholfen hatte, verschwand er mit einem flüchtigen Kopfnicken in meine Richtung und ließ mich mit meiner Schwester allein. Lydia begann sofort mit einer umfassenden Tour durch das Haus und hörte erst wieder auf zu reden, als sie sich fürs Abendessen umzog. Sie bot an, mir etwas aus ihrem Kleiderschrank auszusuchen, aber ich war nicht sicher, ob wir wirklich schon so weit waren, um Klamotten zu tauschen. Bevor wir am Morgen in Paris aufgebrochen waren, hatte ich mir bereits etwas Schickeres angezogen und mich für ein klassisches schwarzes Kleid entschieden. Während ich im Wohnzimmer auf Lydia wartete, piepste eine Nachricht auf meinem Handy. Ich hoffte, dass sie von Jack käme und er mir mitteilte, wo er sich befand und dass alles in Ordnung sei.
Aber er war es nicht. Es war Narbengesicht. 13 Tage, lautete die Nachricht.
Ich warf das Handy zurück in meine Tasche, als stünde es in Flammen. Die Nachricht war nicht nur eine weitere Erinnerung daran, dass meine Mom in Lebensgefahr schwebte, sondern auch daran, dass ich plante, die Saxons zu hintergehen. Bis jetzt hatte ich deswegen kein schlechtes Gewissen gehabt, aber nachdem ich Lydia getroffen hatte, meldete es sich immer lauter.
Kurz darauf tauchte meine Schwester in einem schwarzen Kleid mit Spitzenkorsage und fließendem A-Linienrock wieder auf und wir gingen gemeinsam ins Esszimmer. Das Innere des Hauses passte perfekt zu dem, was ich von außen gesehen hatte: alt und elegant, aber so zurückgenommen, dass die Einrichtung der Dauphins im Louvre im Vergleich dazu unglaublich protzig wirkte.
Jedes Mal, wenn wir auf unserer Tour durch mein »Zuhause« um eine Ecke bogen, erwartete ich, meinen Vater dahinter stehen zu sehen. Doch auch als wir das formelle Esszimmer erreichten, waren wir immer noch allein, abgesehen von zwei Mädchen in schwarzen Uniformen, die an der hinteren Wand standen. Der Raum war mit dezentem Damast tapeziert und mit dunklem Holz verkleidet. Vor den Fenstern hingen schwere Samtvorhänge. Ein klirrender Kristallleuchter über der langen Tafel spendete Licht, auf der am einen Ende vier Gedecke standen, während in der Mitte Kerzen flackerten. Lydia setzte sich und deutete auf den Stuhl ihr gegenüber. »Du bist also in … Minnesota aufgewachsen, richtig?«
Ich nickte. »In Minnesota, und davor in Portland, New York, Florida …«
Lydia stellte ihr Glas mit Mineralwasser ab und rümpfte die Nase. »Das klingt ja furchtbar.«
»Es war nicht ideal.« Ich gestikulierte durch den Raum. »Nicht so wie hier.«
»Du hättest hier aufwachsen können.« Lydia stützte die Ellenbogen auf dem Tisch ab und neigte den Kopf zur Seite. »Es ist so komisch, dass deine Mutter dir nie etwas von uns erzählt hat. Sie hat dir so vieles verheimlicht … Du hättest in deinem Leben so viel mehr haben können.«
Ich lehnte mich überrascht auf dem gepolsterten Stuhl zurück. »Ich –« Natürlich fragte ich mich, wie es wohl gewesen wäre, als Teil des Kreises aufzuwachsen. Ich war furchtbar wütend auf sie gewesen, nachdem ich herausgefunden hatte, wie lange Mom mich schon anlog. Aber trotzdem … »Sie hatte ihre Gründe.«
»Da bin ich mir ganz sicher. Tut mir leid, ich wollte nicht neugierig sein.« Lydia lächelte. Es wirkte aufrichtig. Dennoch konnte ich Fragen in ihren Augen leuchten sehen, bei denen ich mir nicht sicher war, dass ich sie beantworten wollte. Ich wechselte das Thema. »Kommt deine Mom auch zum Abendessen?«
Lydia fuhr mit dem Finger über die goldene Gabel neben ihrem Teller. »Meine Mutter muss sich erst noch an den Gedanken gewöhnen, dass es dich gibt. Sie wird nicht mit uns essen.«
Natürlich. Selbst außerhalb des Kreises wäre es nicht besonders angenehm, herauszufinden, dass der eigene Mann ein uneheliches Kind hatte.
Ich deutete auf das vierte Gedeck. »Und dein Bruder –«
Die Hartholztür knarrte. Ich wirbelte herum und sah meinen Vater im Türrahmen stehen.
Meinen Vater.
Es war so eigenartig, das sagen zu können. Ich war ihm erst einmal begegnet, beim Ball, aber er sah exakt so aus wie in meiner Erinnerung. Die Ehrfurcht, die ich empfand, strahlte aus Augen direkt zu mir zurück, die genauso aussahen wie meine, so, als würde ich in einen Spiegel schauen.
Er machte einen Schritt in den Raum und ich erwachte aus meiner Trance. Sollte ich aufstehen? Ich drückte mich halb aus meinem Stuhl hoch, ließ mich jedoch sofort wieder hineinfallen, als ich sah, dass Lydia sich entspannt zurücklehnte. Mein Vater ging um den Tisch herum und ich erhob mich unbeholfen doch wieder. Er war attraktiv, mit dunklen Haaren und dichten Augenbrauen, genau wie meine und Lydias. Für einen Mann war er nicht besonders groß, wahrscheinlich nur fünfzehn Zentimeter größer als ich. Ich hatte den Teint meiner Mom und ihre kleine Nase geerbt, aber es war offensichtlich, dass ich auch viel von den Saxons mitbekommen hatte.
Mein Vater küsste mich auf die Wange. »Avery«, sagte er, und ich musste wieder an die Andenkenkiste unter meinem Bett in Minnesota denken, in der ich alles aufbewahrte, was ich im Laufe der Jahre über meinen Vater herausgefunden hatte. Sosehr ich es mir auch gewünscht und davon geträumt hatte, ich hatte nie wirklich daran geglaubt, dass er eines Tages ein Teil meines Lebens sein würde.
»Ich bin so froh, dass du hier bist«, fügte er hinzu und drückte meine Hände. »Ich wünschte, du wärst schon früher zu uns gekommen, aber es ist schön, dass wir dich jetzt bei uns haben.«
Er ging zum Kopf der Tafel und erst jetzt bemerkte ich Jack. Er musste mit meinem Vater hereingekommen sein. Er stand mit den Händen hinter dem Rücken da und verschmolz praktisch mit der Wand, genau wie die anderen Bediensteten. Er wirkte weder verletzt noch aufgebracht. Vielleicht war ihm ja bereits verziehen worden.
Mein Vater wandte sich an Lydia, als der Butler seinen Stuhl unter dem Tisch hervorzog. »Wo ist Cole?«
Lydia zuckte mit den Schultern, und im selben Moment schlenderte Cole Saxon ins Zimmer, in einem rot-weißen Overall, einem Helm unter dem Arm und verschwitzten Haaren.
Mein Vater presste die Lippen zusammen und wartete darauf, dass Cole seinen Platz einnahm.
Mein Halbbruder war ein Stück größer als mein Vater und durch den Overall wirkte sein schmaler Körper ein wenig breiter. Trotzdem war offensichtlich, dass die ganze Familie eher klein gewachsen war. Cole ließ sich auf den Stuhl neben seiner Schwester fallen und schnappte sich ein Brötchen aus dem noch unangetasteten Brotkorb. In der Schulter des Overalls befand sich ein Riss. Lydia pikte mit dem Finger hinein und zog die Augenbrauen hoch.
»Der Ferrari ist hin«, murmelte Cole mit einem Mundvoll Brot.
Lydia klappte die Kinnlade herunter. »Cole! Der 64er?«
Cole nickte. Er hatte die gleiche olivfarbene Haut und so dunkle Haare wie seine Schwester, aber in seinen violetten Augen lag nichts von Lydias Wärme.
»Es war das einzige Auto, das ich wirklich mochte.« Lydia verschränkte die Arme über der Brust. »Hast du ihn einfach liegen lassen?«
»Er steht neben der Rennstrecke. Irgendjemand wird sich schon darum kümmern.« Er blickte zu Jack, der in der Ecke stand. »Der Hüter ist wieder da. Schick ihn.«
Lydia krallte ihre kleinen Hände in die elfenbeinweiße Tischdecke. »Jack ist nicht für die Autos zuständig, du Idiot.«
»Da er es sich offensichtlich selbst zur Aufgabe gemacht hat, den Leibwächter für unsere Schwester zu spielen, die gar kein Teil unserer Familie sein will, dachte ich, es hätten sich vielleicht auch noch andere Dinge verändert.«
Ich hatte aufgehört, so zu tun, als würde ich ihnen nicht zuhören. Jack zeigte keinerlei Reaktion. Lydia seufzte nur.
»Cole, bitte benimm dich anständig bei Tisch.« Der Stuhl meines Vaters am Kopfende des Tisches war größer als die anderen und sah mit der geschnitzten Rückenlehne aus wie ein kleiner Thron. Er gestikulierte in meine Richtung. »Wir sind hier, um deine Schwester willkommen zu heißen.«
»Halbschwester«, murmelte Cole. Bisher hatte es fast so ausgesehen, als hätte er mich gar nicht bemerkt, aber nun starrte er mich unverhohlen an. »Ich wollte eigentlich in die Stadt fahren, um ihr zusammen mit Lydia alles zu zeigen, aber dann ist mir aufgegangen, dass ich dazu gar keine Lust habe.«
Nervös blickte ich auf meine Hände hinunter, die angespannt die Serviette auf meinem Schoß verdrehten. Eigentlich sollte ich in den USA sein, dachte ich. Wir sollten gerade nach Maine umziehen, wo ich am Ende des Jahres in einer neuen Schule anfangen und wieder einmal die Neue sein würde, die niemand wirklich wollte. In gewisser Weise war das hier auch nichts anderes. Und ehrlich gesagt: Einen Teil von mir störte Coles Feindseligkeit nicht im Geringsten. Wenigstens wusste ich, dass sie echt war. Wenn sie vereinbart hätten, nur so zu tun, als wollten sie nett zu mir sein, bis sie mich für ihre Zwecke benutzen konnten, dann wäre es ihm sicher nicht erlaubt gewesen, sich so aufzuführen. Ich hoffte einfach, dass Lydias und die Freude meines Vaters, mich hierzuhaben, genauso echt war wie Coles Abneigung.
Mein Vater räusperte sich und hob sein Weinglas. »Ein Toast. Avery, du hast von Anfang an zu uns gehört, und nichts freut uns mehr, als dich endlich bei uns zu haben. Willkommen in unserer Familie.«
Ich hob mein Glas Mineralwasser, genau wie Lydia. Selbst Cole griff mürrisch nach seinem Glas, nachdem ihm seine Schwester einen scharfen Blick zugeworfen hatte. »Danke. Ich freue mich auch, hier zu sein«, erwiderte ich aufrichtig.
Als wir alle einen filigranen Salatteller vor uns stehen hatten, rückte mein Vater an die Stuhlkante vor. »Ich nehme an, dass es einen Grund dafür gibt, dass du dich nun doch entschieden hast, zu uns zu kommen?«
Ich holte tief Luft. Jack und ich hatten Lydia bereits einen Teil der Geschichte erzählt, aber mein Vater kannte nur das Nötigste, von dem wir ihm am Telefon berichtet hatten. Ich warf Jack einen Blick zu, der noch immer wie ein vorbildlicher Hüter an der Wand stand und so tat, als würde er unsere Unterhaltung nicht belauschen.
»Wie bereits erwähnt«, begann ich schließlich, »hat der Orden meine Mutter entführt.«
Ich hielt inne, um die Reaktion meines Vaters einzuschätzen, schließlich musste ihm meine Mom irgendwann einmal viel bedeutet haben. Für einen Sekundenbruchteil versuchte ich, ihn mit ihren Augen zu betrachten – den jungen, einflussreichen Mann aus dem Kreis –, und fragte mich zum millionsten Mal, wie ihre Beziehung damals begonnen hatte. Es gab so vieles, worüber ich mit ihr sprechen musste.
Mein Vater nippte an seinem Wein. »Und ich möchte dir noch einmal versichern, wie leid es mir tut, das zu hören. Erzähl weiter.«
»Sie wollen, dass wir … ich«, korrigierte ich mich. Jack gehörte nun nicht mehr dazu. »Sie wollen, dass ich Alexanders Grab finde und den Inhalt gegen meine Mom austausche, damit dem Kreis die Waffe gegen den Orden nicht in die Hände fällt.« Dieser Teil entsprach der Wahrheit. Der nächste Teil hingegen … »Ich will – mit deiner Hilfe – das Grab finden und den Inhalt dazu benutzen, den Orden aufzuhalten«, fuhr ich fort. Das entsprach größtenteils der Wahrheit. Sosehr ich den Orden auch stoppen wollte, die Sicherheit meiner Mom bedeutete mir mehr, und ich würde alles dafür tun, sie wieder in Freiheit zu sehen. Aber das mussten die Saxons ja nicht wissen.
Mein Vater schüttelte seine Serviette auf und breitete sie über seinem Schoß aus. »Und welche Art der Hilfe erwartest du von uns?«
»Als ich noch nicht wusste, wer du bist und wer ich in Wirklichkeit bin, habe ich einige Hinweise gefunden, die Emerson Fitzpatrick hinterlassen hatte, bevor der Orden auch ihn ermordete.« Ich schluckte. Es fiel mir immer noch schwer, es auszusprechen. »Die Hinweise legen nahe, dass Napoleon Alexanders Grab während seines Feldzugs gefunden hat.«
Alle drei Saxons erstarrten. Eine Gabelvoll Salat schwebte auf halbem Weg vor Lydias Mund, und mein Vater stellte den Salzstreuer wieder ab, den er in der Hand hielt.
»Soll das etwa heißen, du weißt bereits, wo sich das Grab befindet?«, fragte Cole und knallte die Ellenbogen auf den Tisch.
Ich schüttelte den Kopf. »Napoleon hat es gefunden und dann wieder versteckt. Was immer sich auch darin befand, er hielt es für gefährlich. Aber er hat seine eigenen Hinweise hinterlassen, denen ich nun folge, diesen hier eingeschlossen.«
Ich schob den Ärmel meiner Strickjacke hoch und schüttelte das Armband von meinem Handgelenk. Ich fuhr mit dem Finger über die eingravierten Buchstaben, während ich erklärte, was es bedeutete und wonach wir suchen mussten. »Ich hatte gehofft, mit denen dir zur Verfügung stehenden Mitteln die Suche nach dem zweiten Armband und dem Passwort fortsetzen zu können«, endete ich schließlich.
Ich reichte das Armband Lydia. Cole betrachtete es über ihre Schulter hinweg, bevor sie es meinem Vater gab.