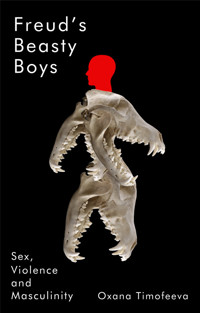Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ra, Tonatiuh, Surya, Sol invictus sind nur einige der Namen jener vielgestaltigen Gottheit, der die Menschen in früheren Zeiten in Ritualen und Gebeten huldigten und die mit dem Aufkommen monotheistischer Religionen schließlich auf die Rolle des sichtbaren Ausdrucks göttlicher Kraft reduziert wurde. Die Sonne selbst büßte indes nichts an Strahlkraft ein: Als Quell allen Lebens, dem immer auch ein destruktives Element zu eigen ist, befeuert sie spätestens seit Platon nicht nur unsere Vorstellung einer besseren Zukunft, sondern steht, wie die russische Philosophin Oxana Timofeeva unter Rückgriff auf Georges Bataille eindrücklich zeigt, für ein dringend benötigtes Gegenmodell zur auf unendliches Wachstum und Akkumulation zielenden, zerstörerischen Kapitalwirtschaft. Denn die Sonne ist reiner Überschuss. Sie verausgabt sich ohne Forderung nach Gegenleistung, ohne je an Grenzen zu stoßen. Eine politische Ökonomie also, die auf dem Prinzip der Sonne gründete, wäre eine des Altruismus und der Solidarität, eine, die sich verschenkt, sich ohne Berechnung verliert – und daher eine im Einklang mit der Natur stehende Möglichkeit jenseits aller bestehenden politischen Kategorien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Solarpolitik
Oxana Timofeeva
Solarpolitik
Ein philosophischer Essay über die Sonne, Natur und Gewalt
Aus dem Englischen vonAnja Dagmar Schloßberger
Inhalt
Einleitung: Zwei Sonnen und eine Stadt
I. Zwei Arten von Gewalt
II. Allgemeine Ökonomie
III. Die beschränkte Gewalt des Kapitals
Schluss: Die Sonne ist unsere Genossin
Anmerkungen
Dank
Einleitung: Zwei Sonnen und eine Stadt
1979, ich war ein Jahr alt, zog meine Familie von Sibirien nach Kasachstan, wo mein Vater Arbeit auf einer der Großbaustellen gefunden hatte. An den Ufern des großen Balchaschsees, in der grauen Steppe, die dort in Wüste übergeht, sollten die Bauleute eine Stadt bauen mit dem Namen Solnetschnyj, was im Russischen so viel bedeutet wie die Sonnige oder die Sonnenstadt. Die Stadt war Teil eines in Planung befindlichen industriellen Bauvorhabens: des südkasachischen Elektrowerks. Die erste Bauphase dieses gigantischen Projekts sah vor, das Land für die Bauarbeiten zu präparieren – genauer gesagt, musste die hügelige Topografie in eine ebene Fläche transformiert werden. Mein Vater war als Sprengmeister angestellt: Er hatte die Aufgabe, die Hügel zu sprengen. Wir waren in sehr einfachen Holzbaracken untergebracht, in einer kleinen Siedlung, die man eigens für die Bauleute errichtet hatte. Versorgung mit Grundnahrungsmitteln oder anderen Gütern gab es keine. Wir ernährten uns vom Fleisch der seltenen Saiga-Antilopen, die mein Vater in der Steppe erlegte, aßen den Fisch und tranken das Wasser aus dem See. Die furchterregendsten Bewohner der Steppe waren skorpiongroße Solifugae, auch Sonnenspinnen genannt: Irrtümlich glaubte man, die Bisse dieser Tiere seien tödlich. Letztendlich wurde die Sonnenstadt niemals fertiggestellt – alle Aufwendungen für dieses ambitionierte Projekt sind also buchstäblich in den Sand gesetzt worden.
Neben den vielen Ortschaften in den unermesslichen Weiten der früheren Sowjetunion und darüber hinaus, die das »Sonnige« im Namen tragen, gibt es noch unzählige ungebaute Sonnenstädte, für die wir immer weiter Felsmassive in die Luft jagen. Sie bezeichnen Utopien: Die mit dem Bild unseres zentralen Himmelskörpers verbundene Idee – es sei möglich, eine Siedlung zu bauen, die bestimmten rationalen Prinzipien entspricht und über solche Infrastrukturen verfügt, die so perfekt wie möglich designt sind, um den menschlichen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden und das Leben der Gemeinschaft in höchstem Maße strahlend und glücklich zu gestalten –, hat historisch eine lange Tradition. Von Platons Politeia bis zur modernen spekulativen Solarpunk-Fiction und den Perspektiven auf ökologisch nachhaltigere Ökonomien, bewerkstelligt durch den Ausbau erneuerbarer Energien, durchdringt der Geist des Solaren die ehrgeizigsten politischen Zukunftsprojekte.
Die überragende Bedeutung der Sonne, was unsere utopischen Fantasien betrifft, beruht auf ihrer Strahlkraft, dieser ultimativen Quelle allen Lebens auf der Erde, die der Grund ist, warum man die Sonne im Altertum vielfach als Demiurg oder als eine der höchsten Gottheiten verehrte: Ra in Ägypten, Tonatiuh in der aztekischen Kultur, Surya im Hinduismus oder Sol invictus im Römischen Reich sind nur einige wenige Namen für diese vielgestaltige Gottheit. Überall gab es zahlreiche Sonnen-Gottheiten beiderlei Genders, die verschiedenen Jahres- und Tageszeiten entsprachen. Genau wie Helios im antiken Griechenland quert der frühslawische Sonnengott in einem goldenen Wagen fahrend den Himmel und trägt bei sich ein strahlend leuchtendes Feuerschild. Sein Name ist Dashbog: der gebende Gott. Er spendet alles: Licht, Wärme und Wohlstand. In einer Version altert und stirbt er jeden Abend, nur um am nächsten Morgen erneut geboren zu werden; in einer anderen stirbt er im Dezember und wird nach der Wintersonnenwende wiedergeboren. Unsere Vorfahren begrüßten ihre Sonnengötter, wenn sie aus der nächtlichen Dunkelheit zurückkehrten. Für sie war der leuchtende Strahlenkranz, den sie am Himmel beobachten konnten, buchstäblich der Körper des Gottes, dessen Strahlen jeden neuen Tag erst möglich machten.
Der verbreiteten Tradition der Sonnenverehrung im Wesentlichen treu bleibend, führt Platon, der Verfasser der mutmaßlich ersten politischen Utopie, einen neuen Gedanken in diese mythische Weltsicht ein. Im vierten Buch der Politeia erklärt Sokrates seinem Gesprächspartner Glaukon, dass es eigentlich zwei Sonnen gebe: die eine, die wir sehen, und die andere, die wir nicht sehen. Die Sonne, die wir sehen, regiere in der Welt der sichtbaren Dinge. Und sie selbst sei ein sichtbares Ding, das sich allerdings von allen anderen sichtbaren Dingen darin unterscheide, dass sie selbst zugleich die Quelle alles Sichtbaren sei. Warum sehen wir die Dinge? Erstens, weil wir Augen haben. Zweitens, weil es Licht gibt. Drittens, weil es die Sonne gibt, die das Licht spendet. Sokrates adressiert die Sonne als die Gottheit »unter den Göttern des Himmels«, deren Gabe des Lichts bewirke, »daß unser Gesicht auf das Schönste sieht und daß das Sichtbare gesehen wird«.1 Gleiches gelte für die geistige Welt: So wie das Sehvermögen die Dialektik der Sonne, des Lichts und der Augen umfasse, vereine das Denkvermögen das höchste Gut, Wahrheit und Erkenntnis. Ja, mehr noch: So wie die physische Sonne den Dingen der sichtbaren Welt »nicht nur das Vermögen gesehen zu werden, sondern auch das Werden und Wachstum und Nahrung« verleiht, so verleiht die geistige Sonne dem »Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden«, sondern vielmehr »Sein und Wesen«.2
Das siebte Buch der Politeia beginnt bekanntlich mit der Urszene der Philosophie, die uns zurückversetzt ins Zeitalter der Höhlenmenschen. Eine Gruppe von Menschen ist in einer Höhle eingeschlossen, die eigenartigerweise einem Lichtspieltheater überaus ähnlich ist. Die Menschen sind gefesselt, daher können sie nur regungslos dasitzen und direkt auf die ihnen gegenüber befindliche Wand blicken, wo sie die Schatten dessen sehen, was sich über ihnen und hinter ihrem Rücken abspielt. In der Höhle gibt es ein Feuer und draußen ist gleich eine Straße, auf der sich einige andere Menschen befinden, die menschliche Figuren, Tiere und andere Dinge bei sich haben. Sokrates stellt die These auf, dass wir selbst die Menschen in der Höhle sind, welche die Schatten für reale Dinge halten. Wer es schafft, sich selbst aus den Fesseln zu befreien und die Höhle zu verlassen, wird die wahre Sonne »als sie selbst an ihrer eigenen Stelle« sehen,3 und ebenso die wahre Welt, von ihrem Licht angestrahlt. Wenn diese Person dann wieder in die Höhle zurückkehrt und zu beschreiben versucht, was sie draußen gesehen hat, werden ihr die übrigen Gefangenen, an die Finsternis ihrer Behausung gewöhnt, nicht glauben und vielleicht sogar versuchen, sie zu töten. Als prophezeite er seinen eigenen Tod in einem Athener Gefängnis, ermuntert uns Sokrates, die erste, die sichtbare Welt, mit der Höhle zu vergleichen, das Licht der physischen Sonne mit dem Feuer, dessen Schattenbilder wir auf der Höhlenleinwand sehen, und die zweite Welt draußen mit der geistigen Sphäre des höchsten Gutes, das die Seele entdeckt hat.4
Abgesehen von der Dialektik zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Sonne hat Platon in diesen Passagen noch eine weitere Neuheit eingeführt, die für mich von herausragender Bedeutung ist. Für Sokrates ist die Sonne nämlich kein verehrungswürdiges Ding irgendwo da draußen am Himmel. Anstatt sie als ein äußerliches Ding zu behandeln, legt er nahe, dass es im Menschen selbst solare Elemente gebe – wie etwa das Auge und das Sehvermögen für die physisch existierende Sonne, das Erkennen und die Vernunft für die geistige. Das menschliche Auge ist nicht mit der Sonne identisch, aber es ähnelt ihr. Wir können das Ding Sonne betrachten und ansehen, weil wir ihr in bestimmten Punkten verwandt sind. Sonne und Auge kommunizieren, als würden sie durch die Schichten der Dinge hindurch, die von Licht umgeben sind, ineinander sehen und einander reflektieren. Die dunkle Pupille im Zentrum des menschlichen Auges ist von einer farbigen Iris umgeben. Wenn wir versuchen, tagsüber die Sonne zu betrachten, sehen wir, dass auch sie eine Art Pupille hat, die dunkel ist, sowie eine strahlende »Iris«, die von hinten hervorleuchtet. Genau wie das menschliche Auge hat das Auge Gottes deshalb eine Art blinden Fleck in seinem unmittelbaren Zentrum. Es ist, als sei die sinnlich wahrnehmbare Sonne jene dunkle Pupille, welche die göttliche Strahlung von der Iris der Wahrheit vor uns verdunkelt.
Die Dopplung der Sonne in Platons Politeia hat es in sich: Da steht geschrieben, dass wir die wahre Sonne, welche das höchste Gut ist, nicht sehen können, weil sie qua ihrer Repräsentantin in der sinnlich wahrnehmbaren Welt von uns abgeschirmt ist. Insofern stattet die Sonne, die wir sehen, uns nicht nur mit dem Sehvermögen aus, sie ist es auch, die uns blendet. Die Größe des Sokrates besteht darin, hinter der sichtbaren die unsichtbare Sonne zu erkennen und beiden Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Wie Marsilio Ficino in seinem Buch De Sole (»Über die Sonne«, 1494) ausführt:
Während Sokrates beim Heer war, pflegte er häufig, wie verzaubert die aufgehende Sonne zu betrachten, reglos, seine Augen starr wie bei einer Statue, um die Wiederkehr des himmlischen Körpers zu begrüßen. Die Platoniker, beeinflusst von diesen und ähnlichen Zeichen, würden vielleicht sagen, dass Sokrates, der von Kindheit an von einem phöbischen Dämon beseelt war, es gewohnt gewesen sei, die Sonne mehr als alles andere zu verehren, und aus ebendiesem Grund sei er vom Orakel des Apollon zum weisesten aller Griechen erkoren worden. Ich möchte hier nicht auf die Frage darüber eingehen, ob der Dämon von Sokrates zu Teilen ein Genie oder ein Engel gewesen sei – aber selbstverständlich würde ich wagen zu behaupten, dass Sokrates im Stadium der Ekstase nicht nur die sichtbare Sonne, sondern auch den anderen, versteckten Aspekt verehrt hat.5
In Ficinos Interpretation ist die Sonne, die Sokrates verehrt, nicht nur verzweifacht, sondern verdreifacht: Sie verkörpert, auf fantastische Weise mit Neuplatonismus, hermetischer Tradition, Astrologie und der Magie der Renaissance verwoben, die Idee der christlichen Trinität. Ausgehend von Platons Vergleich von Gott und Sonne, zieht Ficino weitere Parallelen: Auf einer abwärtsgerichteten Spirale spendet Gott Güte und Liebe, genau wie die Sonne Licht und Wärme spendet. Das Entscheidende hierbei ist, dass all diese Dinge als verschiedene Arten von Energie verstanden werden können, die von beiden, Gott und der physischen Sonne, großzügig über die ganze Welt verteilt werden. Ficino besteht auf die hierarchische Beziehung zwischen Gott und physischer Sonne: Man solle nicht die Sonne als den Schöpfer aller Dinge verehren, schließlich sei sie nur der Schatten Gottes, des eigentlichen Kreators. Ja, die Sonne strahle hell, aber das Licht, das sie ausschicke, sei, laut Ficino, nicht gänzlich ihr eigenes. Das Sonnenlicht als solches ist infolge seiner Grundeinstellungen verdunkelt, genau wie die anderen Himmelskörper, die ihr eigenes natürliches Licht ausstrahlen, das weniger hell ist. Der übermäßige, von der Sonne ausstrahlende Glanz stellt, Ficino zufolge, eine Gabe dar, welche die Sonne von Gott verliehen bekommen hat: »In der Tat bietet die Sonne jenes angeborene Licht, welches in gewisser Weise verdunkelt ist, und plötzlich ein anderes, höchst evidentes Licht für die Augen, wie ein sichtbares Bild göttlicher Intelligenz und endloser Güte.«6
Die Tendenz, die zwei Sonnen als Gott und sein materielles Substitut zu porträtieren, entwickelt ein anderer Renaissance-Denker weiter – der vielleicht berühmteste Schriftsteller der solarutopischen Tradition, Tommaso Campanella, der in Die Sonnenstadt (1602) die Religion und die Riten der Bewohner eines idealen Staats beschreibt:
Sie verehren die Sonne und die Gestirne wie lebendige Wesen, wie Bildnisse Gottes und Tempel des Himmels, aber sie beten sie nicht an. Am meisten Ehre erweisen sie der Sonne. Kein anderes Wesen als Gott beten sie an, ihm aber dienen sie nur unter dem Zeichen der Sonne, das eben Zeichen und Antlitz Gottes ist, aus dem das Licht herrührt, die Wärme und jedes andere Ding. Darum ist der Altar auch wie eine Sonne geformt, und die Priester beten zu Gott in der Sonne und den Gestirnen, auch rufen sie die guten Engel als Fürsprecher an, die in den Sternen wohnen, ihren lebendigen Heimstätten, denn Gott offenbarte seine Herrlichkeiten vor allem im Himmel und mit der Sonne, seinem Denkmal und Bildnis.7
Am Ende des Buches geht Campanella so weit zu behaupten, die sinnlich wahrnehmbare Sonne, deren Licht Ficino »verdunkelt« nannte, sei nicht eigentlich gut wie Gott, sondern »übelwollend«, da »die Sonne […] danach [trachte], die Erde zu verzehren«,8 wohingegen »Gott […] sich ihrer [der Erde und der Sonne] zu diesem Ziel [bediene].«9 Dies impliziert, dass die ultrarationale Organisation der Stadt (die wir heute als Überregulierung und totale Kontrolle lesen) eher der Brutalität und der Explosivität der Sonne geschuldet ist, statt von ihrer Güte inspiriert zu sein.
Lassen Sie mich nun einen großen Sprung machen: In Nick Lands Buch The Thirst for Annihilation, in dem er sich mit Georges Bataille befasst, sind die zwei Sonnen nicht sichtbar oder unsichtbar beziehungsweise sinnlich oder geistig wahrnehmbar, sondern einfach schwarz und weiß:
Eine weiße Sonne ist aus Lichtflecken geronnen, die ephemer am Rand des blinden Flecks schweben. Dies ist die illuminierende Sonne, sie gibt, was wir aufnehmen können, die Sonne, deren Strahlen der Körper als Nahrung und das Auge als (assimilierbare) Sinnesempfindung aufnimmt. Platons Sonne ist dieser Art; eine destillierte Sonne, eine Sonne, welche die wahre Essenz der Reinheit ist, die Metapher für Schönheit, Wahrheit und das Gute. Während der kalten Monate, wenn die Natur dahinzuwelken und sich zu erholen scheint, wartet man auf die Rückkehr dieser Sonne in ihrer vollen Strahlkraft. Die Fülle des Herbstes scheint ihr zu huldigen, so wie es die Alten taten.10
Vor diesem Traditionshintergrund verweist der Autor auf eine andere Sonne, »eine, die tiefer ist, dunkel und infektiös«.11 Folgt man Land, so beachtet Platons Hauptfigur, Sokrates, nicht den verfemten, zerstörerischen Aspekt der schwarzen Sonne. Zentrale Bedeutung verlieh diesem Aspekt Bataille, der in den 1930er-Jahren eine eigene Theorie über die zwei Sonnen skizzierte. In seinem kurzen Essay »Verdorbene Sonne« unterscheidet er zwischen der sublimen Sonne des Geistes einerseits und der »verdorbenen« Sonne des Wahnsinns und der unerhörten Gewalt andererseits. Die erste Sonne, »sofern sie mit dem Begriff des Mittags verschmilzt«,12 existiert »nach menschlichem Verständnis«13 als abstraktes Ding, während die zweite auf die blutigen Kulte des Altertums und Opferrituale verweist. Bataille ruft den Mythos von Ikarus in Erinnerung, der »die Sonne klar in zwei [teilte], jene, die schien, als Ikarus sich vom Boden erhob, und jene, die das Wachs zum Schmelzen brachte und dadurch das Abfallen und den schreienden Sturz verursachte, als Ikarus ihr zu nahe kam«.14
Beachtenswert ist, dass es in der Zeit, die zwischen den zwei Sonnen Platons, Ficinos sowie Campanellas einerseits und Batailles andererseits liegt, eine lange Tradition der Verehrung der schwarzen Sonne in alchemistischen und okkulten Lehren gegeben hat. Ich wage zu behaupten, dass diese Tradition nicht so weit von Platons solarer Metaphysik entfernt ist, welche Land übergeht, sondern sich sogar historisch daraus ableitet: über den Neuplatonismus, Gnostizismus, Hermetismus und andere esoterische Einflüsse aus der Antike, der Renaissancekultur und Romantik. Bataille übernimmt das Symbol der schwarzen Sonne aus der christlichen Mystik, bevor Neonazismus, Neopaganismus und andere zeitgenössische esoterische Bewegungen es sich angeeignet haben.15 Während Nick Lands Interpretation erst viel späteren Datums ist und seine eigene Philosophie einer Dunklen Aufklärung als Teil dieser noch nicht lange zurückliegenden Entwicklungen interpretiert werden kann, ist die Tendenz, Bataille als in schwarz gekleidetes Orakel der Reaktion darzustellen, schlichtweg falsch und muss einer anderen Sichtweise des Platonismus gegenübergestellt werden, die nicht übereinstimmt mit Lands verzerrtem Bild, ausschließlich die »destillierte« weiße Sonne anzubeten.
Nun, da das moderne Bedürfnis, gegen die alten philosophischen Autoritäten zu rebellieren, und die allergische Reaktion auf hierarchisierende Kategorien – wie dem höchsten Gut – vom Tisch sind, mache ich den Vorschlag, uns auf den dialektischen Aspekt von Platons Denken zu konzentrieren, der möglicherweise gar nicht so weit entfernt ist von der dunklen Seite der Sonne, die Bataille aufruft. Man denke an eine Zeile von La Rochefoucauld: »Weder die Sonne noch der Tod können sich unverwandt ansehen«. Diesen Vers zitiert Bataille in »Meine Mutter«, worin er ebenfalls konstatiert, »[d]er Tod war in meinen Augen nicht weniger göttlich als die Sonne«.16