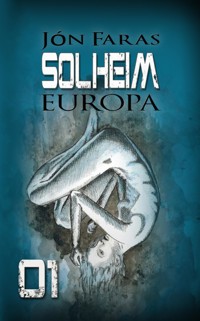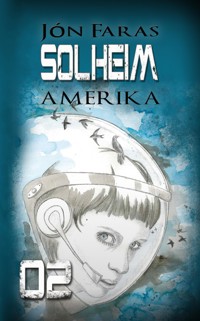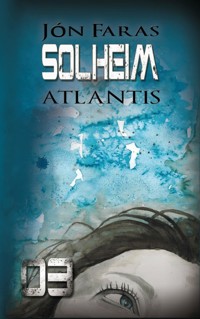
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Solheim
- Sprache: Deutsch
Es ist das Atlantisportal, von dem sich Ninive, Isaak und ihre Mitstreiter Antworten auf die vielen Fragen erhoffen, die sie im Gepäck haben, als sie auf den Spuren Aarick Zervetts aus Fleet City aufbrechen. Was genau plant Zervett? Wer oder was ist Chou? Wer sind die „Sternfahrer“, die das Atlantisportal errichten ließen und damit die Welt in Unordnung brachten?
Und währenddessen stürzt Fleet City immer weiter ins Chaos und macht den dort verbliebenen Gefährten um Lilian und Seamus das Leben nicht leichter. Die Bedrohung aus den Korridoren scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein, und dann ist da auch noch die Loge, Lilians Vater, die Guardians und der Schwarze Turm …
Der dritte Teil der Geschichte um Ninive Solheim und ihre Gefährten führt sie näher an die Wahrheit hinter dem Sangre und den Korridoren. Dabei führt sie diese Suche tief in die Korridore, in vergessen geglaubte Regionen der Erde und bis ans Ende unseres Sonnensystems. Dabei scheint es Ninive so, als wäre die Antwort auf die wichtigste Frage von allen nicht in der unbekannten Ferne sondern in ihr selbst zu finden: Was ist das Ziel ihrer Reise? Und warum?
Die Solheim-Reihe
01 EUROPA - erschienen 2013
02 AMERIKA - erschienen 2014
03 ATLANTIS - erschienen 2016
04 ANDROMEDA - in Arbeit (Stand: Oktober 2020)
05 EDEN - geplant
Kurzroman "Solheim Noir" - erschienen 2014
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
SOLHEIM
03 | ATLANTIS
von Jón Faras
Eine Dystopie
© 2016 Jón Faras
Alle Rechte vorbehalten.
www.facebook.com/jonfaras
Coverdesign: Vivian Tan Ai Hua
www.facebook.com/aihua.art
gewidmet
La Grande Racine
01 | KERKER
Die Kraft ließ nach. Das sichere Gefühl, dass es zum letzten Mal geschehen würde, gab Lilian einen Moment der inneren Ruhe. Sie gehörte nicht zu den Menschen, die sich Illusionen über ein Leben nach dem Tod machten. Doch das Gefühl der ewigen Stille, der Auflösung ins Nichts und der Niederlegung aller irdischen Zwänge war der einzige Lichtblick, der ihr noch blieb. Es war nicht so, als wäre sie nicht noch immer kämpferisch. Der rebellische Geist versiegte nie und sie würde nicht nachgeben, möge kommen, was wolle.
Eigentlich, dachte sie, konnte sie sich doch glücklich schätzen, dass der Foltermeister der Guardians ein einfallsloser Idiot war. Brutal und irrational, doch nicht mit der nötigen Fantasie, die es brauchte, wenn man Informationen aus jemandem herausholen musste. Dennoch würde diese Folter mit ihrem Tod enden. Auf einen anderen Ausgang zu hoffen war unsinnig.
Und so war es ein Gefühl von Triumph und Beklemmung gleichermaßen, als sich die Tür zu dem verdunkelten Raum öffnete und Lilian ihren grobschlächtigen Peiniger sah, der eine schwere Eisenstange in der Hand hielt. Brutal. Endgültig. Aber wenn er glaubte, das alleine würde ausreichen, um sie doch noch zum Reden zu bringen, dann war er noch dümmer als er aussah.
Ihr Stolz meldete sich tief aus ihrem Inneren. Es war ohnehin bereits ein Punkt überschritten worden, an dem sie sich nicht mehr sicher war, ob sie überleben und die Erinnerungen an die ihr widerfahrenen Misshandlungen mit sich tragen wollte. Als Märtyrer sterben erschien ihr dagegen fast erstrebenswert.
Als die Guardians sie in ihrem Appartement in der Pyramide erwischt hatten, waren ihr die Augen verbunden worden und sie war in diesem Raum gelandet ohne sagen zu können, wo sich dieser befand. Sie hatten Lilian auf eine Liege gefesselt und ihr die Haare abrasiert, sie alle paar Minuten mit harten Stockschlägen traktiert und mit einem Messer ihre Fußsohlen aufgeschnitten.
Die ersten Stunden waren dabei die schlimmsten gewesen, denn sie hatten Grenzen überschritten, die Lilian nie zuvor passiert hatte. Sie hatte noch geschrien, als sie mit den Handgelenken an die Decke gehängt wurde und man ihr die Kleider vom Leib riss, mehrere Eimer Eiswasser über ihr auskippte und sie schließlich für Stunden dort hängen ließ.
Dabei war es weniger die Zuspitzung gewesen, die Lilian schockierte, als vielmehr der Umstand, dass sie sich bis zu diesem Zeitpunkt nie richtig vor Augen geführt hatte, in was sich diese Stadt verwandelte. Seit dem Verschwinden Zervetts, den Kämpfen mit den Visaren in der Oper und der Abreise der meisten ihrer Gefährten nach Atlantis war Fleet City zu einer Stadt des Wahnsinns geworden. Das Sangre strömte nun offenbar massiv in ihre Welt und verstärkte den Einfluss auf die Menschen.
Aus den Plänen, eine starke Allianz gegen die eindringenden Visaren aufzubauen, war nichts geworden. Stattdessen kämpften jetzt die Loge, die Guardians und der Schwarze Turm für ihre eigenen zweifelhaften Interessen, und in ihrem Windschatten folgten kriminelle Banden, Splittergruppen ehemaliger privater Sicherheitsdienste und Bürgerwehren, die an einigen Orten der Stadt die Disctrict Police unterstützten. Die Visaren waren bislang noch nicht aus der Oper vorgedrungen, doch jeder Versuch, das Gebäude zu übernehmen, war gescheitert.
Und dann war da das, was das Sangre mit dem Individuum anstellte. Noch vor einem halben Jahr war Lilians größte Sorge, dass der triebhafte Sangre-Rausch sie im falschen Moment dazu brachte Sex mit Freunden und Fremden zu haben, und unschöne Komplikationen nach sich zu ziehen. Doch auch wenn solche Situationen wild und schwer zügelbar waren – sie wusste es von einer Nacht mit Sayuri aus eigener Erfahrung – sie bewegten sich noch nicht im Bereich von Brutalität und Grausamkeit. Doch jetzt fühlte sich Fleet City an wie eine einzige Perversion.
Auch die Feinde und Verbündeten hatten sich verschoben. Jeremy Cassidy und der Schwarze Turm waren die einzigen echten Aliierten, die Lilian und ihrem Team noch blieben. Und Lilian war alles andere als glücklich über diese Liaison. Doch Loge und Guardians arbeiteten gegen sie, dabei waren die eigentlichen Feinde die Visaren in der Oper, die Wolfen und Ossfhang, die unter dem Floß durch die Kolonien marodierten, und schließlich die Quetzals, die sich der Stadt noch nie weiter als ein paar Kilometer genähert hatten, aber jede Form von Flügen zum Erdboden war nicht mehr sicher.
Der Foltermeister näherte sich und wollte nach Lilians Kinn greifen. Doch Lilian kannte diese Behandlung mittlerweile, zog den Kopf weg und schnappte mit den Zähnen nach der Hand des Mannes. Dieser stieß ihr seine Faust so heftig in den Bauch, dass ihr die Luft wegblieb. Noch bevor sie wieder atmen konnte, griff der Mann nach ihrer linken Brust und drückte hart zu. Sie schrie entsetzt auf.
„Joseph wird ungeduldig”, teilte ihr der Foltermeister mit. „Er will Antworten!”
„Jo soll sich ins Knie ficken!”, entgegnete Lilian, „sag ihm das!” Sie ignorierte den Schmerz in ihrer Brust, holte aus und rammte ihren Kopf in sein Gesicht. Sie konnte spüren, wie seine Nase brach. Als sie aufsah, war sein Gesicht blutüberströmt. Er wankte und machte einen Schritt zurück.
Die Stadt trägt eine hässliche Maske, dachte Lilian, als der Foltermeister sich von ihr wegdrehte. Oder vielleicht ist es doch eher die Maske, die sie abgenommen hat, um ihr hässliches Gesicht zu zeigen. Dass die Loge nach dem Abgang von Zervett nicht von ihren kriminellen Machenschaften ablassen würde, war Lilian klar gewesen. Seth Warren war wieder in der Stadt und hatte Gerüchten zufolge die Leitung der Loge übernommen.
Doch was sie wirklich verstört hatte, war der Zerfall des Black Phoenix. Jo Martin und seine Guardians hatten das Oberkommando übernommen und die meisten Teams, die eigentlich unabhängig voneinander funktionieren sollten, unter ihre Führung gezwungen. Die Pyramide war nun ganz in der Hand der Guardians – vielleicht abgesehen von den unteren Ebenen, in denen sich einzelne Gruppierungen eingenistet hatten, allen voran die Bastet, eine Art Sekte, die die freie Entfaltung des Sangres predigte. Aber auch die versprengten Gruppen des Black Phoenix, die sich den Guardians widersetzten, waren in den hinteren Winkeln der unteren Pyramide zu finden.
Dies alles hatte nur wenige Wochen gedauert. Es war so, als hätte die erneute Visarenaktivität in der Oper und das Verschwinden Zervetts den Startschuss für den Verfall von Ordnung und Vernunft in der Stadt gegeben. Lilian fand es erschreckend, wie schnell die Welt aus den Fugen geraten konnte.
Dass sie in Gefangenschaft der Guardians geraten war, hatte Lilian anfangs geärgert. Es waren nicht so sehr die Schmerzen oder die Erdniedrigungen, die sie durch ihre Peiniger hinnehmen musste. Diese hatten bereits in den ersten Stunden ihrer Gefangenschaft ihr Pulver verschossen. Einen klaren Gedanken fand Lilian erst danach wieder, als ihr klar wurde, dass sie es bereits hinter sich hatte. Vielleicht nicht die Qualen, wohl aber das Leben. Und das ließ sie Schmerzen hinnehmen. Sie musste sich keine Gedanken darüber machen, welche Narben auf Körper und Seele zurückblieben, wenn die Gewissheit bereits da war, dass ihr Leben hier in diesem Raum enden würde.
Verärgert war sie darüber, dass ihre Mission gescheitert war. Isaak hatte auf sie vertraut, als er ihr Fleet City überließ und mit seiner Crew nach Atlantis aufbrach. Ihr Tod würde ebenso eine Enttäuschung für ihn sein wie der verlorene Kampf gegen ihre Feinde. Sie konnte nur hoffen, dass er und Ninive hinter dem Atlantis-Portal eine bessere Welt erreichen würden.
Fuck!, dachte sie, als ihr bewusst wurde, dass diese Gedanken ihr letztlich doch die Tränen in die Augen trieben. Sie war neidisch. Neidisch auf die Dinge, die ihre Gefährten noch erleben, die Welten, die sie noch sehen, und die Momente, die sie zusammen haben würden. Während sie nicht mehr da wäre. Nur noch ihre leere Hülle. Sie musste an Fox‘ toten Körper denken, den die Visaren auf die Spitze der großen Kuppel der Oper genagelt hatten, für die ganze Stadt sichtbar. Lilian hatte sich gezwungen, hinzusehen. Sie wollte die Wahrheit kennen, auf die sie sich einließ. Sie wollte wissen, was passieren würde, wenn man nicht vorsichtig genug war. Ein Mahnmal. Vielleicht auf eine verquere Art auch eine Hoffnung. Es hatte alles nichts genützt.
Der Foltermeister drehte sich nun wieder zu ihr. Er hatte die Eisenstange in der Hand. Lilian straffte sich innerlich und beobachtete, wie er ausholte. Gleich ist es vorbei, dachte sie, gleich sind alle diese Gedanken weg.
Doch so einfach sollte es nicht für sie werden. Die Eisenstange traf mit voller Wucht ihre linke Hand. Lilian schrie auf, als sie spürte, wie die feinen Knochen brachen. Sie biss die Zähne zusammen, um nicht ohnmächtig zu werden. Sie hatte sich in den letzten Stunden öfter gefragt, warum sie das tat. Sie hatte sich mit dem bevorstehenden Tod abgefunden, warum kämpfte sie dennoch gegen die Ohnmacht an, die ihr den Schmerz nehmen würde?
Krachend traf die Stange ihre rechte Hand. Der Foltermeister holte wieder aus, bevor Lilian es richtig registrierte. Offenbar war er nun endgültig in seinen eigenen Sangrerausch verfallen. Die Stange zertrümmerte ihre Füße, bevor der Mann mit ihren Beinen weitermachte. Lilian hielt sich vor Schmerz schreiend noch immer bei Bewusstsein. Irgendwo tief in ihrem Unterbewusstsein flüsterte eine Stimme, dass jeder weitere Knochenbruch die Chance auf vollständige Heilung verringern würde.
Und dann war der Rausch des Mannes vorbei. Lilian hing noch immer an ihren Fesseln von der Decke. Sie wollte versuchsweise ihre Gliedmaßen bewegen, doch außer aufflammendem Schmerz rührte sich nichts mehr. Die Arme hatte der Mann verschont, damit sie sich noch immer in ihren Fesseln halten konnte.
„Deine letzte Gelegenheit”, knurrte der Foltermeister, doch Lilian sah ihm an, dass er selbst nicht mehr damit rechnete, dass sie in diesem Leben noch irgendeinen Laut von sich geben konnte. Lilian wollte ihm ins Gesicht spucken, doch ihr Mund und ihre Kehle waren trocken. Fieberhaft raste ein Gedanke durch ihren Kopf: Der letzte Moment deines Lebens, Lilian, das letzte, was du auf dieser Welt tun wirst.
Doch es gab nichts mehr. Keine Gegenwehr, kein Schrei, keine Tränen und kein Wort. Einzig der Gedanke daran, dass sie ihren Teil dazu beigetragen hatte, dass die anderen ihre Mission vielleicht noch erfüllen konnten. Ein schwacher Trost.
Der Foltermeister trat einen Schritt zurück und hob die Stange über den Kopf. Er holte aus und ließ sie auf Lilian hinunterrauschen. Lilian warf instinktiv mit letzter Kraft ihren Kopf zurück, dann schlug die Stange auf ihrem Brustbein ein.
Der Tod kam wie ein blauer Blitz, der aus ihrem Brustkorb brach. Verdammt, dachte Lilian, selbst beim Sterben hat das fucking Sangre seine Finger mit im Spiel!
Ihr blieb der Atem weg.
Moment mal!, drängte sich ein weiterer Gedanke nach vorne, einem Toten kann doch der Atem nicht mehr wegbleiben!
Lilian ächzte, als sie ihren Kopf, der im Nacken lag, wieder hob. Ein großer, länglicher, dunkler Fleck prangte zwischen ihren Brüsten, doch Lunge und Herz hinter ihren Rippen schienen noch zu arbeiten.
Sie sah vor sich. Der Foltermeister lag tot zu ihren Füßen. Die schwere Eisenstange war von Lilian Torso abgeprallt und hatte mit voller Wucht seinen Schädel gespalten und war erst in seiner Körpermitte stecken geblieben. LIlian wurde bei diesem Anblick schlecht, und es war dieses Gefühl, das ihr sagte, dass sie doch noch einen Funken Hoffnung auf dieses Leben haben durfte.
Hinter ihr waren Schritte, sofern das immer lauter rauschende Blut in ihren Ohren diesen Eindruck nicht verfälschte. Kalte Finger legten sich auf ihre Haut, strichen über ihre Schultern und ihren Rücken. Die Hand war behutsam, vorsichtig – eine Art von Berührung, die sie nicht mehr kannte. Jemand rief ihren Namen und strich ihr über die rasierten Haarstoppeln an ihrem Hinterkopf.
„Lilian!”
Sie konnte nicht antworten.
„Lilian!”
Sie kannte die Stimme. Und es war eine gute Stimme. Eine Stimme, die Leben versprach. Inmitten dieses Infernos. Lilian fühlte die Ohnmacht. Und jetzt kämpfte sie nicht mehr. Sie ließ sich fallen. Das letzte, was sie wahrnahm, bevor sie in einen langen Schlaf fiel, war das Gesicht. Sasha.
02 | AUF SEE
Das Meer war aufgewühlt. Und dasselbe konnte man auch über Isaaks Gedanken sagen. Es waren Wochen vergangen, seitdem das Schiff vom Außenposten des Black Phoenix in den Vorbergen unweit Fleet Citys gestartet war und Kurs auf die Atlantis-Station genommen hatte. Die ersten Tage versprachen noch ein schnelles Erreichen der Station, die sich nach den Koordinaten, für die sie in der Oper Fleet Citys schwer gegen die Visaren hatten kämpfen müssen, mitten im südlichen Atlantik befand.
Das Wetter war bereits bei ihrem Aufbruch stürmisch gewesen, doch das war nichts Ungewöhnliches für die Wintermonate. Dann aber waren die Quetzals am Himmel erschienen. Die gefiederten Drachen, gegen die sie bereits einmal auf ihrem Weg in die Karibik gekämpft hatten, waren keine Gegner, mit denen sie sich anlegen wollten. Schon gar nicht in der Anzahl, die jetzt regelmäßig am Himmel zu sehen war.
Zu ihrem Glück schien die lindwurmartigen Ungetüme aber nicht zu interessieren, was weiter unten geschah. Und so steuerte Isaak das Schiff in den Tiefflug und hielt es dort. Sie hatten die Geschwindigkeit deutlich verringern müssen, doch die Quetzals ließen sie in Ruhe. Und als sie schließlich das offene Meer erreicht hatten, glitt das Schiff unterhalb der 50-Höhenmeter-Marke über die Wellen.
Isaak hatte den Pilotensitz an Sequana übergeben und sich auf den Weg in seine Koje gemacht. Doch er wusste bereits, bevor er seine Kabine betreten hatte, dass er nicht würde schlafen können. Also wechselte er den engen Jumpsuit gegen eine bequeme Hose und einen löchrigen Strickpullover und ging aufs Observationsdeck. Der Raum unter der Kuppel aus Panzerglas war sein Lieblingsort an Bord. Einige gepolsterte Liegen standen dort, von denen er den Himmel und den Horizont beobachten und gleichzeitg ein Heads-up-Display aufrufen konnte, das ihm neben den Parametern des Navigationscomputers auch seine persönlichen Daten und Notizen zeigte.
Isaak schob die Reiseinformationen mit einer Geste zur Seite und rief seinen Datenpool auf. Die Themen, die sich das Display direkt von seinem Comdevice zog, erschienen willkürlich vor seinen Augen, ordneten sich dann aber in eine Struktur, die seinem Arbeitsverhalten entsprach. Eine Notiz war dabei nahezu mit jeder anderen verbunden: das Wort „Starla”.
Starla war … etwas. Oder jemand. Und es war in ihm. Und über das Klonprojekt trug es auch noch ein Klon in sich. Charles Bruchot, der das Projekt in Paris lange geleitet hatte, und durch oft auch zweifelhafte Geschäftsverbindungen viele Details kannte, hatte Ninive im Verdacht. Doch auch wenn jeder, mit dem Isaak darüber gesprochen hatte, Bruchots Meinung als wahrscheinlich ansah, es blieb eine Vermutung.
Isaak hatte gemische Gefühle, was diese Theorie betraf. Einerseits sprach einiges dafür. Er hatte Nina, seine Freundin in der Zeit vor seinem Kälteschlaf vor über einhundert Jahren, anfangs in Ninive wiedererkannt. Die besonderen Fähigkeiten, die Ninive allen anderen Klonen – selbst Sequana – voraus hatte, deuteten ebenfalls auf die Existenz eines …
Ja, was denn eigentlich? Die „Essenz Starlas”. So hatten es die Gesandten von Jor genannt. Isaak vermutete, dass es sich dabei um etwas Ähnliches wie das Sangre handelte. Eine besondere Energie vielleicht. Vielleicht auch eine besondere Eigenschaft des Sangres? Doch bei dem Wenigen, was sie über die Sangre-Energie wussten, war es sinnlos, sich Gedanken darüber zu machen, was die Essenz Starlas eigentlich sein sollte. Für den Moment reichte es völlig zu wissen, dass diese existierte. Und dass sie nicht die einzigen waren, die ein Interesse an dieser Essenz hatten.
Isaak sah auf, als sich die Luke zum Observationsdeck öffnete. Sayuris Kopf erschien, und kurz darauf schlüpfte sie ganz in den Raum. Die dunkelhaarige Frau mit den asiatischen Gesichtzügen steckte in einem locker sitzenden Schlafjumpsuit aus hellbraunem Stoff. Zuammen mit ihrem runden Gesicht und den dunklen Augen sah sie aus wie ein hübscher Teddybär.
„Du schläfst schon wieder nicht?”, fragte sie zur Begrüßung.
„Deine Nacht war auch nicht besonders lang”, entgegnete Isaak und zog mit dem Fuß eine zweite Liege neben seine.
„Bist du schon wieder auf Spurensuche?” Sayuri setzte sich auf den Rand der Liege, zog den Reißverschluss des Jumpsuits bis zur Hüfte auf und streckte seufzend ihren Oberkörper, der in enger, schwarzer Funktionswäsche steckte.
„Rasmus hat ein Update geschickt”, entgegnete Isaak und hob die Hand, als Sayuri augenblicklich hellwach von ihrer Liege rutschte und sich auf seine setzte, um einen Blick auf seine Daten zu werfen.
„Zeig her!”, sagte sie und boxte ihn in die Seite.
„Nichts bahnbrechendes, leider”, entgegnete Isaak und rutschte ein Stück zur Seite.
„Dann grübelst du immer noch wegen Starla?”, fragte Sayuri interessiert.
„Es lässt mich einfach nicht schlafen”, sagte Isaak und warf Sayuri einen schnellen Seitenblick zu.
Eigentlich war das nur die halbe Wahrheit. Es gab noch etwas anderes, das ihn deutlich mehr beschäftigte. Als sein Comdevice registrierte, dass Sayuri sich seiner Position näherte, war auf dem Display eine Notiz verschwunden, die in Isaaks Device mit der höchsten Beschäftigungszeit in den letzten Wochen versehen war. „Wer besuchte Ninive?”, hatte dort gestanden. Und genau das war auch die Frage, die sich Isaak immer wieder stellte.
Als sie aus Fleet City aufgebrochen waren und mit dem ganzen Team den Außenposten angesteuert hatten, von dem ein Teil von ihnen kurz darauf Richtung Atlantis aufbrechen sollte, hatte Ninive die meiste Zeit des Weges in einer verdunkelten Kabine verbracht. Nach der Schlacht an der Oper gegen die Visaren waren ihre Augen und Sehnerven so sehr überreizt, dass sie tagelang brauchte, bis sie die Augen bei Licht wieder schmerzfrei öffnen konnte. Und dort in dieser verdunkelten Kabine war jemand zu ihr gekommen, hatte das Licht hochgedreht, sodass sie ihren Besucher nicht sehen konnte, und mit einem Stimmverzerrer zu ihr gesprochen.
Ninive hatte das nur Isaak anvertraut, und das aus gutem Grund. Es waren nur Mitglieder ihrer Gruppe an Bord. Nur diese kamen infrage, wenn es darum ging, den geheimnisvollen Besucher ausfindig zu machen. Zudem wollte Isaak nicht, dass der Gedanke, unter ihnen könnte ein Verräter sein, die Runde machte. Zumal er zugeben musste, dass der geheimnisvolle Besucher keine schlechten Absichten zu haben schien. Die Person hatte Ninive eine Art metallischen Talisman in die Hand gedrückt, als „Entschuldigung”, wie sie sagte. Sie solle diesen immer sichtbar bei sich tragen, sobald sie Atlantis erreichen würde, hatte die mysteriöse Person Ninive noch mitgegeben.
Natürlich hatte sich Isaak sofort Gedanken gemacht, wer einen Grund gehabt hätte, sich bei Ninive zu entschuldigen. Ninive selbst war ihm dabei keine große Hilfe. Ihrer Meinung nach gab es nichts, für das sich irgendjemand bei ihr hätte entschuldigen müssen. Isaak war natürlich sofort Ilyena eingefallen. Er hatte mit ihr geschlafen, während Ninive in der Wildnis um ihr Überleben kämpfte. Er selbst hatte Ninive dafür um Verzeihung gebeten, doch er konnte sich kaum vorstellen, dass Ilyena ihr gegenüber Schuldgefühle hatte. Schon eher wahrscheinlich fand er es, dass sich Lynx dafür entschuldigt hätte, dass Ninive diese Schmerzen und den vorübergehenden Verlust ihrer Sehkraft erleiden musste, weil diese sie vor den Visaren gerettet hatte. Doch aus welchem Grund dann diese Heimlichtuerei?
Es gab für Isaak niemanden in ihrer Gruppe, der dafür wirklich infrage kam. Und das machte ihn unsicher, denn es bedeutete, dass jemand – vielleicht war diese Person sogar jetzt bei ihnen an Bord – ein Geheimnis hatte, das offenbar mit Atlantis zu tun hatte. Einem Ort, von dem vorgeblich keiner von ihnen wusste, was dort auf sie warten würde. Wie konnten sie sicher sein, dass der offen getragene Talisman nicht eine Art Falle war?
„Weißt du, wer C. ist?”, fragte Sayuri und highlightete mit ihren Fingern eine Notiz auf dem Display.
„Ich habe einen Verdacht”, entgegnete Isaak und lächelte. Noch so eine offene Frage, doch in diesem Fall hielt er es für wahrscheinlich, dass er die Lösung herausgefunden hatte. Der geheimnisvolle „C.” war derjenige, der ihnen Zervetts Notruf und die geheim übermittelten Koordinaten weitergegeben hatte, durch die sie überhaupt nur an Zervett drangeblieben waren.
„Na los! Wer ist es?”, fragte Sayuri ungeduldig.
„Du hast ihn nie kennengelernt, oder?” Isaak fing ihre Faust ab, die ihn erneut spielerisch boxen wollte. „Lumière.”
„Nein, den habe ich nicht kennengelernt”, entgegnete Sayuri, „aber wäre er nicht viel eher L. als C.?”
„Lumière ist nur sein Deckname aus seiner Zeit als Söldner in Paris”, sagte Isaak, „sein wirklicher Name ist Cygne.”
„Oh, ein schöner Name!”, befand Sayuri. „Aber das würde doch bedeuten, dass er gar kein Verräter ist, sondern sich nur bei Zervett eingeschlichen hat, um uns zu helfen, oder?”
„Ich kenne Lumière selbst nicht besonders gut, aber er ist wohl ein Mensch, dessen Entscheidungen und Loyalität nicht in denselben Maßstäben nachzuvollziehen sind, wie unsere. Ich wäre daher vorsichtig, ihn allzu schnell zu rehabilitieren.”
„Dennoch wissen wir, dass er uns geholfen hat.”
„Sofern ich richtig liege.”
„Sofern du richtig liegst”, stimmte Sayuri zu. „Hast du Coolridge eigentlich erreicht?”
„Nathan? Nein”, Isaak schüttelte den Kopf. Der Mann, der Isaak aus dem Kälteschlaf geholt hatte, der ihn auf Zervett angesetzt und ihm viele Geheimnisse über das Klonprojekt und das Sangre verraten hatte, gehörte auch – wie Zervett – zu den Gesandten von Jor. Es war diese Gruppe, deren Hintergründe für sie momentan das größte Geheimnis war.
Zu einigen Mitgliedern dieser Gruppe hatten sie nähere Informationen – oder sogar Kontakt. Doch Nathan Coolridge, den Isaak zuletzt in Hamburg gesehen hatte, war der einzige von ihnen, bei dem er auf Informationen hoffen durfte. Aber diesen erreichte er seit ihrem Abflug nicht mehr.
Die Luke zum Observationsdeck öffnete sich erneut und Ninive erschien in einem anthrazitfarbenen Jumpsuit. Die offenen, noch feuchten Haare verrieten, dass sie gerade aufgestanden war und geduscht hatte.
„Komm zu uns!”, rief ihr Sayuri gutgelaunt entgegen, „auf Isaak wäre noch etwas Platz.”
„Den überlasse ich dir”, antwortete Ninive und blieb mitten im Raum stehen, machte einen Ausfallschritt und streckte die Arme vor sich aus.
„Tai Chi?”, fragte Sayuri interessiert und ahmte Ninives Bewegungen mit ihren Händen nach, wodurch sie Isaaks Kinn erwischte, der sie daraufhin kurzerhand von der Liege auf den Boden schubste.
„Ich vergesse immer, wie das heißt”, entgegnete Ninive und verlagerte langsam ihr Gewicht. „Rasmus hat mir das geschickt. Er sagte, es helfe meiner Genesung.”
„Und, hat er Recht?”, fragte Sayuri und warf Isaak auf dem Boden sitzend eine Kusshand zu.
„Ich glaube nicht”, antwortete Ninive verzögert, „aber es hilft mir, mich in meinem Körper besser zu fühlen.”
„Hab ja nie verstanden, warum jemand wie du mit einem Körper wie deinem Probleme hat”, Sayuri erhob sich vom Boden. „Aber um meinen eigenen Komplexen vorzubeugen gehe ich jetzt duschen und ziehe mir etwas eleganteres an.”
„Warum?”, fragte Isaak, der seinen Blick schon wieder ganz den Daten vor seinen Augen zugewandt hatte, „du bist doch so schön flauschig.”
„Du hast mich doch von der Liege geschubst, Alter!”, gab Sayuri zurück, „das haste jetzt davon!”
Isaak lachte und winkte ihr hinterher, als sie durch die Luke verschwand. Er war froh, dass Sayuri mit an Bord war. Sie war erst in Fleet City neu ins Team gekommen und kannte viele Dinge, die die anderen erlebt hatten, nur aus Erzählungen. Doch vielleicht auch deshalb brachte sie eine Belebung ins Team, die ihnen gut tat. Sayuri hatte Isaak erzählt, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatte, dazuzugehören. In Fleet City war sie immer Außenseiterin gewesen. Und sie hatte alles – inklusive ihrem Leben – aufs Spiel gesetzt, als sie in ihr Team wechselte. Jetzt war sie so etwas wie der positive Pol in ihrer Crew. Eine Funktion, die Lilian früher – bevor die Last von Fleet City auf ihren Schultenr lag – erfüllt hatte, als sie noch in Europa waren.
„Hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen”, hörte er Ninives Stimme neben ihm. „Du brauchst Ruhe, Isaak!”
„Das ist aber nichts, was ich einfach so ausstellen kann”, entgegnete er und rutschte ein Stück zur Seite. „Und tu nicht so, als würdest du das können!”
„Da hast du wohl recht”, Ninive ließ sich auf der Kante der Liege nieder. Der schwache Duft von Seife begleitete sie. „Aber ich mache mir Sorgen um dich.”
„Um mich?”, Isaak wandte sich verwundert vom Display ab und sah sie an. Die Rötung ihrer Augenlider und die Spuren geplatzter Äderchen im Weiß von Ninives Augen waren nur noch schwach zu erkennen. Die Spuren, die die Visaren an ihr hinterlassen hatten, verblassten allmählich ganz. „Mir geht es gut. Es ist nur …”
„Ich weiß”, Ninive legte eine Hand auf seine Stirn und betrachtete ihn nun ebenfalls. „Frustration …”
„Ja. Nein … vielmehr die Untätigkeit hier an Bord.”
„Sequana sagt, wir müssten Atlantis bald erreichen”, entgegnete Ninive.
„Was bedeutet ‚bald‘? Einige Tage? Noch einige Wochen?” Isaak kannte die Antwort natürlich. Wenn die Reisegeschwindigkeit beibehalten werden konnte, dann wären es nur noch drei oder vier Tage.
„Einige Tage”, Ninive wedelte mit der Hand in der Luft über ihm herum. „Und die können wir besser nutzen, als immer nur auf dieselben Fragen zu starren, die wir nicht beantworten werden.” Sie spielte mit dem Reißverschluss ihres Jumpsuits und legte ihre andere Hand auf seine Brust.
„Was, hier?”, fragte Isaak und sah an ihr vorbei zur Luke. „Auf dem Observationsdeck?”
„Wer soll uns hier observieren?”, gab Ninive zurück. „Sequana und Inaktu sind im Cockpit, Sayuri ist duschen gegangen. Und Eva und Solvejg schlafen. Außerdem können wir die Luke verriegeln.”
„Gut, überredet”, Isaak griff nach Ninives Taille und zog sie weiter auf die Liege, „auch wenn du vergisst, dass Sayuri überall ihre komischen Kameras anbringt.”
„Sie ist selbst Schuld, wenn sie sich das ansieht”, entgegnete Ninive und zog mit einer schnellen Bewegung den Reißverschluss ihres Jumpsuits auf.
03 | SCHULD
„Ihr Name?”, fragte die weißgekleidete Dame am Empfang der Traumaklinik des Farley Memorial Hospitals ohne aufzusehen.
„Winston Kalahari”, sagte Seamus und zog die gefälschte ID, die ihm Ilyena mitgegeben hatte und von der er lieber nicht wissen wollte, woher sie diese hatte, durch den Scanner.
„Ach, Sie wollen zu Miss Lazarus?”, bemerkte die Empfangsdame interessiert. „Das arme Ding!”
„Deshalb habe ich die hier”, entgegnete Seamus mit einem Lächeln und hob einen großen Strauß Blumen über den Rand des Tresens, damit ihn die Dame sehen konnte. Lilian hasste Schnittblumen, und so hatte Seamus den nicht ganz billigen Strauß nur zu Tarnung gekauft. Sie mussten vorsichtig sein. Seamus gefiel es nicht, dass Lilians Name – auch wenn es nur ihr falscher war – bereits an der Rezeption der Trauma-Abteilung geläufig war. Zudem der symbolträchtige Nachname, den ihr Rasmus verpasst hatte. Maia Lazarus.
Er wolle dem Schicksal damit eine Retourkutsche verpassen, hatte Rasmus gesagt, wenn er es schon nicht den Guardians zeigen konnte. Seamus hatte das für riskant gehalten, doch angesichts des aufgewühlten Zustands, in dem sich Rasmus befand, nachdem Seamus und Sasha Lilian im letzten Moment aus dem Folterkeller der Guardians geholt hatten, brachte er es nicht über sich, dagegen Einspruch zu erheben.
Die Fahrstuhltüren glitten zu. Alleine im Aufzug gab Seamus das 31. Stockwerk an und lehnte sich an der Kabinenwand zurück. Er dachte an den Moment zurück, in dem sie Lilian gefunden hatten. Wie lange war das jetzt her? Ein paar Wochen bereits? Während er eine ganze Weile geschockt auf Lilian gestarrt hatte und sich einreden musste, dass das, was er dort sah, noch Lilian war, reagierte Sasha wie eine Maschine. Kalt und emotionslos, aber dennoch effektiv und richtig. Die wenigen Berührungen, mit denen sie Lilian das Signal der Rettung gab, wirkten auf Seamus eben so einstudiert wie gekonnt.
Sasha hatte bereits die Fesseln gesprengt, als er wieder reagierte – und das vor allem, weil Lilians zerstörter Körper ansonsten zu Boden gefallen wäre. Und so hielt er sie, die auch in der vollen Blüte ihres Lebens immer zerbrechlich wirkte, mit zittrigen Händen, spürte die Wärme ihrer Haut, die ihm endlich das Signal gab, dass es tatsächlich Lilian war, die er dort hielt, und nicht nur noch eine tote Hülle.
Sasha hatte beeindruckende Sangrefähigkeiten, daran gab es keine Zweifel, doch ihre Stärke war das Zerstören. Sie schaffte es, die Energie dafür aufzubringen, Lilian so zu stabilisieren, dass Seamus es wagen konnte, sie zur nächsten Notaufnahme zu bringen. Doch danach war Sasha erschöpft. Seamus hatte zu diesem Zeitpunkt gücklicherweise zu sich selbst zurückgefunden. Er hatte Lilian in eine Decke gehüllt und war mit ihr losgelaufen.
Er verließ den Aufzug und bog in einen langen Flur ein, an dessen Ende Lilians Zimmer lag. Es war für ihn mittlerweile zur Routine geworden, unauffällig die Gänge entlang zu spähen, um Auffälligkeiten zu erkennen. Einen neuen Stationsarzt, sich eigenartig verhaltende Besucher oder – und das war am wahrscheinlichsten – Mitglieder der District Police. Doch auch dieses Mal konnte er am Ende des Flurs aufatmen, als er die Tür zu Lilians Zimmer öffnete. Niemand – außer der ihm mittlerweile bekannten Ärzte und Pfleger – war zu sehen.
„Hey”, begrüßte ihn Lilian vom Krankenbett aus, als er die Tür wieder hinter sich geschlossen hatte.
„Wie geht es dir?”, fragte Seamus routiniert. Er überhörte ihre Antwort darauf. Eigentlich war es egal, was sie sagte, er wusste, dass es Lilian erst wieder gut gehen würde, wenn sie auf eigenen Beinen stehen und ihre Gruppe anführen würde.
„Sie kennen deinen Namen mittlerweile bereits unten am Empfang”, brummte Seamus. „Das ist nicht gut.”
„Glaubst du immer noch, Jo würde mich hier besuchen?”, fragte Lilian. Ihre Stimme klang fester und nicht mehr so brüchig wie beim letzten Mal, als Seamus an ihrem Krankenbett gewesen war.
„Ich schließe es nicht aus”, entgegnete Seamus.
„Er hätte mich doch längst gefunden, Seamus”, Lilian lächelte, „ihm ging es nur darum, mich unschädlich zu machen.”
„Und du glaubst, von diesem Ziel ist er abgerückt?”
„Nein, Seamus”, Lilian seufzte, „das Ziel hat er bereits erreicht.”
„Nein, Lil, du wirst wieder auf die Beine kommen. Du wirst deine Kraft zurückgewinnen. Du wirst …”
„… aber nicht mehr das Team führen”, entgegnete Lilian sanft. „Er hat mich als Anführerin gefürchtet. Und die werde ich nicht mehr sein. Ich werde zu lange brauchen, um wieder bei Kräften zu sein.”
„Dafür, dass die Guardians dir jeden zweiten Knochen gebrochen haben, ist deine Genesung erstaunlich schnell!”, widersprach Seamus.
„Es geht nicht um meinen Körper. Es geht um … du weißt, was ich meine. Ich ertrage selbst deinen Blick kaum. Ich weiß, was du gesehen hast, wie du mich gesehen hast.”
„Ich war so geschockt, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, Lilian.”
„Das spielt aber doch keine Rolle, Seamus”, Lilian wandte den Blick zum Fenster. „Ich weiß es. Ich fühle es. Egal wer mich ansieht, ob ihr, meine engsten Freunde, oder die Ärzte und Pfleger. Ich fühle mich, als würde jeder Blick tief in mein Innerstes vordringen. Und die verletzte, gedemütigte, hilflose Seele sehen, die mir noch geblieben ist.”
„Allein dass du noch lebst, Lilian, ist der Beweis für deine Stärke”, entgegnete Seamus. Er wusste, dass er nicht mit ihr diskutieren sollte. Egal wie irrational ihre Gefühle und Gedanken sein mochten, er hatte kein Recht, diese zu korrigieren. Doch es fiel ihm schwer zu akzeptieren, dass ein Teil der Lilian, die er kannte und – nicht nur als Anführerin – schätzte, nicht mehr da war.
„Seamus?”, Lilian wandte sich ihm wieder zu. „Du weißt, dass es jetzt an dir ist, die Führung zu übernehmen, oder?”
„Wer? Ich?!” Seamus schüttelte den Kopf.
„Natürlich du”, Lilian lächelte. „Wer denn sonst? Sasha? Ilyena? Rasmus?”
„Was ist mit Cyprien?”
„Er ist gut als Stütze für das Team”, entgegnete Lilian, „aber als Anführer? Nein, ich denke, daran würde er scheitern. Du bist es, Seamus. Und das weißt du auch, denke ich. Je eher du das einsiehst, umso besser.”
„Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue”, entgegnete Seamus, und doch verspürte er Stolz und Tatendrang, als er genauer darüber nachdachte.
„Das spielt keine Rolle”, sagte Lilian, „ich tue es.”
Seamus nickte und Stille kehrte ein. Er hatte dieses Gespräch vorhergesehen, wenn er ehrlich zu sich war. Niemand außer ihm war geeignet. Und er fühlte sich bereit. Während die Stadt um ihn herum der Maßlosigkeit, Gewalt und den Trieben zum Opfer fiel, war es für ihn, als wachte er langsam aus einem langanhaltenden Rausch auf. Fast drei Jahre lang hatte er in Fleet City damit zugebracht, sich dem lockeren Leben hinzugeben – was bei ihm vor allem hieß, dass er sich jeden zweiten Abend mit einer anderen Frau zum Sex traf. Das Sangre hatte ihn eher und stärker im Griff als alle anderen. Doch seit einiger Zeit war das Verlangen verschwunden. Der Rausch war nicht mehr da. Zuerst hatte sich Seamus ernüchtert gefühlt. Als wäre der Sinn seines Lebens von ihm genommen.
Aber schließlich spürte er, wie groß die Befreiung war, die er erlebte. Seine Gedanken waren klar, seine Sinne ungetrübt – nichts konnte ihn mehr aus der Ruhe bringen. Nichts, außer der Anblick Lilians in den Klauen der Guardians.
„Du siehst gut aus”, hörte er Lilian sagen. „So hatte ich dich gar nicht mehr in Erinnerung.”
„Na, besten Dank auch!”, entgegnete Seamus gespielt empört.
Lilian kicherte.
„Ich habe mein Leben auf Vordermann gebracht”, fuhr er fort und spürte, dass ihm angesichts Lilians Reaktion leichter ums Herz wurde. „Keine Frauen mehr. Kein Alkohol. Kein billiges Essen. Kein Fleisch.”
„Wie bist du darauf gekommen?”, fragte Lilian verwundert.
„Ich … ich kann dir das nicht so genau sagen. Der Wunsch, auf diese Dinge zu verzichten, war einfach irgendwann da.”
„Und wann genau?”, bohrte Lilian weiter.
„Na, ungefähr … zu der Zeit, als wir in die Neokaribik geflogen sind. Auch wenn ich da noch nicht wusste, wie sehr es mich verändern würde.”
„Es tut mir so leid, Seamus”, sagte Lilian zu seiner Überraschung mit zittriger Stimme.
„Was denn?”, Seamus sah sie an.
„Dass ich Fenja nicht retten konnte.”
„Fenja?” Seamus brauchte einen Moment, bis er verstand, was sie meinte. „Du denkst, es war Fenja, die mich zu einem besseren Leben bekehrt hat?” Seamus musste lachen.
„Hast du den Gedanken nie in Erwägung gezogen?”
„Natürlich habe ich das, aber … du hast sie doch kennengelernt, Lilian, was glaubst du, zu welchem Leben sie mich wohl eher getrieben hätte?” Seamus grinste, als Lilian nichts darauf erwidern konnte. „Ich denke, dass ich in Fenja mehr als nur einen One-Night-Stand sah, lag vielleicht an dem Wandel in meinem Kopf, aber niemals anderherum.”
„Dann tut es mir dennoch leid”, beharrte Lilian, doch sie klang nicht mehr so bedrückt wie noch kurz zuvor.
„Du kannst nichts dafür, Lilian.”
„Natürlich”, Lilian schüttelte energisch den Kopf, wodurch ihre dunklen Haare, die bereits wieder mehrere Zentimeter lang waren, hin und her flogen. „Mein Kommando, mein Team, meine Mission. Ich trage die Verantwortung. Das solltest du dir als zukünftiger Anführer gut merken!”
„Ja, die Verantwortung”, stimmte Seamus zu, „aber nicht die Schuld.”
„Wo soll der Unterschied sein?”
„Der Unterschied ist himmelweit!”, sagte Seamus. „Aber ich denke nicht, dass ich dir das wirklich erklären muss.”
„Ich bin mir nicht so sicher”, Lilian schlug die Bettdecke ein Stück zurück. „Mein Verstand weiß es, aber mein Herz fühlt sich schuldig.”
„Deine Hand ist nicht mehr geschient?”, versuchte Seamus, das Thema zu wechseln.
„Nur die Rechte. Die Linke wird noch ein paar Tage brauchen. Und die Ärztin hat gesagt, dass sie will, dass ich nächste Woche ein paar Schritte gehe.” Lilian drehte ihre rechte Hand und bewegte die Finger. „Siebzig Prozent Kunststoff, dreißig Prozent Knochen. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel von meinem Körper künstlich sein muss, dass ich nicht mehr ich bin.”
„Und, bist du zu einem Ergebnis gekommen?”
„Nein. Aber meine Hand fühlt sich noch als Teil von mir an. Ich denke, damit kann ich leben.” Lilian steckte die Hand wieder unter die Bettdecke. „Denkst du manchmal an sie?”
„An Fenja?” Seamus nickte. „Ja, oft.”
„Trauerst du?”
„Eine schwierige Frage”, entgegnete Seamus. „Ich versuche, die positiven Dinge zu sehen.”
„Was für positive Dinge?”
„Du warst mit Fenja nicht einverstanden, du hast ihr – vielleicht zurecht – nicht vertraut, und dennoch hast du dein Leben aufs Spiel gesetzt, um sie zu retten.”
„Mein Team, meine Mission, meine Verantwortung … du kennst die Nummer mittlerweile”, entgegnete Lilian.
„Natürlich”, Seamus nickte und drehte die nächsten Sätze in seinem Kopf herum, bevor er sie aussprach, „aber du hast es auch gemacht, weil du sie für mich retten wolltest. Und das ist mir mehr Wert als alles andere.”
Lilian starrte ihn an und öffnete ihren Mund, doch sie fand offensichtlich nicht die richtigen Worte. Sie wandte sich von ihm ab und starrte sekundenlang zum Fenster, bevor sie schließlich doch noch etwas sagte. „Du bist mein bester Freund, Seamus, das weißt du doch, oder?”
„Und deshalb will ich nie wieder in eine Situation kommen, in der ich dich so finde, wie dort bei den Guardians”, sagte er, „für alles andere fühle ich mich bereit.”
„Die Zeiten sind zu unsicher, um dir zu versprechen, dass es nicht wieder vorkommen wird”, entgegnete Lilian, „aber …”, sie winkte ihn zu sich an die Bettseite, nahm seine Hand und führte sie unter die Bettdecke. Er spürte die warme Haut an ihrem Schlüsselbein und wollte beschämt die Hand zurückziehen, als sie seine Finger tiefer führte, doch dann spürte er eine kleine Narbe auf ihrem Brustbein.
„Das ist der Grund, warum ich lebe. Diese Narbe hat mir nicht die Folter zugefügt, sondern die Entladung von Sashas Sangre, als die Eisenstange zurückgeprallt ist.”
Lilian ließ seine Hand los. Seamus war sich nicht sicher, ob sie erwartete, dass er sie zurückzog. Er wartete einen Moment, dann löste er den Kontakt.
„Du meinst, ich soll Sasha nicht mehr von deiner Seite lassen?”
„Oh, Mann! Nein, bitte … ich bin ihr zu Dank verpflichtet, aber …”, Lilian brach den Satz lachend ab, bevor sie wieder ernster wurde. „Nein, ich meine damit, dass es einer unfassbaren Portion Glück zu verdanken ist, dass ich noch lebe. Sekunden später und ich wäre Brei gewesen. Dieses Glück, Seamus, das beschützt mich.”
„Aber dann kannst du mir doch versprechen, dass du nicht noch einmal solche Qualen erleben musst”, sagte Seamus. Er wollte es scherzhaft sagen, doch es klang verdammt ernst.
„Ja”, sagte Lilian leise. „Versprochen.”
04 | SCHIFFBRUCH
„Geht es allen gut? Die Bord-Com noch online?” Ninive hämmerte mit den Fingern auf die aufblinkenden Warnmeldungen des Displays.
„Wir leben noch”, war Sequanas angestrengte Stimme im Bordfunk zu hören, „aber die Flugbahn fühlt sich nicht richtig an!”
„Bereitet euch darauf vor, dass es ungemütlich wird”, knurrte Isaak vom Pilotensitz aus. „Wir werden sehen, ob das Ding wasserdicht ist.”
„Wir können den Kurs noch abfangen!”, rief Ninive gegen das ohrenbetäubende Donnergrollen an. „Der Nav-Computer ist wieder am Arbeiten.”
„Zu spät!”, widersprach Isaak, „wenn wir jetzt nicht die Wasserlandung einleiten, zerstören wir das Schiff beim Aufschlag auf die Wellen.”
Erneutes Donnergrollen. Eine Weile sagte niemand etwas.
„Ninive?”, fragte Sequana wieder über den Funk.
„Verdammt, Isaak hat Recht”, gab diese zurück. „Alles festhalten, wir gehen auf Tauchgang!”
Isaak nickte ihr zustimmend zu, dann riss er das Neigungsruder nach vorne. Die Nase des Schiffs senkte sich augenblicklich und sie gingen in einen Sturzflug über.
Ninive lehnte sich im Co-Piloten-Sessel zurück und zog die Gurte fester um ihren Oberkörper. Das Schiff war für solche Manöver ausgelegt, selbst bei rauer See, doch ein mulmiges Gefühl blieb dennoch.
Sie hatten die Koordinaten, die den Standort der Atlantis-Station angeben sollten, am frühen Morgen erreicht, doch unter ihnen war nur das offene Meer gewesen. Unschlüssig hatten sie das Schiff einige Zeit über dem Wasser kreisen lassen, während Sayuri sich die Bordgeräte näher ansah. Ein Fehler im Navigationscomputer hatte ihnen den falschen Standort angezeigt, das war das Ergebnis ihrer Untersuchung. Glück im Unglück war, dass Sayuri es schaffte, diesen Fehler zu beheben.
Doch während dieser Verzögerung hatte sich der Himmel verdunkelt und die stürmische See hatte sich in eine tobende Flut verwandelt. Isaak, der gegen Abend das Steuer wieder von Sequana übernommen hatte, blieb nichts anderes übrig, als das Schiff höher in die Luft zu bringen, denn der Sturm drohte, sie wie eine Feder im Wind einfach in die Wellenberge zu drücken.
Doch da waren die Quetzals, offensichtlich durch den Sturm nervös geworden, die wenig Verständnis für ihren neuen Kurs gezeigt hatten. Und so blieb ihnen nun nichts anderes übrig, als im letzten Schein der fernen Sonne in die Fluten des Atlantiks einzutauchen. Nicht weit entfernt von seiner tiefsten Stelle.
Das Durchbrechen der Wellen schüttelte sie durch. Der Schlag der Wassermassen gegen die Bordwände war ohrenbetäubend, und dennoch war die Stille, die kurz darauf folgte, als ihr Fall gebremst und weder Sturm noch Wellen mehr an ihnen zerrten, beängstigender.
„Wie lange können wir tauchen?”, fragte Isaak neben ihr ruhig.
„Laut Bordinformationssystem bis zu sechs Stunden”, gab Ninive zurück.
„Reicht das, um aus dem Sturm herauszukommen?”
„Träum weiter!”, meldete sich Sayuri über Funk, „allein das Sturmzentrum ist den Wetterdaten zufolge so groß wie ein ganzer Kontinent.”
„Dann müssen wir also in dieser rauen See tatsächlich an die Oberfläche?”, versicherte sich Isaak.
„Sieht so aus”, kommentierte Sequana.
„Aber erst in sechs Stunden”, warf Ninive ein, „vielleicht schwächt sich der Sturm bis dahin ab.”
„Nicht wahrscheinlich aber auch nicht völlig unmöglich”, sagte Sayuri, „aber wir können ohnehin nur abwarten.”
„Ich fahre alle nicht unbedingt benötigten Systeme runter”, sagte Ninive und widmete sich wieder dem Display vor ihr. „Das gilt auch für die COM-Anlage. Den Notfallkanal lasse ich geöffnet.”
Ruhe kehrte im Cockpit ein, als die Funkkanäle schließlich deaktiviert waren. Ninive fuhr die weiteren Systeme herunter, leitete die Energie auf die Sauerstoffaufbereitung um und schaltete dann die nicht benötigten Displays ab. Sie sah Isaaks Gesicht vom spärlichen Licht des Navigationscomputers beschienen. Er studierte ruhig den Kurs und korrigierte die Parameter in der Routeneingabe minimal mit dem Steuerknüppel.
„Was ist das?”, fragte Ninive plötzlich, als sie aus dem Augenwinkel einen langen Schatten in einiger Entfernung vorbeischwimmen sah, „tauchen die Quetzal auch?”
„Wo?”, fragte Isaak alarmiert und sah sich um. Ninive deutete in die Richtung, in der der große, lange Schatten nun erneut auftauchte. Er wirkte massiver und weniger schlank als die Körper der Quetzals, doch das konnte im schwachen, von unscharfen Schatten durchzogenen Restlicht, das von der Oberfläche zu ihnen hinab drang, täuschen.
„Das da?”, fragte Isaak schmunzelnd und lehnte sich zurück. „Der ist für uns ungefährlich.”
„Was ist das?”, fragte Ninive erneut und ärgerte sich, dass Isaak offenbar mehr wusste als sie.
„Ein Wal, Ninive”, entgegnete er, „der kommt nicht aus den Korridoren. In den Ozeanen dieser Welt gab es auch schon vorher beeindruckende Kreaturen. Dazu hat es das Sangre nicht gebraucht.”
„Ein Wal?”, Ninive wusste, dass Isaak aus seinem Leben vor über einem Jahrhundert, als die Welt noch umspannt war von Wohlstand und vor allem einem unerschöpflich scheinenden Informationsfluss, Wissen hatte, dass sie nicht haben konnte, doch jetzt fühlte sie sich dumm. Wie hatte es passieren können, dass die Menschheit das Wissen über solch gigantische Lebewesen, die in ihren Meeren lebten, einfach vergaß?
„Als ich klein war”, fuhr Isaak fort, „hatte ich ein Buch aus Plastik, das man kleinen Kindern mit in die Badewanne geben konnte. Darin waren verschiedene Fische und andere Meeresbewohner abgebildet.”
„Dann ist ein Wal also ein großer Fisch?”, fragte Ninive und versuchte sich Isaak als kleines Kind vorzustellen, was ihr jedoch misslang.
„Biologisch gesehen ist der Wal kein Fisch sondern ein Säugetier”, entgegnete Isaak, „aber die Form und der Lebensraum sind denen von Fischen ähnlich.”
„Was haben Kinder zu deiner Zeit noch in Plastikbüchern gelernt?”, fragte Ninive ernst und versuchte sich nicht durch Isaaks Lachen irritieren zu lassen. Sie hatte das Gefühl, sie müsse zumindest die grundlegenden Erfahrungen der Spezies Mensch zur Zeit des letzten Milenniums machen, um eine Chance zu haben, Isaak irgendwann ebenbürtig zu sein. Es war nicht so, als hätte er das jemals von ihr gefordert, doch Ninive war sich sicher, es würde die Chance auf eine normale Beziehung zu ihm – irgendwann, wenn dies alles vorbei sein würde – deutlich erhöhen.
Isaak erzählte ihr viel in den nächsten Stunden. Von der Welt, wie sie früher war, von Tieren, die er im Zoo gesehen hatte, denen Menschen auf den verschiedenen Kontinenten begegnet waren. Von Ländern und Völkern, Kulturen und bemerkenswerten Orten.
„Warum hat die Menschheit das alles aufgegeben?”, fragte Ninive schließlich. „Wie viele Jahrhunderte hat es gedauert, bis das alles aufgebaut war?”
„Jahrtausende”, entgegnete Isaak aus dem Dunkel neben ihr. Das Licht von der Oberfläche war seit einigen Stunden völlig verschwunden und nur die Notbeleuchtung der wenigen aktiven Displays sorgte für etwas Licht. „Aber ganz so war es nicht. Es gab Höhen und Tiefen. Große Reiche und große Kulturen wurden aufgebaut und verschwanden wieder. Dinge wurden schon immer zerstört und boten später oft den Nährboden für Neues.”
„Aber das Wissen wurde immer mehr, oder?”
„Auch das nicht … glaube ich. Soweit ich weiß, gab es Zeiten im Mittelalter, als das Wissen über vorangegangene Epochen – wie die Antike – verloren gegangen ist. Erst später wurde es durch unermüdliche Arbeit der Wissenschaft wiedergewonnen.”
„Also besteht Hoffnung für die Menschen?”, fragte Ninive ernst. „Gehen wir nur durch ein dunkles Kapitel?”
„So sehe ich das gar nicht, Ninive”, antwortete Isaak, nachdem er einen Moment lang nachgedacht hatte. „Es gibt Fortschritt in dieser Zeit, den ich vor einhundert Jahren als nicht sehr wahrscheinlich gesehen habe.”
„Du meinst die Energie, oder?”
„Richtig. Zu meiner Zeit wurden die Rohstoffe der Erde ausgeschlachtet, obwohl wir längst das Wissen darum hatten, dass wir damit unser eigenes Grab schaufeln. Vielleicht ist das etwas, für das wir dem Sangre dankbar sein können.”
Ninive nickte und blendete die Außenscheinwerfer auf, als sie meinte, etwas Schattenhaftes im Dunkeln des Meeres gesehen zu haben.
„Ich verstehe, warum du deine alte Welt zurück willst”, sagte sie dann.
„Ich will meine alte Welt nicht zurück”, entgegnete Isaak.
„Nicht? Aber ich dachte, deshalb sind wir auf der Suche nach dem Sangre, damit du … dein Leben damals, Isaak, es wurde dir genommen.”
„Und dafür wurde mir ein neues geschenkt”, entgegnete Isaak, „und über das will ich mich nicht beklagen. Weißt du, Ninive, es stimmt schon, dass ich tief in meinem Inneren immer den Rest einer Hoffnung haben werde, dass alles noch einmal so wird, wie früher. Doch das ist in etwa so, wie ich mit Zwanzig wehmütig an meine Kindheit und mit Dreißig an die Unbeschwertheit der Zwanziger dachte. Doch das beruhte immer darauf, dass ich das Gefühl hatte, für mein Leben noch nicht den richtigen Sinn gefunden zu haben. Ich habe mich nie damit abfinden können, einfach den Tag zu leben. Und jetzt habe ich ein Ziel, etwas, auf das sich hinarbeiten lässt. Und es ist ein gutes Ziel.”
„Aber welches Ziel ist es, wenn es nicht die Rückkehr in dein altes Leben ist?”, fragte Ninive verwirrt. Sie spürte ein aufgeregtes Kribbeln in ihrem Inneren. Sie selbst hatte sich so oft die Frage gestellt, auf welches Ziel und welchen Sinn ihr Leben hinauslief. Als Klon war sie immer dazu erzogen worden, einer Mission oder einem Auftrag zu folgen, und erst in den letzten Jahren hatte sie mehr und mehr verstanden, dass sie sich nun das Ziel selbst suchen musste. Doch sie spürte, dass sie noch zu wenig vom Menschsein verstand, um diesen Schritt zu gehen.
„Mein altes Leben kommt nie mehr zurück, denn Zeit lässt sich nicht aufhalten und nicht umkehren. Mein Ziel ist es, aus diesem Leben, das mir bleibt, das Beste zu machen”, Isaak lächelte. Ninive sah es nicht, doch sie konnte es hören.
„Also willst du das Sangre aufhalten, um dir in dieser Welt ein neues Leben aufzubauen?” Das fand Ninive in Ordnung, das war ein Ziel, mit dem sie umgehen konnte. Doch was dann? Welches Ziel hatte dieses zukünftige Leben dann?
„Du setzt die Prioritäten falsch, Ninive”, entgegnete Isaak, „das Sangre aufzuhalten ist nur ein Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Ziel.”
„Und was ist dieses eigentliche Ziel?”
„Du.”
Ninive starrte Isaak an. Oder zumindest starrte sie in die Dunkelheit, aus der Isaaks Stimme kam. Sie konzentrierte ihr Sangre auf die Augen und fokussierte den Blick, bis sie seine Umrisse sah. Er saß ruhig im Pilotensitz zurückgelehnt und hatte die Arme auf die Lehnen gestützt.
Sie wollte etwas antworten, doch die Dinge in ihrem Kopf waren durcheinandergebracht. Sie hatte gehofft, von Isaak ein Ziel oder einen Sinn zu erfahren, den sie als ihren eigenen übernehmen konnte. Doch sie konnte sich schwerlich selbst zum Ziel haben. Oder doch?
„Hallo?”, meldete sich in diesem Moment der Notfallkanal des Bordfunks.
„Sayuri, was gibt’s?”, antwortete Isaak.
„Habt ihr die Sensorensysteme ausgeschaltet?”
„Ähm … nein”, antwortete Ninive noch halb in ihren Gedanken und warf einen Blick auf das Display für die Energiesteuerung. „Die sekundären Kreisläufe und redundanten Sensorsysteme habe ich offline genommen, aber …”
„Okay, okay, dann stört entweder irgendetwas die Messdaten der Außenbordsensoren oder die Software zur Wetterdateninterpretation macht Scheiß!”
„Was willst du uns sagen, Sayuri?”, fragte Isaak.
„Ich will sagen, dass das Messbild behauptet, an der Oberfläche wäre ruhige See”, kam es über den Funk zurück, „kein Sturm, kein Wellengang, kein gar nichts.”
„Das ist doch gut für uns, oder?”, fragte Ninive.
„Wenn das stimmen würde, dann ja”, Sayuri klang wenig zuversichtlich, „aber selbst bei bestem Wetter auf See können solche Daten nicht passen.”
„Wie weit sind wir noch von den Atlantiskoordinaten entfernt?”, fragte Ninive in Isaaks Richtung.
„Wenige Stunden”, entgegnete Isaak, „wenn Sayuri dieses Mal die Ortung richtig programmiert hat.”
„Du siehst es nicht, aber ich strecke dir meine Zunge entgegen”, kommentierte Sayuri.
„Niedlich”, bemerkte Isaak.
„Hört mal einen Moment auf zu flirten”, mischte sich Ninive dazwischen, „ich habe eine Theorie.”
„Schieß los!”, sagte Sayuri, „ist bestimmt interessanter als das, was Isaak von sich gibt.”
„Klappe, Sweetheart”, kommentierte Isaak und benutzt dabei den Kosenamen für Sayuri, den er sich von Lynx abgeguckt hatte.
„Wir wissen nicht, was genau die Atlantisstation ist und wer sie bewohnt – wenn sie bemannt ist”, fuhr Ninive fort, „aber wir sind uns doch einig, dass ihre Baumeister mit hoher Wahrscheinlichkeit uns überlegen sind, wenn es um Technologie und vor allem um Sangre-Tech geht, oder?”
„Aha!”, sagte Sayuri, „ich glaube, mir gefällt, was du denkst!”
„Ich halte es zumindest für nicht ganz unmöglich, dass die Station von einem Sangreschild oder ähnlichem umgeben ist, der sie sichert. Und so eine verborgene Seestation wird doch zu allererst von den Gewalten des Ozeans bedroht.”
„Klingt das logischer als gestörte Sensoren, Sayuri?”, fragte Isaak in seiner typischen Art, jede Vermutung auf ihre Wahrscheinlichkeiten zu testen.
„Erstaunlicherweise tut es das”, sagte Sayuri, „denn die Sensoren haben Fehlerkorrekturen und prüfen sich gegenseitig. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass etwas von außen die Daten der Sensoren verfälscht und die Systeme stört, müsste diese Störung auch noch zufällig dafür sorgen, dass die unabhängig laufenden Fehlerkorrekturroutinen ein kohärentes Bild abgeben. Das tun sie nämlich, und deshalb ist dieses eigentlich fehlerlose System mit hoher wahrscheinlich korrekt am Arbeiten.”
„Warum hast du dann gefragt, ob wir die Systeme abgeschaltet haben?”, fragte Ninive verwundert.
„Nur um sicher zu gehen”, entgegnete Sayuri. „Naja, und weil ich meinen eigenen Augen nicht getraut habe.”
„Sangreschild oder nicht”, sagte Isaak und nickte Ninive zu, als diese die Außenlichter und ersten Sekundärsysteme hochfuhr, „dann ist über uns ruhige See. Und das bedeutet, wir können auftauchen.”
Die Lichter und Displays flammten wieder auf und tauchten das Cockpit in ein kaltes, blaues Licht. Während Ninive die Energieumverteilung und den Reboot der Systeme durchführte, leitete Isaak den Auftauchvorgang ein.
„Hast du Angst?”, fragte Ninive einige Minuten später, als das Schiff mit stetiger Geschwindigkeit zur Wasseroberfläche aufstieg und sie beide in die Rückenlehnen der Sitze presste.
„Angst? Wovor? Vor dem Auftauchen?”, fragte Isaak.
„Nein, nicht vor dem Auftauchen. Eher vor dem, was uns auf der Station erwartet”, sagte Ninive.
„Natürlich habe ich das”, entgegnete Isaak, „wir wissen nicht, wer oder was dort ist, ob wir freundlich empfangen werden oder nicht, ob wir jemals wieder von dort weg kommen … aber die größte Angst ist, dass wir dort keine Antworten finden.”
„Hmm….”, machte Ninive.
„Was ist?”, fragte Isaak, „keine zufriedenstellende Antwort?”
„Das sind alles sehr rationale Gründe”, entgegnete Ninive, „ich würde es daher eher Bedenken nennen, nicht unbedingt Angst.”
„Vielleicht”, gab Isaak zu, „aber sieh dich um. Es ist dunkel, eigenartig still, wir haben schwer erklärbare Messergebnisse und etwas scheint nicht normal zu sein dort oben. Das kannst du jetzt Unbehagen nennen, aber Unbehagen und Bedenken ergeben für mich Angst.”
„Interessant”, bemerkte Ninive und grübelte darüber nach. Es gab noch immer einige Konzepte der menschlichen Empfindungswelt, die sich ihr nicht zur Gänze erschlossen. Wenn Isaak Recht hatte – und Menschen tendierten dazu, sich zu irren, wenn es um ihre eigenen Gefühle ging – dann war Angst etwas grundlegend fundiertes, das einen Sinn hatte. Einen Sinn, der so trivial war, dass man sich darüber keine Gedanken machen musste. So trivial wie ein Wal in den Weltmeeren.
05 | ANDENKEN
Es gab Momente, in denen erkannte Seamus, dass es das Leben war, das einen Rausch auslösen konnte, dem er sich nicht verweigerte. Die Schönheit eines Augenblicks war so etwas. Kein körperlicher Rausch, eher einer des Geistes. Es war die schräg einfallende Wintersonne an diesem kalten Tag, die ihn bereits seit dem Morgen in einem Zustand des Hochgefühls getragen hatte. Er war im Door Park mit Tumbleweed laufen gegangen. Der zottelige, schwarze Hund, den Ninive aus der Wildnis mit in die Stadt gebracht und schweren Herzens zurückgelassen hatte, als sie zur Atlantisstation aufgebrochen war, hatte nicht lange gebraucht, um sich eine neue Bezugsperson zu suchen.
Und Seamus merkte, dass er aus der Anhänglichkeit des Tieres Vertrauen in sich selbst und den von ihm eingeschlagenen Weg zog. Ein Tier machte sich keine Gedanken um Höflichkeit, Mitleid oder Diplomatie. Dass Tumbleweed in ihm seine neue Leitfigur sah, wertete Seamus als ehrliche Bestätigung für das, was er war und tat. Und spätestens seit Lilian vor wenigen Tagen aus dem Farley Memorial entlassen worden war und er sich eingestehen musste, dass sie noch auf längere Zeit auf Hilfe angewiesen sein würde, war es für ihn wichtig, Stärke aus dieser Bestätigung zu ziehen.
„Der Park ist schön im Winter”, sagte er eigentlich zu sich selbst, doch die blonde Frau, die nackt auf dem Sofa hinter ihm lag, nahm es als Anlass, das Gespräch aufzunehmen.
„Eigentlich sollte ich es als Beleidigung empfinden, dass du dir lieber den Park ansiehst, als das hier”, sagte Lynx. Seamus drehte sich nicht zu ihr um, doch er kannte sie mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass sie bei diesen Worten spielerisch ihren Körper präsentierte. „Doch ich muss zugeben, dass es sich auch befreiend anfühlt. Außerdem ist der Park wirklich schön im Winter.”
„Du weißt, dass du gut aussiehst, Lynx”, Seamus lachte und kraulte Tumbleweed, der sich leise neben ihn gesetzt hatte, hinter den Ohren.
„Ja, ja”, Lynx stand vom Sofa auf, wickelte sich in eine dünne Wolldecke und trat neben Seamus ans Fenster. „Das Schöne ist doch, dass ich darüber bei dir nicht mehr nachdenken muss. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass du körperlich unbeteiligt bleibst, hat das doch seine Vorzüge.”
„Körperlich unbeteiligt?”, fragte Seamus erstaunt, „ich habe für dich mein Hemd ausgezogen, und außerdem …”
„… außerdem waren Hände und Mund in vollem Einsatz”, Lynx lachte dreckig, und fuhr mit ihren Fingern über seine nackten Schulterblätter, „ich weiß, ich weiß … und du weißt, was ich meine.”
„Natürlich”, entgegnete Seamus. „Ich bin gerne mit dir zusammen, wirklich. Aber ich habe meinen Weg gewählt, und Enthaltsamkeit hört nicht zwischen den Beinen auf.”
„Manche würden sogar sagen, sie fange dort erst an”, entgegnete Lynx lachend und sah zu Tumbleweed hinab, der seine Schnauze an ihrem Schienbein rieb. „Du bist dir aber im Klaren darüber, dass ich mich nicht ewig damit zufrieden geben werde, oder?”
„Natürlich”, Seamus drehte sich nun doch zu ihr und schenkte ihr ein Lächeln, „und ich würde dir dazu auch nicht raten. Ich weiß, wie die wahre Lynx ist. Ein Biest, herrisch, immer in der Kontrolle.”
„Wir verstehen uns”, Lynx nickte und wurde plötzlich ernster, „aber zurzeit habe ich nicht das Gefühl, Herrin über irgendetwas zu sein. Also komme ich zu dir, gebe mich deinen Händen hin und lecke meine Wunden. Das ist schön, Seamus. Ich sehe dich nicht als Liebhaber. Ich sehe dich als meinen Heiler.”
„Und als Freund, hoffe ich”, ergänzte Seamus. „Denn wir können jeden Funken Freundschaft gebrauchen in diesen Tagen.”
„Deshalb ist es gut, Lilian hier zu haben”, sagte Lynx, „ich habe nicht ruhig schlafen können, seitdem sie … so lange sie im Krankenhaus war.”
„Dennoch ist es schmerzhaft, sie so zu sehen”, Seamus seufzte. Lilian war seit ihrer Ankunft in Lynx‘ Villa am Rande des Door Parks ein Quell der Lebensfreude. Seamus fragte sich, wie ein Mensch, der durch die schlimmste aller Höllen gegangen ist, der noch immer nicht alleine gehen und die Arme nur eingeschränkt bewegen konnte, so dass sie sich bei alltäglichen Kleinigkeiten wie dem Duschen oder Anziehen helfen lassen musste, so viel Positives ausstrahlen konnte.
Doch Lilian tat es, und sie steckte die anderen an. Seitdem sie nach den Räumen des Black Phoenix und Lilians Appartement in der Pyramide auch ihr Hauptquartier in Chapel Shire aufgeben mussten, um nicht von den Guardians oder sonstigen Gegnern aufgespürt zu werden, hielten sie sich in Lynx’ Villa versteckt, die im verschlafenen, zurückgezogenen Villenviertel stand, das wie eine bebaute Halbinsel in den Door Park hineinragte. Doch erst seit Lilians Rückkehr hatten sie das Gefühl, dass sie hier ein neues Zuhause hatten.
Rasmus hatte seine Gerätschaften rechtzeitig aus dem alten Hauptquartier retten können und sich in einem Raum im zweiten Stock der Villa in einem großen Erker seine Werkstatt neu eingerichtet. Seit Lilians Rettung hatte er sich in Arbeit gestürzt und mit Cyprien, der noch immer viele Kontakte aus seiner Zeit bei der District Police hatte, ein Kommunikationsnetzwerk versprengter Widerstandsgruppen gegen die Guardians aufgebaut. Er war oft bei Lilian im Krankenhaus, doch er sprach nicht viel darüber. Seamus hatte ihn in Ruhe gelassen, da er sich nur ungefähr vorstellen konnte, wie er sich fühlen musste.
Erst am Abend vor Lilians Rückkehr hatten sie zusammen in der übergroßen Küche im Erdgeschoss gesessen und stumm lauwarmen Kaffee getrunken, als Rasmus schließlich sagte, dass er Lilian liebe. Seamus war das nicht neu – vermutlich wussten es alle in der Villa Anwesenden bereits – doch Rasmus hatte mit ihm nie so offen darüber gesprochen.
„Das Leben kann so schnell vorbei sein”, hatte Rasmus weiter ausgeführt, „keine Zeit mehr zu verlieren.”
„Heißt das, du willst ihr endlich sagen, was schon viel zu lange unausgesprochen ist?” Seamus hatte sich das Sticheln nicht verkneifen können.
„Ich habe bisher immer auf die Situation Rücksicht genommen und …”, begann Rasmus, doch Seamus hatte gelacht, zwei Bier geholt und Rasmus den Kaffee weggenommen.
„Auf dich. Auf euch, mein Freund!”
Und Rasmus hielt sich an seinen Plan. Nachdem Lilian am Tag darauf alle begrüßt hatte, zeigte Rasmus ihr das Zimmer, in dem sie untergebracht werden sollte, und sie waren danach für den Rest des Tages verschwunden.
„Wir brauchen eine konkrete Aufgabe”, holte ihn Lynx aus seinen Gedanken zurück. „Rasmus und Cyprien haben ihre bereits gefunden, aber was bleibt uns anderen?”
„Sasha findet immer eine Schlägerei, in die sie sich einmischen kann”, entgegnete Seamus scherzhaft, doch Lynx hatte Recht. Er war bereits seit einigen Tagen fieberhaft am überlegen, was ihr nächster Schritt sein würde. Der Schwarze Turm war dort draußen und focht ihre Kämpfe gegen die Loge und die Guardians. Sie selbst waren nur noch ein kleines Team in einer zurückgezogenen Villa, und auch wenn Cyprien und Rasmus gute Arbeit leisteten, da waren noch Sasha und Lynx, Ilyena und er selbst. Und sie brauchten eine Aufgabe!
„Ich frage mich noch immer, ob es nicht einen Weg gibt, etwas gegen die Visaren zu unternehmen”, begann Seamus vorsichtig. Er wusste, dass er sich damit in eine schwierige Diskussion mit der Frau stürzte, die einst die Wächterin des Fraktals der Visaren gewesen und deren Zwillingsschwester von den Visaren aufgeschlitzt und an die Kuppel der Oper genagelt worden war.
„Daran habe ich auch schon gedacht.” Lynx‘ Antwort kam für ihn überraschend. Sie sah seinen Gesichtsausdruck und lachte leise. „Ich will noch immer nicht in die Oper”, stellte sie klar, „aber ich sehe die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Nur ist dir doch auch klar, dass wir in der Oper nicht lange genug überleben würden. Ganze Teams des Schwarzen Turms sind nicht mehr zurückgekehrt.”
„Gut, einverstanden, nicht die Oper. Aber an was hast du dann gedacht?”
„Ich habe über Fenja nachgedacht. Sie ist von den Visaren verschleppt worden, wenn ich eure Schilderungen korrekt in Erinnerung habe.”
„Ja”, bestätigte Seamus, „das war in der Neokaribik.”
„Spielt keine Rolle”, entgegnete Lynx und ging zum Sofa zurück, wo sie sich hinsetzte. „Sie ist verschleppt worden, nicht gleich getötet. Die Visaren scheinen ein Interesse an ihr zu haben. Also sollten wir vielleicht ihren Hintergrund näher in Augensch…”
„Oh Mann, ich Riesenarsch!” Seamus schlug sich mit der Hand vor die Stirn.
„Das wollte ich damit jetzt eigentlich nicht sagen”, bemerkte Lynx.