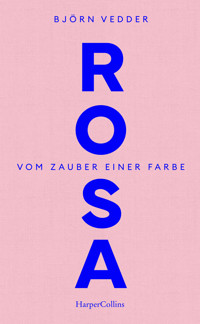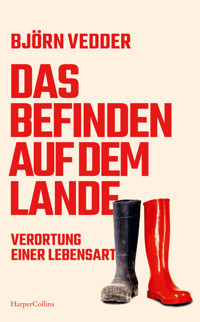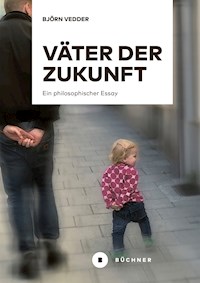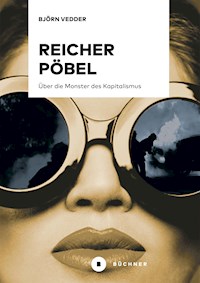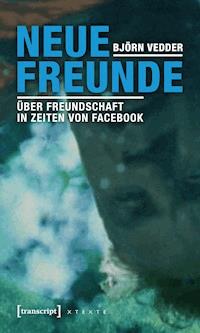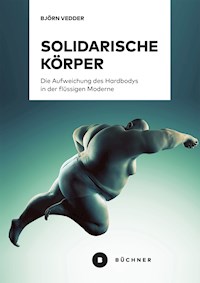
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Büchner-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jede Gesellschaft hat die Körper, die sie verdient. Und jede Gesellschaft muss ihre Körper ändern, wenn sie sich selbst verändern will. Björn Vedders Essay betrachtet die harten und sauber geputzten Körper unserer Instagram-Gegenwart. Ihnen ist alles Weiche, Flüssige, Offene und Uneindeutige ausgetrieben worden, sie erscheinen von anderen Körpern getrennt und aus dem Kreislauf der Natur ausgeschlossen. Vedder zeichnet die jahrhundertelange Entstehung dieses Körperbildes nach und zeigt, wie es mit einer gegenläufigen Entwicklung interagiert – der Verflüssigung der Gesellschaft: Individuelle Sicherheiten und gemeinsame Solidaritäten lösen sich auf, der Einzelne wird isoliert, soziale Beziehungen ökonomisiert. Diese Gesellschaft formt den Hardbody und der Hardbody regiert die Liquid Society. Diese Wechselwirkung birgt ein Potenzial zur Veränderung, denn es gilt: Nicht nur formt die Gesellschaft die Körper, auch die Körper formen die Gesellschaft. Wie aber müsste sich unser Körperbild verändern, damit Solidarität wieder möglich wird? Stiften weichere Körper festere soziale Beziehungen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Björn Vedder
Solidarische Körper
Die Aufweichung des Hardbodys in der flüssigen Moderne
ISBN (Print) 978-3-96317-285-4
ISBN (ePDF) 978-3-96317-827-6
ISBN (ePUB) 978-3-96317-828-3
Copyright © 2022 Büchner-Verlag eG, Marburg
Bildnachweis Cover: © icetray/123RF.com
Umschlaggestaltung: DeinSatz Marburg | tn
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.deabrufbar.
www.buechner-verlag.de
Inhalt
EinleitungDer Psychopath und die HardbodysI. Wie der Hardbody entstandKapitel 1: Klassische GlasbläsereiFür immer hart, für immer jungSich selbst idealisierende SinnlichkeitKapitel 2: Der zivilisatorische Hardbody und der groteske SoftbodyWas für einen großen Schlund du hast!Die Pobacken zusammenkneifenUtopie und KarnevalKörper gegen Körper, Hobbes & Co.Kapitel 3: Bürgerliche Körper: Das stahlharte Gehäuse des Kapitalismus Spitze BleistifteDer Duft der FrauenMax Weber, die vertrocknete NussDas innere AuslandRauchen macht die Welt erträglich, Trinken macht die Männer hart: Bourgeoisie und FitnessKapitel 4: Körperdisziplin und BiopolitikDie Erfindung der PräventionNeoliberalismus aus dem ReformhausHardbody-LeidKapitel 5: Hardbody-Emotion: American Cool und deutsche KälteKapitel 6: Hardbodys in der Liquid SocietyAmerikanisches Kino und deutscher Terror: Dirty Harry und »Dirty« GudrunReaganite HardbodyAuf der Kommandohöhe: Abhärtung durch Schmerz»Schwingende Schwänze« und Jane Fonda – Hardbody SexDer Hardbody als Hülle und SpiegelZählbare KörperHardbody und AlternDie Kunst der ErschlaffungII. Wie können wir den Hardbody überwinden?EkelspieleExzessGrotesque Body PositivityLeiblichkeitWie lässt sich die leibliche Erfahrung stärken?DanksagungEndnotenEinleitung
Dieser Essay hat zwei Inspirationsquellen. Die erste Quelle liegt in meinem Homegym, das ich mir während der Pandemie eingerichtet habe und in dem ich jeden Tag versuche, mir einen Hardbody anzutrainieren, wie ich ihn in den Blockbustern sehe. Dieser Körper ist muskulös und mager. Er ist glatt und hart wie eine antike Statue. Alles Weiche und Ambivalente ist ihm ausgetrieben. Er ist stark und frei. Dieser durch Krafttraining und Ausdauersport geformte Körper ist das dominierende Ideal, nach dem Menschen sich richten, wenn sie für ihren Körper anerkannt werden wollen.1 Er gleicht einem Kleidungsstück, das nach einer bestimmten Mode geformt ist. Als Bezeichnung für dieses Körperbild hat sich der Begriff Hardbody etabliert. Propagiert wird es durch Filme, Werbung und die sozialen Medien. Beispielsweise folge ich Dwayne »The Rock« Johnson auf Instagram, habe aber natürlich in den 1980ern auch alle Rocky- und Schwarzenegger-Filme gesehen und in den 2000ern die Sachen mit Brad Pitt. Wer sich die Körper der genannten Schauspieler vor Augen führt, sieht gleich: Es gibt einen historischen Wandel im Körperbild. Große Steroidmuskeln (Stallone und Schwarzenegger), ausgezehrter Körper (Pitt), große Steroidmuskeln auf ausgezehrtem Körper (The Rock). These, Antithese und Synthese. Dialektischer Materialismus des Hardbodys. Da ich aber keine Geschichte des Bodybuildings schreibe, differenziere ich hier nicht.
Die zweite Quelle sind die Bilder des Malers Bernhard Martin, die er von grotesken Körpern malt. Sie sind wie Schwämme oder Korallen. Seltsame Flüssigkeiten fließen aus ihnen heraus oder hinein. Sie saugen und spritzen. Sie bilden eine Welt, die mir weniger aus klar voneinander abgegrenzten Individuen zu bestehen scheint, als aus einem unruhigen Gemisch von Körpern, die den unwiderstehlichen Drang besitzen, einander zu umfassen und zu umschließen.
Liberaler Hardbody und grotesker Softbody – zwischen diesen beiden Körperbildern und den Vorstellungen vom Leben, die damit verbunden sind, spannen sich die folgenden Überlegungen auf. Es geht um Schönheit und Erfolg, Askese und Exzess, Männer und Frauen, Korallenriffe und Krafttraining, um harte Körper und responsive Leiber, Dirty Harry und die RAF, Jane Fonda und schwingende Schwänze, Biopolitik und Rennradfahren.
Mein Essay gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil beschreibe ich das Körperideal des Hardbodys mit seinen Implikationen. Welches Menschenbild ist damit verbunden? Welche Form von Gesellschaft? Welche Ästhetik und Moral? Warum wird alles immer flüssiger, der Körper aber härter? Dabei gehe ich zum Teil historisch vor und zeige, wie das ästhetische Ideal des Hardbodys in der Klassik als ein Gegenbegriff zum grotesken Leib erfunden wurde und wie der Prozess der Zivilisation, das bürgerliche Arbeitsethos, politische Maßnahmen zur Förderung des Lebens oder eine bestimmte Gefühlskultur die Körper verschlossen und abgehärtet haben, bis schließlich eine neoliberale und neokonservative Ideologie den klassisch schönen Hardbody moralisiert und zum Symbol ihrer Werte gemacht haben. Spätestens damit komme ich in der Gegenwart an und beschreibe, wie das Körperideal des Hardbodys von einer Warenästhetik der Körper, einer digitalen Kultur, der Leugnung des Alterns und dem Streben nach Anerkennung unterstützt und gehalten wird. Überall herrschen Prozess- und Profitmaximierung – nicht nur im Hinblick auf die Produktion von Waren, sondern auch im Hinblick auf die eigene Person. Denn ich muss mich auch selbst zu einer Art Ware machen, nämlich in einer Art und Weise entwerfen, mit der andere etwas anfangen können, wenn ich in unserer Gesellschaft bestehen will. Der Preis dafür ist jedoch sehr hoch. Das Regime, dem wir unsere Körper unterstellen, fördert mit dem Wettbewerb auch die Entsolidarisierung der Menschen, ihre Erschöpfung und Vereinzelung. Es schließt sie aus dem Kreislauf der Natur aus, macht sie unfähig, zu sterben, und zwingt sie, allein zu leben.
Gleichwohl gibt es natürlich eine Gegenbewegung zum Hardbody. Sie öffnet die Körper und macht sie sensibler, fordert Solidaritäten ein und rückt die eigene Verletzlichkeit genauso in das Zentrum wie die fremde. An sie schließt mein Essay an, sie möchte ich unterstützen. Deshalb frage ich im zweiten Teil des Essays, wie wir den Hardbody überwinden können. Denn jede Gesellschaft hat die Körper, die sie verdient, und muss andere Körper bekommen, um eine andere Gesellschaft zu werden. Die Vorschläge, die ich dazu mache, verbinden die Anliegen der Body-Positivity-Bewegung mit einer Rückkehr des grotesken Körpers, postmodernen Theorien biologischer Systeme und einer Philosophie des Leibes. Was mich an diesen Ansätzen interessiert, ist die Möglichkeit, über unsere Körper die Grundlage für eine neuerliche Solidarität und Rücksicht zu gewinnen. Mehr Berührungen, weniger Bilder. Mehr Sex, weniger Porno. Mehr Arbeit, mehr Sport und vor allem: jeden Tag spazieren gehen.
Die Solidarität der Körper ist es auch, was mich an Bernhard Martins Bildern besonders fasziniert. Es gefällt mir, dass Martins Figurinen, wie er sie nennt, vieles von dem zeigen, was im ästhetischen Kanon als hässlich oder ekelhaft verworfen wird und was unsere Kultur mit Scham besetzt: offene Körper, das Pumpen der Organe, Blut, Schweiß und Sperma. Martin hat mir erzählt, er genieße die Provokation, diesen Körpern, die dem Prozess der Zivilisation wie dem kapitalistischen Getriebe gleichermaßen widersprechen, die Ehre des Gemäldes zuteilwerden zu lassen, und ich kann das gut verstehen. In meinem Beitrag zu seinem Ausstellungskatalog habe ich nach diesem Atelierbesuch die vielen phallischen und vaginal-uteralen Formen, die er ins Bild setzt, die spritzenden Röhren und schleimtropfenden Höhlen als Bildwerdung der Begierden und Leidenschaften bezeichnet, die in unserer Kultur verdrängt worden sind, und behauptet, dass er damit nicht nur der Ästhetik der allgegenwärtigen digitalen Bilder widerspricht, sondern auch der sozialen Semantik, die damit verbunden ist – also dem gesellschaftlichen Zustand, in dem alles optimiert wird und glatt laufen muss. Diesem Wunsch nach planer, leicht konsumierbarer Positivität entspricht unsere Vorliebe für schöne, glatte Körper. Sie zeigt sich zum Beispiel im Zuspruch für die Skulpturen von Jeff Koons: glänzende Kugeln mit spiegelglatten Oberflächen, ohne Tiefe zwar, aber wie gemacht für eine Gesellschaft aus gefallsüchtigen Narzissten.2
Und tatsächlich ist es die Gesellschaft, die unsere Körper macht, die sie verhärtet, verschließt und in ein Maschinenteil verwandelt, das man zwar mit anderen koppeln, aber auch wieder isolieren kann. Und wir arbeiten daran mit.
Diese Verhärtung und Isolation der Körper irritieren mich auch deshalb, weil unsere Gesellschaft immer flüssiger wird. Nicht nur soziale Hierarchien lösen sich auf und verbinden sich in netzwerkartigen Strukturen neu, auch die Differenz zwischen öffentlich und privat, die jahrhundertelang das gesellschaftliche Leben bestimmte, ist durchlässiger geworden und einer Kultur der Intimität gewichen, die sich von Liebesbeziehungen über die Arbeit und das Berufsleben bis in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erstreckt.3 Sollte diese Veränderung nicht dazu führen, dass auch unsere Körper offener werden, intimere Beziehungen eingehen und sich stärker dem Bild von Martins Figuren annähern? Sollten sich unsere Körper nicht zu symbiotischen Körpern entwickeln?
Wir sind von der Vorstellung einer Allverbundenheit aufeinander antwortender Körper jedoch sehr weit entfernt. Die Gesellschaft wird zwar flüssiger, die Körper werden jedoch härter. Sie rücken nicht näher zusammen, sondern weiter auseinander. Sie entsolidarisieren sich – wie eben alles in der flüssigen Moderne in Auflösung begriffen ist. Nicht nur die alten Strukturen, sondern auch die Solidaritäten, die mit ihnen gegeben waren und etwa darin bestanden, dass der Staat die Interessen seiner Bürgerinnen und Bürger schützte, diese sich in Institutionen wie Sozialversicherungen und Gewerkschaften gegenseitig absicherten – und vielleicht auch stärker bereit waren, ihre unmittelbaren, individuellen Interessen zugunsten zwischenmenschlicher Bindungen hintanzustellen, weil es sich für sie lohnte, in dieses Sicherheitsnetz zu investieren. So beschreibt das der Soziologe Zygmunt Bauman, der den Begriff der flüssigen Moderne geprägt hat, von liquid society spricht er im Original.4 Harte Körper in einer flüssigen Gesellschaft: Die erstaunliche Einsicht ist, dass sich beide nicht ausschließen oder widersprechen, sondern vielmehr gegenseitig bedingen. Hardbodys sind zwar nicht erst in der liquid society entstanden. Sie werden von einer ganzen Reihe von Faktoren geprägt, aber die Verflüssigung von Solidaritäten treibt die Verhärtung der Körper weiter voran und die Hardbodys stützen die flüssige Gesellschaft durch ihre Unsolidarität, ihren Individualismus und ihre Härte.
Das kommt uns teuer zu stehen. Die mit der flüssigen Moderne verbundenen Wirtschafts- und Produktionsweisen zerstören die Lebensgrundlage der Menschen und vieler anderer Lebewesen. Diejenigen, die unter ihren Bedingungen leben, sind nicht besonders glücklich. Seit Jahren nehmen Erschöpfungserscheinungen, Depressionen und Angstzustände zu.5 Dieses Unglück zeigt sich in den Körpern, die müde und ausgezehrt sind, keinen Schlaf finden und chronisch schmerzen. Das Leiden zeigt sich nicht nur in den Körpern, es wird auch durch den Umgang mit ihnen hervorgerufen. Denn wir müssen unsere Körper auf bestimmte Weise zurichten, um den Anforderungen des Lebens in der modernen Gesellschaft zu entsprechen. »Wir kneifen alle unbewusst permanent die Pobacken zusammen«, wie der Hollywoodschauspieler Cary Grant einmal sagte.6 Das führt zu dem bekannten Unbehagen an der Moderne, den Erschöpfungs- und Angstzuständen und den somatischen Leiden. Infolge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie sind diese Leiden noch einmal verstärkt aufgetreten und sie machen den Zusammenhang zwischen seelischen Leiden und dem Verschluss, der Trennung und der Kontrolle unserer Körper besonders deutlich.
Gleichwohl bin ich selbst ein Anhänger des Hardbodys und trainiere fast jeden Tag. Ich will, wie viele andere auch, nicht nur stärker und fitter werden, sondern auch so aussehen. Dafür habe ich mich zuletzt über eine App bei einem Trainingsprogramm angemeldet, das Movie Prep heißt und seinen Klienten einen Superheldenkörper verspricht, wie wir ihn aus dem Kino kennen. Das heißt, es geht weniger darum, was unsere Körper wirklich können, als darum, wie sie aussehen. Das ist das klassische Bodybuilding-Prinzip. Die Verwandlung des Körpers in ein Bild.7 »Niemand«, so umreißt unser Trainer Pieter Vodden das Konzept, »fragt Dwayne ›The Rock‹ Johnson oder Chris Hemsworth, wie viel Gewicht sie bei einer Kniebeuge auflegen oder was sie auf der Bank drücken können. Es geht nur darum, wie sie auf andere wirken.«
Unsere Trainingsrealität sieht jedoch anders aus. Pieter programmiert in der App für jeden Tag einen Trainingsplan, den wir absolvieren, und schickt uns alle zwei Wochen Anweisungen für unsere Ernährung. Wir teilen jedoch keine Fotos, sondern tragen in der App ein, wie viel Gewicht wir bei den Kniebeugen oder beim Bankdrücken aufgelegt haben, tauschen uns im Chat darüber aus, wie viel Zeit wir für welche Übungen gebraucht haben und was wir besonders hart fanden. Diese Härte ist für viele von uns eine besondere Motivation. Wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch oder im Auto, werden körperlich kaum gefordert und müssen uns permanent kontrolliert verhalten. Da tut es gut, den Körper wieder zu spüren, zu schwitzen, zu stöhnen, zu kämpfen und zu brüllen. Der Historiker Peter Stearns hat in einer Studie über den Wandel der Gefühlskultur gezeigt, wie vormals als positiv verstandene Gefühle wie Aggression oder Wut im 20. Jahrhundert immer stärker zugunsten einer coolen Persönlichkeit zurückgedrängt wurden, die emotional kontrolliert und abgeklärt ist, weil die kalten Krieger in jedem Gefühlsausbruch eine Gefahr sahen. Er behauptet, die Freizeitkultur biete ein Ventil für die so aufgestauten Emotionen. Dazu gehören auch die Actionfilmhelden, die mithin eine kompensatorische Funktion haben.8 Kritiker wenden dagegen ein, dass es keine natürlichen Gefühle gebe, sondern Emotionen immer sozial codiert seien und im (gemeinsamen) Handeln entstehen. So resultiere die Lust am Wettkampf und der Aggression aus der Wettbewerbsorientierung unserer Gesellschaft.9 Das Motto des Gyms, an dem wir mittels Training-App partizipieren, heißt »Strength, Power, Aggression« und ich denke, dass beide Ansätze – Stearns’ und derjenige seiner Kritiker, etwas für sich haben. Viele von uns empfinden bei den martialischen Aktionen im Gym eine Lust, die sie anders nicht so leicht stillen können und fühlen sich, wenn sie sich nach dem Work-out im Spiegel betrachten, wie Conan der Zerstörer (1984). Und sie fühlen sich fit für das Leben, den Wettbewerb, den Erfolg. »Um erfolgreich zu sein, musst du stark sein«, sagte mir unser Trainer im Interview für dieses Buch. »Und um stark zu sein, musst du glauben, dass du stark bist. Diesen Glauben gewinnst du beim Training.« Auf der Hantelbank erprobt sich der Selfmademan.
Gleichwohl trainieren wir auch, um gut auszusehen und einem bestimmten Ideal zu entsprechen, sonst hätten wir uns wohl kaum für ein Programm entschieden, das die Erscheinung höher bewertet als Kraft und Agilität. Auch wenn beides natürlich nicht wirklich zu trennen ist, solange man seinem Körper außer gesundem Essen keine anderen Stoffe zuführt. »Das Aussehen entspricht der Fähigkeit«, sagt der Chef unseres Gyms, Mark Twight, ein ehemaliger Alpinist, der zuerst damit bekannt wurde, den Mont Blanc fast ohne Ausrüstung bestiegen zu haben, und dann als Trainer für Schauspieler den Hardbody Typ 2 prägte, etwa im Sandalenfilm 300 (2006).
In unserem Bemühen um einen Hardbody sind wir nicht allein. Elf Millionen Deutsche sind Mitglied in einem Fitnessstudio, das ist jeder vierte zwischen Achtzehn und Sechzig. Etwa genauso viele benutzen eine Fitness-App, Anzahl steigend. 2024 sollen es nach Angaben von Statista 24 Millionen sein. In den USA sind 73 Millionen Menschen Mitglied in einem Fitnessstudio und 68 Millionen benutzen eine Fitness-App. Selbst wenn es hier Überschneidungen gibt und Menschen sowohl mit einer App trainieren, als auch Mitglied in einem Studio sind, versucht doch ein großer Teil der Menschen, seinen Körper zu formen. Dabei ist der hagere, muskulöse, durch Krafttraining geformte Hardbody das dominierende Ideal. Als ich nach der Herkunft des Begriffs suchte, der inzwischen in englischsprachigen Wörterbüchern ebenso zu finden ist wie in deutschsprachigen Geschichtsbüchern, war das früheste Vorkommen, das ich gefunden habe, Bret Easton Ellis’ Roman American Psycho (1991). Darin geht es um einen Investmentbanker, der im New York der späten 1980er Jahre zum Serienmörder wird. Ich finde die Rolle, die der Hardbody für diesen Psychopathen spielt, sehr aufschlussreich für unser Verhältnis zum Körper und stelle eine entsprechende Beschreibung derselben meiner kleinen Geschichte des Hardbodys voran.
Der Psychopath und die Hardbodys
»Courtney öffnet die Tür; sie trägt eine cremefarbene Seidenbluse von Krizia, einen Rock von Krizia aus rostrotem Tweed und d’Orsay-Pumps aus Seidensatin von Manolo Blahnik.«
»Elisabeth ist ein 22-jähriger Hardbody, die gelegentlich für Georges-Marciano-Anzeigen modelt«.
»Habe ich je erzählt, daß ich eine große gelbe Smiley-Maske tragen und die CD-Version von Bobby McFerrin’s ›Don’t Worry, Be Happy‹ auflegen möchte, dann ein Mädchen und einen Hund nehmen – einen Collie, einen Chow, einen Sharpei, es kommt nicht so darauf an –, eine Transfusionspumpe, so einen Tropf anschließen und dann ihr Blut austauschen möchte, genau, das Hundeblut in den Hardbody pumpen und umgekehrt, habe ich das je erzählt?«
Bret Easton Ellis, American Psycho.10
Wenn Patrick Bateman, aalglatter Investmentbanker und Protagonist von American Psycho, von einem Hardbody spricht, meint er damit eine junge Frau, die ihren Körper durch Diät und Training in eine besondere Fassung gebracht hat. Das heißt, er meint eigentlich nicht die Frau als Person, sondern ihren Körper, der gleich einem Kleidungsstück nach einer bestimmten Mode geformt ist – hager, aber fest und muskulös, jugendlich, glatt und unverbraucht. Eine Puppe, die bestimmte Kleider trägt und deren Körper nur eine weitere Art ist, sich selbst zu kleiden. Insofern erscheint es nur folgerichtig, wenn Bateman zahlreiche dieser Hardbodys im Laufe des Romans zerstückelt und zerschneidet und die Linien des Körpers auftrennt wie die Nähte eines Mantels. Der Traum von einer Bluttransfusion zwischen Hund und Frau, den ich oben zitiere, ist in diesem Sinne nicht die satirische Utopie eines neuen Menschen – wie etwa in Michail Bulgakows Erzählung Das hündische Herz (1925), in der ein Moskauer Chirurg einen Mann und einen Hund zusammennäht, um die Erschaffung des neuen Sowjetmenschen voranzubringen. Vielmehr demonstriert er die zynische Konsequenz aus einem Körperbild, das seinen Gegenstand als ein Objekt versteht. Man trägt den eigenen Körper gleich einem bestimmten Kleid, um sich selbst zu entwerfen und dafür von anderen Anerkennung zu bekommen. Der Hardbody ist eine Ware, die zum Gebrauch bestimmt ist, für die eigene Lust, aber vor allem für die Lust der anderen, denen ich gefallen will, und Batemans metzgernde Schneiderkunst ist nur eine besonders radikale und aufschlussreiche Art und Weise, sich an diesen Körpern zu erfreuen. Im Gebrauch fremder Körper für die eigene Lust ähnelt Bateman dem Libertin und Staatsminister Saint-Fond in de Sades Erzählung 120 Tage von Sodom (1785), der einer Freundin erklärt: »Zweifeln Sie daher nicht mehr an diesen Ungleichheiten, Juliette; und da sie existieren, zögern wir nicht, daraus Nutzen zu ziehen und fest daran zu glauben, dass die Natur uns in dieser ersten Klasse von Menschen auf die Welt kommen lassen wollte, damit wir nach Lust und Laune das Vergnügen genießen können, den anderen anzuketten und ihn gebieterisch all unseren Leidenschaften und all unseren Bedürfnissen zu unterwerfen.«
Saint-Fonds naturrechtliche Rechtfertigung für den Gebrauch eines fremden Körpers kann sich Bateman jedoch sparen, weil er erkannt hat, dass ein Mensch, der seinen Körper wie ein Kleid trägt, um anderen zu gefallen, sich selbst zu einem Gegenstand für die Lust eines anderen macht. Die praktische Schlussfolgerung, die Bateman aus dieser Tatsache zieht, wenn er Körper gleich einem Kleid zerschneidet, sind zwar besonders schonungslos, weil sie die Körper seiner Opfer zur leeren Hülle reduzieren – die Ausgangslage, auf der sie gründet, ist von seinen Opfern jedoch selbst geschaffen worden. Anders als Saint-Fond muss er sie nicht anketten und mit Gewalt zum Objekt seiner Lust machen, sondern sie tun das grundsätzlich selbst, wenn sie sich als Hardbody entwerfen – denn dann entwerfen sie ihre Körper als solche, die dafür da sind, von anderen gebraucht zu werden. In der Antike galt das als Definition des Sklaven. Sklaven, schreibt der griechische Philosoph Aristoteles in Nikomachische Ethik (um 400 v. Chr.), sind Menschen, »deren Werk der Gebrauch des Körpers« durch einen anderen Menschen ist.11
Eine moderne Gesellschaft aus Hardbodys ist dieser Definition zufolge eine Gesellschaft von Menschen, die sich gegenseitig versklaven, in der einer der Sklave des anderen ist. Darin sind sie gleich. Die Ungleichheit, von der Saint-Fond spricht, ist in einem demokratischen Prozess des wechselseitigen Einsatzes und der Wertschätzung der Körper abgeschafft worden und einer Gleichheit in der wechselseitigen Versklavung gewichen. Das gilt auch für Bateman, der selbstredend ebenfalls ein Hardbody ist. Die Aufzählung seiner Morgenroutine von der Eispackung für die Augen über die 1.000 Crunches bis zur Aftershavelotion, die »stets wenig oder gar keinen Alkohol enthalten [sollte,] […] da der hohe Alkoholanteil die Gesichtshaut austrocknet und sie älter aussehen lässt«, nimmt im Buch gut sechs Seiten ein. Dass die Mehrzahl seiner Opfer Frauen sind, ist vielleicht nur seinem sexuellen Bias geschuldet.
Dass Menschen dadurch, dass sie von der Wertschätzung anderer abhängen, einander gleich werden, ist eigentlich ein Ideal der bürgerlichen Philosophie. Diese glaubt seit der Französischen Revolution, durch den Aufweis der gegenseitigen Abhängigkeit eine Gesellschaft begründen zu können, deren Bürger nicht nur gleich sind, weil sie voneinander abhängen, sondern auch frei, weil es keine Herren mehr gibt, sondern einer der Knecht des anderen ist. So hat es als einer der ersten der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel formuliert, als er auf dem Höhepunkt der Siege der französischen Revolutionsarmee und unter dem Eindruck Napoleons als »Weltseele auf einem Pferde sitzend« seine Phänomenologie des Geistes (1807) verfasste und darin das Gleichnis von Herr und Knecht aufnahm.12
Dieses Gleichnis formuliert einen westernartigen Zweikampf um Anerkennung, bei dem einer zum anderen sagt: ›Erkenne mich an, schätze mich wert, sage mir, dass ich toll bin!‹ Beide wollen das, weil die Anerkennung durch einen anderen die Grundvoraussetzung dafür ist, ein positives, bestätigendes Verhältnis zu sich selbst aufzubauen, das heißt, ein Selbstbewusstsein auszubilden. Das geht nicht mit Objekten, sondern nur mit anderen Subjekten. »Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein«, schreibt Hegel.13 Niemand kann sich selbst anerkennen. Das verlangt, sich dem anderen auszusetzen. Ebendas müssen die Charaktere in Hegels Parabel aber erst lernen, denn anfangs wollen sie nur Anerkennung bekommen, aber keine geben. Das geht soweit, dass der eine dem anderen sogar droht, ihn umzubringen, wenn er ihn nicht anerkennt, ohne dafür selbst Anerkennung zu verlangen. Und weil dem anderen sein Leben lieber ist als sein Selbstbewusstsein, geht er darauf ein und sagt: Du bist der Herr, ich bin dein Knecht – »Ich bin nichtig, du bist das Wesentliche.«14 Damit ist der Herr scheinbar am Ziel seiner Wünsche angelangt. Er wird von seinem Knecht anerkannt und bildet so ein Selbstbewusstsein aus. Es dauert jedoch nicht lange, bis er realisiert, dass er eigentlich nicht der Herr, sondern der Knecht seines Knechtes ist, denn er bleibt doch von der Anerkennung seines Knechtes abhängig. Sollte sein Knecht sie ihm entziehen, wäre er nicht nur kein Herr mehr, er wäre überhaupt niemand mehr, der über ein Selbstbewusstsein verfügte, denn dieses hängt vollständig vom anderen ab. Die Rollen vertauschen sich: Der Knecht steigt zum Herrn seines Herren auf. Das ist die berühmte Dialektik von Herr und Knecht. Sie besagt, dass ich den, der mich anerkennt, selbst anerkennen muss, damit das Anerkennen meiner selbst überhaupt Bedeutung hat.15
In der idealistischen Sphäre abstrakter Selbstbewusstseine entsteht daraus eine Gemeinschaft von Freien und Gleichen, deren Freiheit und Gleichheit sich wechselseitig bedingen, weil sie ihre Grundlage im jeweils anderen haben. In realen Gesellschaften schwindet diese Freiheit jedoch und der Charakter der gegenseitigen Knechtschaft oder Versklavung tritt stärker hervor. Das liegt daran, dass die Anerkennung nicht nur in einer Zweierbeziehung erfolgt, sondern jeder von vielen anderen anerkannt werden muss und es immer einen diskursiven Rahmen gibt, innerhalb dessen Anerkennung gewährt oder verweigert wird. Dieser Rahmen wird von der Kultur und der Politik bestimmt. Dadurch kann sich niemand, wenn er anerkannt werden will, vollkommen frei entwerfen. Er muss auf bestimmte Inhalte zurückgreifen, die er vorfindet und sie zu einer eigenen Identität verarbeiten. Jeder wählt aus den Inhalten aus und setzt das Ausgewählte zu einem Selbstentwurf zusammen – wie bei der Auswahl einer Garderobe oder dem Kuratieren einer Ausstellung. Wir tragen diese Gesinnung, bevorzugen jenes Essen und diese Möbel. All das tun wir, um unsere Individualität oder, wie der Soziologe Andreas Reckwitz sagt, Singularität zu beweisen und dafür wertgeschätzt zu werden.16 Wir versuchen also, uns als jemanden zu entwerfen, der gleichermaßen besonders individuell und liebenswert ist, also Eigenschaften hat, die anderen gefallen. Dazu gehört auch unsere körperliche Erscheinung, die wir zunehmend als ein Kapital begreifen, mit dem wir auf dem Markt der Anerkennung reüssieren oder scheitern können. Unser Körper wird zu einem Teil unserer Identität, ebenso wie die Kleider, die wir tragen.
Das ist im Hinblick auf unseren Körper allerdings viel schwieriger als im Hinblick auf unsere Kleidung. Denn während wir unsere Garderobe einfach wechseln können – zumindest dann, wenn wir über genug Geld verfügen –, setzt die Verwandlung unseres Körpers harte Arbeit voraus, zum Teil von anderen, wie zum Beispiel Schönheitschirurgen, vor allem aber von uns selbst. Bei keinem anderen Teil unseres Selbstentwurfes gewinnt die Frage »Wie muss ich mein Leben ändern, mein Leben neu bestimmen und erfinden, damit diese neue Sache in es hineinpasst oder ich mich dieser neuen Sache anpassen kann?« ein solches Gewicht wie im Hinblick auf die Gestaltung unseres Körpers, den wir überdies nie als Tabula rasa oder leeren Kleiderschrank vorfinden, sondern der immer schon seine eigene Geschichte, seine eigene Gestalt und genetische Disposition mitbringt und der sich – zumal mit zunehmendem Alter – unseren Gestaltungswünschen mehr und mehr widersetzt oder ihnen nur noch sehr zögerlich folgt.17
Deshalb gibt es ein wachsendes Angebot an Fitnesstraining und -coaching – nicht nur seitens der Privatwirtschaft, wie etwa mein Movie Prep-Programm, sondern selbst durch die Krankenkassen, die ihre Aufgabe nicht mehr allein in der Grundversorgung im Krankheitsfall sehen, sondern ebenfalls auf die physische Weiterentwicklung der Versicherten hinarbeiten. Doch so gut diese Programme Menschen auch unterstützen, die Arbeit am Körper bleibt eine individuelle Quälerei. Sie muss nicht nur die mit den Jahren wachsenden Widerstände des Körpers überwinden, sondern wird auch nie fertig, weil die Fitness und Schönheit des Körpers immer wieder neu hergestellt werden müssen. Es ist eine Sisyphosarbeit. Muskeln, die nicht beansprucht werden, baut der Körper wieder ab, Nährstoffe, die er nicht verbrennt, speichert er als Fett. Die Hardbodys der Stars, an denen sich viele Menschen orientieren wie die alten Seefahrer an den Sternen, erstrahlen nur für einen kurzen Augenblick unter spezieller Beleuchtung. Der Schauspieler Dwayne »The Rock« Johnson etwa hat für seinen Hardbody, den er im Film Aquaman