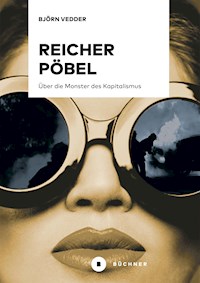Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Büchner-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ein Vater ist, wissen wir heute nicht mehr. Das zeigt sich in den Entwicklungsstörungen und der mangelnden Sozialisation von Kindern ebenso wie im zunehmenden Unbehagen von Vätern und den Überlastungen der Mütter. Der lange Schatten des abwesenden Vaters liegt wie ein Bleigewicht auf dem Leben aller. Wollen wir uns davon befreien, braucht es eine angemessene Rollenbeschreibung, die zeigt, wie und was ein Vater heute sein könnte – jenseits von überkommenen Männlichkeitsvorstellungen, patriarchalen Familienmodellen oder der Idee einer geschlechtlosen Elternschaft. Björn Vedders Essay leistet ebendas: Er entwickelt eine zeitgemäße Vaterrolle – aus psychologischen, philosophischen und sozialwissenschaftlichen Studien, aus den Produkten der Hoch- und der Popkultur und vor allem aus den grundlegenden Erfahrungen, die wir in der Familie und im Leben machen können. Dabei wird deutlich, warum ein Kind zu bekommen, ein Sprung in das gute Leben ist, warum Väter, die sich an Recht und Ordnung halten, Angsthasen sind, was die Künste des Vaters vermögen und wie Mutter und Vater das Kind gemeinsam fertig machen zur Fahrt. Eine besondere Bedeutung kommen dabei Erfahrungen des Verlustes zu. Für deren Reflexion gibt es in der gegenwärtigen Kultur keinen Ort. Sie werden aber zukünftig immer wichtiger werden. Mit dem Vater stellt Vedder eine Figur vor, diese Erfahrungen wieder sinnvoll in unser Leben zu integrieren. So werden die Väter von heute zu Vätern der Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Björn Vedder
Väter der Zukunft
Ein philosophischer Essay
ISBN (Print) 978-3-96317-195-6
ISBN (ePDF) 978-3-96317-717-0
ISBN (ePUB) 978-3-96317-729-3
Copyright © 2020 Büchner-Verlag eG, Marburg
Bildnachweis Cover: privat
Umschlaggestaltung: DeinSatz Marburg | tn
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
www.buechner-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1: Einleitung
Kapitel 2: Die Abwesenheit des Vaters lastet wie Blei auf dem Leben
Die Mutter bringt das Lebewesen zur Welt, der Vater das soziale Wesen
Die Restitution des Patriarchats aus dem Geist des Kapitalismus – ein Eigentor mit Anlauf
Gorillas im Nebel
Kapitel 3: Der Vater, eine Rolle auf der familiären Bühne
Rolle und Fremdheit
Die Familie ist keine Metzgerei
Rollenbilder als Interpretamente der Erfahrung
Kapitel 4: Der Vater als Stellvertreter
Väterliches Gericht
Wenn das Herz im Leibe kracht – der eiserne Vater
Die Gefühle haben Schweigepflicht
Clara liest die Bibel – oder wie ich meiner Tochter eine anarchistische Ader einpflanzte
Väter, die sich an Recht und Ordnung halten, sind Angsthasen
Kapitel 5: Tugend und Verzicht
Vater sein: Schön ist das nicht – aber gut
Die Ökonomisierung der Vaterschaft
Die Unstillbarkeit der Wünsche und das Leben von vorne
Kapitel 6: Mama activa oder es lebe das Matriarchat
Kapitel 7: Von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben
Mit Papa am Fluss sitzen
Die Dandys kippen von den Marmorklippen
Das Gehen auf tauendem Eise
Die Sozialisierung des Kindes durch den Vater
Liebe
Der Vater, das Schlitzohr
Der Vater als Trainer und Athlet
Fight Club Ostwestfalen
Der Vater führt das Kind in die Welt der Phänomene ein
Kapitel 8: Resümee: Das väterliche Sein zum Tode – eine fröhliche Wissenschaft
Kapitel 9: Klimainduzierte Askese: Wie uns das väterliche Sein zum Tode helfen kann, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen
Kapitel 10: Lob des Gammelns – ein Postskriptum
Dank
Endnoten
1 Einleitung
2 Die Abwesenheit des Vaters
3 Der Vater, eine Rolle auf der familiären Bühne
4 Der Vater als Stellvertreter
5 Tugend und Verzicht
6 Mama activa oder es lebe das Matriarchat
7 Von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben
9 Klimainduzierte Askese
10 Lob des Gammelns: Ein Postskriptum
Für meine Töchter
Kapitel 1: Einleitung
In den meisten Familien lebt ein Vater. In manchen gibt es sogar mehrere Väter, und auch da, wo sie nicht (mehr) zu Hause leben, sind sie doch in der Nähe – am Wochenende, in den Ferien, zu Geburtstagen. Trotzdem sind die meisten Väter abwesend, abwesend in dem Sinne, dass sie ihre Funktion verloren haben und nicht wissen, wie sie eine neue finden sollen. Psychologinnen konstatieren seit längerem schon eine »Ferne der Väter«, die aus der Verunsicherung darüber resultiert, was die Rolle des Vaters heute sein könnte. Denn viele, die ihre Kinder heute die väterliche Zuwendung vermissen lassen, wissen gar nicht, worin diese Zuwendung bestehen könnte, weil sie selbst keine erfahren haben und auch keine entsprechenden Rollenbilder vorhanden sind, um diesen Mangel zu kompensieren. Dieses Defizit vererben sie. Ihre Verunsicherung, so der Psychoanalytiker Hans-Geert Metzger, hat »oft einen unverbindlichen Rückzug, ein reales oder symbolisches Verschwinden der Väter zur Folge«. Und aus dieser neuen Abwesenheit der Väter resultieren verschiedene Symptome einer »väterlich bedingten Grundstörung«, die sich in einer mangelnden Individuation und Sozialisation der Kinder genauso zeigt wie in zunehmenden psychischen Leiden der Väter, in Depressionen, Schlaf- und Arbeitsstörungen.1 Dass sich die Orientierungslosigkeit bis hin zu psychischen Leiden steigern kann, belegen viele klinische und sozialwissenschaftliche Studien. Sie zeigt sich aber auch in den Künsten, die ein feines Sensorium für gesellschaftliche Veränderungen besitzen und uns den Spiegel vorhalten. Das kann komisch sein wie in den Gedichten von Durs Grünbein, der sich in der Verlegenheit sieht, vor seiner Tochter rhetorisch Rabatz machen zu müssen, weil er meint, ihr sonst nichts offerieren zu können:
»Verzeih mir. Dein Vater haut auf den Putz,
Weil er sonst nichts zu bieten hat. Vor allem nicht diese Brust.«
Oder das kann tragisch sein wie in dem Roman Das kurze Leben des Ray Müller, in dem Ralph Bönt einen Mann beschreibt, der einmal ganz Vater sein möchte, aber gar nicht weiß, wie das geht und deshalb seinen Sohn durch sein fahrlässiges Verhalten tötet.2
Stets jedoch hat diese Orientierungslosigkeit gravierende Konsequenzen, denn der lange Schatten des abwesenden Vaters legt sich wie ein Bleigewicht auf das Leben aller. Wollen wir uns von diesem Joch befreien, brauchen wir eine angemessene Rollenbeschreibung, die zeigt, wie und was ein Vater heute sein könnte. Einen Vorschlag dazu lege ich hier vor. Damit reihe ich mich in die Tradition einer therapeutischen Philosophie ein, die immer dann auf den Plan tritt, wenn zentrale Institutionen fraglich werden und das gute Leben nicht mehr gelingen will. Ihre Aufgabe ist es, »das Glück wieder herbei zu reden und einen Baum des Glücks aufzustellen«, wie der Philosoph Peter Sloterdijk sagt.3
Mein Interesse ist jedoch nicht nur philosophischer Natur. Ich bin selbst Vater von zwei Töchtern – und, so Gott will, bald von dreien. Das Fehlen eines angemessenen Vaterbildes ist für mich also auch ein praktisches Problem. Umso erstaunter war ich, als ich bei der Recherche feststellte, dass die Philosophie zu einer zeitgemäßen Vaterrolle anscheinend wenig zu sagen hat. Es gibt zwar eine ganze Reihe von ideengeschichtlich-historischen Büchern zum Thema, wenn diese in der Gegenwart ankommen, werden ihre Auskünfte jedoch ausgesprochen knapp und vage.4 Dieses Übergewicht des Historischen scheint mir für das Nachdenken über den Vater heute signifikant zu sein. Wir wissen gut darüber Bescheid, was der Vater früher gewesen ist. Was er aber heute sein könnte, das wissen wir nicht.
Dabei ist mir schon in den Vorarbeiten und in den Gesprächen, die ich mit Müttern und Vätern geführt habe, eine Klippe bewusst geworden, die nicht ganz leicht zu umschiffen ist. Wenn ich heute von den Rollen sprechen, die Vater und Mutter haben, kann das bei meinen Zuhörern die Vermutung wecken, ich würde eigentlich von den Rollen sprechen, die Männer und Frauen mit Kindern jeweils in ihren Familien spielen oder sogar spielen sollen. Diese Verwechslung von Rolle und Geschlecht liegt mir fern. Wenn ich von Vater und Mutter spreche, tue ich das vor dem Hintergrund einer idealtypischen Unterscheidung von komplementären Rollen, wie sie Psychologie und Gender-Forschung etabliert haben, und nicht, um festzulegen, welche Aufgaben Männer und Frauen erfüllen, geschweige denn erfüllen sollen.
Damit distanziere ich mich sowohl von den Versuchen, den Vater als pater familias in neuer Herrlichkeit wiederauferstehen zu lassen, als auch von den theoretischen Bemühungen, die Rollen von Vater und Mutter in einer geschlechtslosen Elternschaft aufzulösen. Beide fallen hinter das Unterscheidungsniveau zurück, das wir im Verständnis der kulturellen Codierung von Geschlechterrollen gewonnen haben. Während die Entdifferenzierung der Rollen meines Erachtens häufig dem Bedürfnis entspringt, die Festlegung von Männern und Frauen auf bestimmte Rollen dadurch zu vermeiden, dass man keine Unterscheidungen trifft, scheinen mir in der Restitution des alten Patriarchats nicht nur Borniertheit, sondern auch Verzweiflung am Werk zu sein. Denn die Reaktionäre verwechseln nicht nur die Rollen von Vater und Mutter mit denen von Mann und Frau, sie bedienen sich in der Beschreibung der Vaterrolle auch auf der Müllkippe patriarchaler Vorstellungen von der Familie und extremer Vorstellungen von Männlichkeit, die oft als Hypermaskulinität oder toxische Männlichkeit bezeichnet werden. Dazu gehören Härte und Stärke, Erfolg im Wettbewerb, Machtstreben, eine Verherrlichung von Gewalt und einer Abwertung von Frauen.5
Ich schlage vor, von beiden Extremen abzurücken: von den Vorstellungen extremer Männlichkeit und des Patriarchats wie auch von der Logik des Kapitalismus. Die mit dem Patriarchat verbundene Vorstellung des Vaters als Vertreter des Gesetzes, der moralischen Ordnung, der Vernunft, der Ökonomie – oder wie die großen Anderen alle heißen, von denen er seine Autorität beziehen soll – verstellt uns den Blick auf die Erfahrungen, die wir machen können, wenn wir in Familien zusammenleben. Und sie verhindern, dass die Väter geliebt, die Kinder erwachsen und die Familienmitglieder miteinander glücklich werden. Außerdem stehen sie den Ansprüchen von Männern auf ein emanzipiertes Leben entgegen. Dazu gehört etwa, frei von Leistungsdruck heranwachsen zu können, in ihrer Empfindsamkeit geschätzt und als Väter nicht von der Familie aus Mutter und Kind getrennt zu werden, wie der Schriftsteller Ralph Bönt in seinem Manifest für den Mann schreibt.6 Diese Ansprüche teile ich. Auch wenn ich die Vaterrolle nicht exklusiv als Männerrolle verstehe, glaube ich, dass das Fehlen einer angemessenen Vaterrolle die Emanzipation von Männern behindert, etwa in der Weise, wie die Dominanz einer bestimmten Mutterrolle die Emanzipation von Frauen behindert.7 Deshalb soll die hier vorgeschlagene Vaterrolle auch als ein Vorschlag an Männer verstanden werden, die sich wie ich vom tradierten Bild des Patriarchen emanzipieren, aber nicht einfach die Mutterrolle kopieren wollen.
Dass Letzteres tatsächlich auch kontraproduktiv wäre, belegen die Ergebnisse der modernen Bindungsforschung, die vorführen, dass Kinder idealerweise zwei verschiedene, komplementäre Bezugspersonen brauchen, um erwachsen zu werden: eine, mit der sie eine symbiotische Beziehung führen, und eine, die diese Beziehung in der Figur eines Dritten öffnet; eine, die sie zur Welt, und eine, die sie in die Gesellschaft bringt. Üblicherweise, und so verfährt auch die Bindungsforschung, nennen wir die eine »Mutter« und die andere »Vater«. Dabei abstrahieren wir von bestimmten Erfahrungen und spitzen eine Verhaltensweise extrem zu, um sie im Sinne einer binären Codierung des Verhaltens von der anderen Verhaltensweise unterscheiden zu können, die wir ihr idealtypisch gegenüberstellen. Viele Menschen, die im biologischen Sinne Mutter sind, finden sich in dieser Rollenbeschreibung wieder, insofern sie die Erfahrung einer symbiotischen Bindung an ihr Kind teilen. Im Umkehrschluss heißt dies allerdings nicht, dass Frauen mit Kindern, die diese Erfahrung nicht machen, keine Mütter sind, oder dass nur Frauen die Mutterrolle übernehmen könnten. Schließlich besteht diese in weit mehr als dem biologischen Vorgang, dass ein Kind im eigenen Körper heranwächst und aus diesem geboren wird. Außerdem entwickeln auch Menschen, die im biologischen Sinne Vater werden, eine symbiotische Bindung zum Kind – ein Vorgang, der sich auf der Ebene des Stoffwechsels beobachten lässt. So erhöht sich im Blut von Männern etwa der Spiegel des Bindungshormons Oxytocin, sobald sie wissen, dass sie Vater werden.8 Auch Väter werden kuschelig und ich meine, dass eine angemessene Rollenbeschreibung für diese Erfahrung offen sein muss, wenn sie Vätern nicht den Blick auf das Leben verstellen soll.
In der Praxis unterscheiden sich die Vater- und die Mutterrollen also nicht so kategorial, wie ich sie der analytischen Klarheit halber beschreiben werde. Hier können die Rollen von Vater und Mutter aber als Leitunterscheidung dienen, um die verschiedenen Anforderungen, die die Kindererziehung an Eltern stellt, zu beschreiben. Mit Vater- und Mutterrolle bezeichne ich also verschiedene Codes, die Versorgung und Erziehung des Kindes zu organisieren – auch wenn sie in der Praxis weniger scharf differenziert auftreten.9 Die unspezifische Rede von Eltern fällt hingegen hinter das von den Genderstudien etablierte Unterscheidungsniveau zurück. Wer so tut, als wären die Rollen von Vater und Mutter dieselben, verschleiert wichtige Unterschiede. Er ist in einer ähnlichen Weise ungenau wie jemand, der sagt, es gäbe nur Gemeinschaft und keine Differenzen im Hinblick darauf, wie diese Gemeinschaft organisiert ist. Wir wissen jedoch, dass das nicht stimmt. Eines der ältesten Strukturmodelle für eine Gemeinschaft ist (neben der Familie) die Brüderlichkeit. Sie liegt jeder Verbindung von mindestens zwei Menschen zugrunde, die sich gegen eine Dritte zusammenschließen, indem sie sie zur Feindin erklären. Das macht der älteste philosophische Text zum Thema deutlich, der in unserer Kultur überliefert ist, Platons Dialog Lysis. Platon spricht darin von der brüderlichen Gemeinschaft als einer Form der Freundschaft. So sagt Sokrates zu seinen Verbündeten »dass wir ihm freund sind wegen etwas dem wir feind sind. Würde aber dieses letztere fortgeschafft, so würden wir ihm, wie es scheint, nicht mehr freund sein.«10
Die Freunde verbrüdern sich gegen einen anderen; sie schließen sich zusammen, um diesen, dem sie feind sind, auszuschließen, und das macht sie zu Brüdern. Brüderlich zu sein heißt also, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Es ist eine politische Operation, aus der eine bestimmte Form von Gemeinschaft hervorgeht. Eine lange Tradition des politischen Denkens meint sogar, die Unterscheidung von Freund und Feind sei die grundlegendste politische Operation überhaupt.11
Es ist aber nicht die einzige. Wir können uns auch eine andere vorstellen, zum Beispiel eine, die nicht über Ausschluss, sondern Einschluss operiert. Eine Gemeinschaft, die nicht auf der Abwertung basiert, sondern auf der Anerkennung, die sich nicht gegen eine Andere bildet, sondern für etwas. Beispiele dafür sind die Demonstration oder das Ereignis, zu dem Menschen zusammenkommen. Und so, wie wir sagen, dass sich diejenigen, die sich gegen jemanden zusammenschließen, verbrüdern, können wir in Abgrenzung davon sagen, dass sich diejenigen, die sich für etwas zusammenschließen, verschwestern. Über das biologische Geschlecht der Beteiligten ist damit nichts gesagt. Genauso wie sich Frauen verbrüdern, können sich Männer verschwestern.
Mit den Rollen von Vater und Mutter verhält es sich ganz ähnlich. Sie sind unterschiedliche Formen, die Erziehung der Kinder zu prägen. Während sich Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit jedoch in ihren Gegensätzen ausschließen, sind die Rollen von Vater und Mutter komplementär. Und da sie komplementär sind, lassen sie sich im konkreten Verhalten von Menschen kombinieren oder treten gemeinsam auf, zum Beispiel bei Alleinerziehenden, denen in Ermangelung eines Dritten oft gar nichts anderes übrig bleibt, als beide Rollen zu übernehmen. Es sei denn, sie verfügen über ein größeres Umfeld von Personen, die sie bei der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder unterstützen können. Diese Art, die Kinder gemeinsam zu versorgen und zu erziehen, ist viel älter als der relativ moderne Rückzug auf die Kernfamilie von Vater, Mutter und Kind und hat dem Menschen, wie die Anthropologie zeigt, massive evolutionäre Vorteile gegenüber anderen Säugetieren verschafft, weil die Arbeit besser verteilt und die Geburtenrate stark erhöht werden konnte. Außerdem hatten auch diejenigen Gruppenmitglieder noch eine Aufgabe, die keine Kinder mehr gebären und keine Mammuts mehr erlegen konnten. Es gibt evolutionäre Anthropologen, die das als den Grund erachten, warum Menschen so alt werden und warum Babys so sympathisch lächeln. Die Alten leben noch, damit sie sich um die Kinder kümmern und die Babys lächeln, damit sich auch diejenigen um sie kümmern, die nicht mit ihnen verwandt sind.12
Womöglich hat sich diese anthropologische Erkenntnis auch Oma Lausch zu Herzen genommen, eine Figur aus Saul Bellows Roman Die Abenteuer des Augie March. Oma Lausch ist eine Witwe, die in der Nachbarschaft von Augie, seinen beiden Brüdern und seiner alleinerziehenden Mutter lebt und eines Tages bei ihnen einzieht, um die Familie zu unterstützen und selbst eine Aufgabe zu haben. Rechtlich gesehen ist Oma Lausch jedoch nur eine Untermieterin, wie Augie erklärt.
»Denn Oma Lausch gehörte nicht zu unserer Familie. Sie wurde von ihren zwei Söhne unterstützt, die in Cincinatti und in Racine, Wisconsin, lebten und deren Frauen keinen Wert auf die Anwesenheit ihrer Schwiegermutter legten. Diese, die Witwe eines mächtigen Geschäftsmanns aus Odessa […], Oma also zog es vor, bei uns zu leben, weil sie so lange daran gewöhnt gewesen war, einen Haushalt zu führen, zu kommandieren, zu regieren, zu organisieren, zu bestimmen, zu planen und in all den Sprachen zu intrigieren, die sie beherrschte.«13
Für die Familie ist der Einsatz dieses »Nebenstraßen- und Nachbarschafts-Machiavellis« Gold wert und auch die Eltern, die ich kenne, machen vom group breeding gerne Gebrauch, wenn sie können.14 Aber dass sich die Erziehung der Kinder unter glücklichen Umständen auf mehr als auf Vater und Mutter verteilt und dass keiner von ihnen unersetzbar ist, heißt nicht, dass wir die Rolle des Vaters nicht mehr analysieren müssten. Denn wir können etwas nur dann gut vertreten, wenn wir wissen, was es ist. Das gilt auch für die alleinerziehenden Eltern, die beide Rollen gleichzeitig spielen, sich in einer vertreten oder sie ausfallen lassen müssen. Wenn sie in diesem Essay nur selten thematisiert werden, dann nicht, weil ihnen eine marginale Bedeutung zukäme, sondern weil sich die Ausdifferenzierung von Mutter- und Vaterrolle in Familien mit zwei Elternteilen klarer beschreiben lässt.
Um die Vaterrolle so zu beschreiben, dass sie für die Zukunft taugt, müssen wir von der Logik des Kapitalismus abrücken. Das zeigen auch Versuche, die das Patriarchat aus dem Geist des Kapitalismus wiederauferstehen lassen wollen. Wenn wir nämlich ihre Argumentation konsequent zu Ende denken, führt sie nicht zu einer Auszeichnung der Vater-, sondern der Mutterrolle. Das liegt unter anderem daran, dass der Kapitalismus den Geschlechtern gegenüber indifferent ist. Ihm geht es darum, den Profit zu maximieren und dabei ist es ihm egal, ob sich das, was ausgebeutet wird, als Mann, Frau oder anderes darstellt. Die kapitalistische Auflösung der Geschlechterspannung (das heißt der gesellschaftlichen Erscheinungsform der biologischen Zweigeschlechtlichkeit) hat zum Teil positive Konsequenzen, etwa darin, dass sich geschlechtliche Identitäten etablieren können, die sich der binären Unterscheidung von Mann und Frau entziehen.15 Sie hat mit Emanzipation als Befreiung jedoch nichts zu tun, denn sie befreit Menschen nicht von der wertenden Unterscheidung, sondern ersetzt lediglich die geschlechtliche Unterscheidungslogik männlich/weiblich durch die kapitalistische Unterscheidungslogik rentabel/unrentabel. Dadurch entsteht ein neues Leiden und dieses Leiden befeuert Regressionsphänomene wie die restaurative Vaterherrlichkeit oder die neue Mütterlichkeit.
Der wichtigste Grund, von der utilitaristischen Logik des Kapitalismus abzurücken, besteht jedoch darin, dass eine Erziehung der Kinder, die allein im Sinne einer solchen Logik erfolgt, den Nachwuchs nicht für die Herausforderungen wappnet, welche die Zukunft bereithält. Denn die Logik des Kapitalismus hilft uns zwar, Knappheit zu regulieren, nicht aber, mit Verlusten umzugehen. Sie fördert ein Konkurrenzstreben auch da, wo es Kooperation bräuchte, und sie bindet unser Handeln in ein enges Netz von Interessen und Wettkämpfen ein, das es uns nicht erlaubt, die einzelnen Vollzüge unseres Handelns zu übersteigen, Mittel und Zwecke gegeneinander abzuwägen und unser Leben als ein Ganzes aufzufassen. Genau das bräuchte es jedoch, um den Veränderungen zu begegnen, die sich bereits ankündigen. Ich denke dabei etwa an die globale Erwärmung oder den Verlust der Hegemonie des Westens und des gewohnten Wohlstands. Diese Entwicklungen fordern von uns, mit Verlust umzugehen, Verminderung zu verkraften und Verzicht zu üben.
Die Logik des Kapitalismus zwingt uns hingegen, immer schneller und weiter nach vorne zu leben, ohne auf das Ende zu blicken. Sie verdammt uns zu einer Beschleunigung ohne Ziel. Dem entspricht ein Ideal des singulären, schönen und maximal erfüllten Lebens, das wir nur vom Anfang her betrachten und über dessen Ausbeute wir letztlich immer enttäuscht sein müssen. Das Leben als Goldmine, die es auszubeuten gilt.16 Wer sein Leben nur in der Steigerung erfasst, kann weder mit Verlusten umgehen noch Verzicht üben. Diese Aufgaben hält allerdings nicht nur jeder biographische Verlauf bereit, sie werden uns in Zukunft auch als Gesellschaft abverlangt werden. Wo aber könnten wir den Umgang mit entsprechenden Erfahrungen einüben, wenn die Logik des Kapitalismus und unser Ideal vom maximal erfüllten Leben sie ausschließen? Ich schlage vor, dass sich in der Figur des Vaters ein Ort für diese Auseinandersetzung findet, denn ich glaube, dass es eine Aufgabe der Väter ist, den Umgang mit Verlust und Verzicht wieder in unser Leben zu integrieren. Ebendas macht sie zu Vätern der Zukunft.
Väter profitieren dabei von der funktionellen Sonderstellung der Familie innerhalb der Gesellschaft, das heißt vor allem davon, dass sie zwar immer noch stark mit anderen Funktionssystemen der Gesellschaft verbunden ist und die primäre Sozialisation der Kinder leistet. Die Familie ist jedoch kein Abbild der Gesellschaft im Kleinen mehr, wie das in segmentären oder patriarchalen Gesellschaften der Fall gewesen ist.17 Deshalb kann sie einer anderen Logik als der des Profits folgen und einem anderen Ideal als dem der Singularisierung und Maximierung, deshalb kann sie eine andere Moral als die des Gesetzes etablieren und einen anderen Blick auf das Leben.
Dieser Blick übersteigt die konkreten Handlungsvollzüge und nimmt das Leben als Ganzes in den Blick. Damit unterstützen die Väter der Zukunft die Herausbildung einer Ordnung des Herzens, die uns motiviert, zu verwirklichen, was wir lieben, und zu lassen, was wir nicht ändern können. Die Väter der Zukunft sind furchtlose Gesellen, sie halten sich nicht an Recht und Ordnung (das ist nur etwas für Angsthasen), sondern ihre Nasen in den Wind. Sie blicken sehenden Auges in den Abgrund und vertreten das Ethos von Artisten. Nicht etwa trotzdem, sondern gerade dadurch machen sie aus ihren Kindern halbwegs anständige Menschen, die den Herausforderungen der Zukunft nicht nur mit der Hoffnung auf Wachstum und einer Erweiterung der Optionen begegnen können, sondern auch mit Demut und Verzicht, weil sie erkannt haben, dass das gute Leben nicht unbedingt das schöne Leben ist, aber dass das schöne Leben nur als gutes Leben genossen werden kann. Dies alles folgt nicht aus moralischen oder politischen Vorannahmen, sondern allein aus der Übertragung der Geschlechterspannung zwischen Vater und Mutter auf die Grundspannung des Lebens, das sich zwischen Geburt und Tod, Leben und Sterben erstreckt. Wenn es stimmt, dass der Essay, wie Robert Musil sagt, »die einmalige und unabänderliche Gestalt [ist], die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken annimmt«, dann ist der Gedanke, mit dem ich mich auf das offene Meer hinauswage, der, dass wir von der Mutter zu leben lernen und vom Vater zu sterben.18 Das Sterben lernen aber ist eine fröhliche Wissenschaft.
Kapitel 2: Die Abwesenheit des Vaters lastet wie Blei auf dem Leben
Die Vorgeschichte des abwesenden Vaters ist lang. Ich werde mich im Folgenden auf einige der wichtigsten Wegmarken und Einflussgrößen beschränken. Entsprechend grob muss mein Pinselstrich sein.
Einer der wichtigsten Gründe dafür, dass wir heute nicht mehr wissen, was ein Vater ist, ist die Erosion des klassischen Vaterbildes nach der französischen Revolution, in der mit dem König auch der Vater geköpft wurde, der diesen zu Hause vertrat. Was im Staat der König ist, so schrieb der deutsche Aufklärer Christian Wolff 1721, das ist in der Familie der Vater. Der eine sorgt für die Wohlfahrt und Sicherheit des Volkes, der andere für die seiner Familie.1 Dabei leitete sich die Autorität des Königs davon ab, dass er Gott vertrat, und die des Vaters, dass er den König vertrat. Die Analogie verlief aber auch andersherum. Der Vater war nicht nur ein kleiner König, sondern die Könige waren auch die »Väter von Familien« und Gott war der »Herr über die Kinder und Kindeskinder aller Generationen«, wie zum Beispiel der englische Jurist Robert Filmer behauptete.2 Nachdem sich jedoch die Demokratie oder – wie der englische Konservative Edmund Burke (1729–1797) schrieb: – die »französische Krankheit« wie die Syphilis in Europa verbreitet hatte, wurden nicht nur die Könige vollständig entmachtet, sondern auch die Väter ins Exil geschickt.
Eines dieser Exile, in dem der Vater bis heute haust, ist das Berufsleben. Nach dem deutschen Mikrozensus von 2017 sind nur 34 Prozent der Mütter im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in Vollzeit tätig, während dies für 94 Prozent der gleichalten Väter gilt. Dieser Beschäftigung wird größtenteils nicht zu Hause nachgegangen, wo Väter in ihrer Arbeit der Familie und vor allem den Kindern präsent wären, sondern an weit entfernten Orten, was diesen Lebensbereich der Sichtbarkeit entzieht. Arbeitswelt und Familienleben sind meistens getrennt.3
Mit der Verbannung in das berufliche Exil wurde der Vater nicht nur aus der Familie entfernt, er verlor auch eine zentrale Vorbildfunktion. Solange er – etwa in einer bäuerlichen Gesellschaft – vor den Augen seiner Kinder und mit ihnen zusammengearbeitet hatte, konnte er ihnen in dieser Arbeit ein Beispiel dafür geben, wie die Anforderungen des Lebens bewältigt werden können. Der Vater führte in seiner Arbeit vor, wie das Leben gelingt. Ein sehr altes, sehr liebevolles Beispiel dafür gibt der mittelhochdeutsche Dichter Wernher der Gärtner in seinem Versepos Helmbrecht aus dem frühen 15. Jahrhundert. »Lieber Sohn«, spricht der Vater zu seinem Kind, das ihn verlassen will, »führ du mir den Ochsen, wenn ich pflüge, oder pflüge und ich führe dir den Ochsen. So bebauen wir das Land. Und kommst du einst in die Grube, wird es mit guten Ehren sein wie bei mir selbst.«4
Allerdings stützt sich diese Vorbildhaftigkeit des Vaters auf die Annahme einer festen Ordnung der Welt, die der Vater vertritt und in die er seine Kinder einführt, beispielsweise durch die Arbeit. »Deine Ordnung ist der Pflug«, sagt der Vater zu seinem Sohn, als dieser aufbegehrt.5 Damit weist er nicht nur dem Kind seinen Platz zu, sondern verteidigt auch die Vorstellung einer hierarchischen Weltordnung, in der alles und jeder von oben her platziert wird. An der Spitze dieser Kosmologie steht Gott, weiter unten steht der Vater und auf halbem Weg dazwischen residiert der König. So wie Gott die Ordnung der Welt im Großen bewahrt, bewahrt sie der Vater im Kleinen, in der Familie. Er ist eine Abbreviatur des Kosmos.
In dem Maße, in dem die Glaubwürdigkeit dieser Kosmologie schwindet, erodiert auch die Vorbildfunktion des Vaters darin. Dass es heute für Väter viel schwieriger ist, mit ihrer Arbeit Vorbilder dafür zu sein, wie das Leben gelingt, ist also nicht nur den Veränderungen geschuldet, die die moderne Arbeitswelt mit sich brachte, sondern auch einer gewissen Unübersichtlichkeit, die daraus resultiert, dass wir uns nicht mehr so einfach an Gott als Zentralgestirn orientieren. Walter Lippmann hat für diese Orientierungslosigkeit nach dem monarchischen Patriarchat den Begriff der drift gefunden. »Wir haben«, so der Berater des amerikanischen Präsidenten am Vorabend des Ersten Weltkrieges, »die Autorität verloren. Wir sind emanzipiert von einer geordneten Welt. Wir driften […]. Wir sind heimatlos […]. Kein Seemann wagt sich je auf ein Meer hinaus, das ihm so unbekannt ist wie das Gebiet, in das der Durchschnittsmensch des 20. Jahrhunderts hineingeboren wird.«6
In einer Welt ohne Vater verlieren wir die Orientierung. Darauf hat schon der englische Philosoph Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury, um 1700 hingewiesen, als er sich in Anbetracht der großen Verunsicherung, die die frühe Neuzeit mit der Auflösung eines geschlossenen und theologisch fundierten Weltbildes ergriff, vorstellte, wie grausam und zerrüttet das Leben in einer »vaterlosen Welt« wäre, weil ihr die »Beziehung auf das Ganze« und die soziale Ordnung fehlten.7 An diesen Befund schließt eine lange Tradition von politischen Denkern an, die die Demokratie als eine orientierungslose und verdorbene Gesellschaft vaterloser Brüder beschreiben, während später dann eine Reihe von Psychologinnen die existenzielle Verunsicherung in einer »vaterlosen Gesellschaft« ausarbeiteten.
Mit dem Verlust des Patriarchats gingen eine Reihe zivilisatorischer Errungenschaften verloren, die vom Vater verbürgt worden waren und heute zunehmend vermisst werden. Dazu gehört zum Beispiel die Einsicht, dass wir alle aufeinander angewiesen sind und kooperieren müssen, wenn wir als Gesellschaft überleben und nicht in einen Kriegszustand verfallen wollen, in dem jeder gegen jeden kämpft und auch der Stärkste getötet werden kann.8 Max Horkheimer war einer der ersten, der darauf hingewiesen hat. Mit der Macht des Vaters, so konstatierte der Soziologe kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, verschwand nicht nur die Wertschätzung der Familie, sondern auch eine ganze Reihe von Einstellungen, die für unser Zusammenleben in der Gesellschaft und den »Zusammenhalt unseres kulturellen Systems […] unerbittlich notwendig« seien, allen voran die Einsicht in die »unmittelbare Abhängigkeit« unseres Lebens von der Gesellschaft.9
Vaterlosigkeit und Asozialität sind eng miteinander verbunden. Das liegt nicht nur am Siegeszug des modernen Individualismus und das heißt vor allem der Selbstsucht und Ichbezogenheit, zu denen er die Menschen erzieht, sondern auch an der verstärkten Enthemmung und Verantwortungslosigkeit, die daraus resultiert, dass die Bande der Generationen genauso aufgelöst worden sind wie der soziale Kitt der Gemeinschaft, die die Familien und Väter jahrhundertelang bereitgestellt haben. »Nach uns die Sintflut«, ist das Motto der »schrecklichen Kinder der Neuzeit«, die wie der französische Revolutionär Maximilien de Robespierre keine Väter mehr kennen, sondern nur noch Individuen. Sie glauben, sie hätten sich alles selbst zu verdanken und daher das Recht, die Welt in einem großen Gelage zu verprassen. Es gibt nur noch die Einzige und ihr Eigentum.10
Das ist der Standpunkt von Konsumentinnen, die vergessen, dass Menschen keine Schmetterlinge sind, bei denen eine Generation mit einem Tage geschlossen abtritt und die nächste an einem weiteren Tag auftritt, sondern dass wir uns »in einem unaufhörlichen Fluss befinden«. Das macht die Generationen voneinander abhängig – und weil sie voneinander abhängen, sind sie füreinander verantwortlich. Daran hat schon der schottische Philosoph David Hume (1711–1776) die französischen Revolutionäre erinnert und darauf weisen uns heute die Fridays for Future hin.11
Vaterlosigkeit unterstützt jedoch nicht nur die Etablierung des Konsumentenstandpunkts, sondern auch das Ideal der »harten Männlichkeit« und die Renaissance des soldatischen Typs, die heute wieder zu beobachten sind. Das wird dort deutlich, wo die Auffassung vom Mann als Krieger und hartgesottenem Kämpfer propagiert wird, wir es bei näherem Hinsehen aber mit sozialen Krüppeln zu tun haben, die ohne Vater aufgewachsen sind. Ganz ohne Umschweife führt das etwa Chuck Palahniuk in seinem Roman Fight Club von 1996 vor, der schildert, wie ein junger Mann unter den Belastungen des modernen Berufslebens eine psychotische Störung entwickelt, die dazu führt, dass er sich einen (für die anderen unsichtbaren) Freund einbildet, den er Tyler nennt. Er spaltet seine Persönlichkeit in diese beiden Figuren auf, ist mal der eine und mal der andere, und erschafft sich so in der Wahnvorstellung den Dritten, der ihm fehlt, weil er ohne jemanden aufgewachsen ist, der für ihn die Vaterrolle übernommen hätte. Mit diesem Dritten gründet er einen Club, in dem Männer sich prügeln, um dem Druck der Zivilisation zu entfliehen – den Fight Club. Der Roman ist mit Edward Norton und Brad Pitt in den Hauptrollen verfilmt worden und gilt seither als Referenzstück für die Etablierung einer neuen und vermeintlich echten, das heißt unkorrumpierten, Männlichkeit.12 Dabei wird jedoch nicht nur übersehen, dass keiner der Männer, die hier kämpfen, glücklich ist, sondern auch, dass es ihnen bald nicht mehr reicht, ihre Aggressionen mit verabredeten Prügeleien zu bewältigen: »Wir werden die Zivilisation zerstören, damit wir etwas Besseres aus dieser Welt machen können«.13 Das aber ist das Motto von Amokläufern.
Was ihnen an der Welt, in der sie leben, nicht gefällt, ist grosso modo dasselbe, was auch anderen nicht gefällt, die unter der kapitalistischen Ordnung leiden. Was sie aber von den anderen, die nicht Amoklaufen, unterscheidet, ist, dass sie ohne Väter aufgewachsen sind.
»Tyler hat seinen Vater nie gekannt.
Vielleicht ist Selbstzerstörung die Antwort.
[…]
Ich selbst habe meinen Vater sechs Jahre lang gekannt, aber ich kann mich an nichts erinnern. Mein Dad fängt ungefähr alle sechs Jahre in einer neuen Stadt eine neue Familie an. Das hat nicht viel mit Familie zu tun, es ist eher so, als wenn er eine Franchise-Firma aufbaute.
Was du beim Fight Club triffst, ist eine Generation von Männern, die von Frauen aufgezogen wurde.«14
Der Amokläufer, das zeigen auch Berichte über entsprechende Straftäter, ist meist ein vaterloser Geselle – also jemand, dem gegenüber die Vaterrolle (von wem auch immer) nicht im ausreichenden Maße gespielt worden ist. Dabei scheint ein bestimmtes Regime der Selbstverhärtung am Werk zu sein, das dazu führt, dass derjenige, der sich ihm unterwirft, auf Kränkungen und Enttäuschungen und überhaupt auf die Erfahrungen der Misshandlung und des Verlusts, die wir im Zuchthaus des Lebens alle machen, nicht anders reagieren kann als mit Gewalt. So entsteht ein soldatischer Typ des Mannes. Seine äußere, durch Drill und Zucht erworbene Verhärtung verdeckt seine innere Zerrissenheit, Grund- und Substanzlosigkeit. Er bildet kein »Ich« aus. Er wird, wie es Klaus Theweleit in Männerphantasien ausgedrückt hat, »nicht zu Ende geboren«, sondern verbleibt in dem Vorstadium, in das ihn die Geburt durch die Mutter entlassen hat. Die Geburt als soziales Wesen, die, so Theweleit, mit dem Vater vollzogen wird, findet nicht statt. Und das führt zu Kompensationen.15 »An die Stelle des ›Ichs‹ treten gesellschaftliche Organisationsformen. Das sind Institutionen wie das Militär oder die Partei, die unbedingten Gehorsam fordern; aber auch habitualisierte Verhaltensweisen wie Disziplin und Ordnungszwang«.16