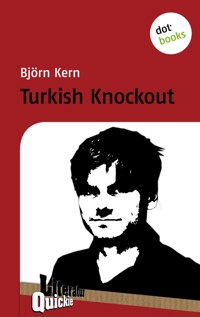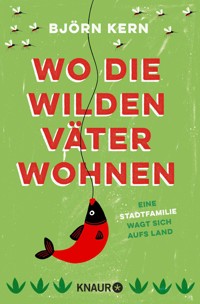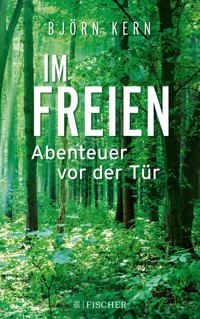12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Paar, so gegensätzlich wie Stadt und Land. Während er in Solikante nach einem abgeschiedenen Zufluchtsort sucht, sehnt sie sich nach Lebensfreude und der Weltläufigkeit des multikulturellen Lebens in Berlin: Dorfkrugtresen versus Großstadtnacht. Das Ende der Beziehung scheint besiegelt. Doch dann zeigt sich, dass das Leben als Singles alles noch schlimmer macht. Björn Kern verschränkt das Schicksal eines nicht mehr ganz jungen Elternpaares mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die seit einigen Jahren unser Land bestimmen. Voll aktueller Bezüge gelingt ihm ein Roman, der beides ist: das Abbild einer Gesellschaft, der die Mitte abhanden gekommen ist. Und das mitreißende Portrait eines Paares auf der Suche nach Heimat in einem tief gespaltenen Land. "Wer 'Unterleuten' von Juli Zeh gern gelesen hat, der sollte auf jeden Fall auch 'Solikante' lesen." Thalia Berlin-Gesundbrunnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Björn Kern
Solikante Solo
Roman
Über dieses Buch
Ein Paar, so gegensätzlich wie Stadt und Land. Während er in Solikante nach einem abgeschiedenen Zufluchtsort sucht, sehnt sie sich nach Lebensfreude und der Weltläufigkeit des multikulturellen Lebens in Berlin: Dorfkrugtresen versus Großstadtnacht. Das Ende der Beziehung scheint besiegelt. Doch dann zeigt sich, dass das Leben als Singles alles noch schlimmer macht.
Björn Kern verschränkt das Schicksal eines nicht mehr ganz jungen Elternpaares mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die seit einigen Jahren unser Land bestimmen. Voll aktueller Bezüge gelingt ihm ein Roman, der beides ist: das Abbild einer Gesellschaft, der die Mitte abhanden gekommen ist. Und das literarisch genaue Portrait eines Paares auf der Suche nach Heimat in einem tief gespaltenen Land.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Björn Kern, 1978 geboren im Südschwarzwald, lebte über zehn Jahre in Berlin und ist nun mit seiner Familie ins Oderbruch gezogen. »Das Beste, was wir tun können, ist nichts« wurde zum Bestseller. Für seine Romane erhielt er u.a. den Brüder-Grimm-Preis und das Casa-Baldi-Stipendium der Villa Massimo sowie, für einen Auszug aus »Solikante Solo«, das Brandenburgische Literaturstipendium.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S.Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andrea Janas
Coverabbildung: Martin Rügner/Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491187-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
ERSTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
ZWEITES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
DRITTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
VIERTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
FÜNFTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
SECHSTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
SIEBTES KAPITEL
1. Kapitel
2. Kapitel
Dank
Für S.
ERSTES KAPITEL
1.
Seit ihrer Trennung war Ruth vor allem eines: in Eile. Auch jetzt war sie wieder eine halbe Stunde zu spät. Es regnete, sie stand an der Ampel und ließ sich nassspritzen von den Taxen, die beinahe im Sekundentakt über die Potsdamer Straße rauschten, doch keines hielt an. Die Taxischilder auf den Dächern der Limousinen waren ausgeschaltet, die Rückbänke alle schon besetzt.
Auf der anderen Straßenseite standen zwei Prostituierte, die sie vom Sehen kannte, sie strahlten eine Gelassenheit aus, um die Ruth sie beneidete. Als ein Doppeldecker der BVG direkt vor ihr vorbeifuhr und eine Wolke warmer Dieselluft unter ihren Filzmantel kroch, ging sie einen Schritt zurück und hielt unwillkürlich die Luft an. Nun fing sie auch schon so an. Sie suchte ihr Handy. In der Manteltasche. In der Hosentasche. Fand es zu ihrer eigenen Überraschung in der Brusttasche ihrer Bluse.
»Kate? Du, ich noch mal, die halbe Stunde reicht mir nicht. Es wird noch später. Kauf doch einfach schon mal die Karten, ja? Ich lad dich dann ein.«
»Ich dachte, Carlotte wär jetzt endlich da?«, sagte Kate.
»Ist sie ja auch. Aber ich krieg einfach kein Taxi.«
»Kein Wunder, bei dem Regen.«
»Da, endlich. Ich muss auflegen. Und, Kate? Es tut mir leid.«
Im Taxi wischte sie sich den Regen aus dem Gesicht und aus den Augen, schminkte den eben erst aufgetragenen Lidstrich ab und zog ihn neu nach, der Fahrer immerhin ließ sie in Ruhe.
Sie hatte Kate schon bei ihrem letzten Treffen warten lassen und sie bei ihrem vorletzten sogar versetzt. Es war nicht ihre Schuld, dass die beste Babysitterin, die sie finden konnte, zugleich die unzuverlässigste war. Sobald Carlotte in der Wohnung war, konnte Ruth entspannen. Dann nahm Carlotte die Kleine auf den Schoß und balgte und schmuste mit ihr und las ihr vor, bis sie schlief. Aber bis sie mal da war? Kurznachricht über Kurznachricht. Anrufe. Absagen. Absagen der Absagen. Und immer alles in letzter Minute.
Sie zahlte den Fahrer mit einem Schein, ohne sich das Restgeld herausgeben zu lassen, und lief ins Babylon, den Arm als Regenschutz vor das Gesicht gelegt. Das Foyer war menschenleer, ein ungewohnter Anblick, wo sich sonst die Menschenschlangen vom Kartenschalter zum Biertresen schoben und von dort weiter in den Kinosaal. Inmitten der Leere, an einem einzelnen Bistrotisch, saß Kate.
Sie winkte mit zwei Abreißkarten.
»Der Film hat vor zwanzig Minuten angefangen«, sagte sie zur Begrüßung. Sie sah dünn aus. Ihr Haar war in eine aufwändige Hochsteckfrisur gezwängt.
»Lassen sie uns nicht mehr rein? Es tut mir leid, Kate.«
»Doch, schon, aber es ist ein Almodóvar.«
»Kate, es tut mir leid. Was soll das heißen, ein Almodóvar?«
»Das ist Kunst, verstehst du, das guck ich doch nicht ab Minute fünfundzwanzig. Das ist kein Tatort.«
»Kate. Nun sei doch nicht so. Lass uns rein. Bitte. Und danach lad ich dich zu einem Pernod ein. Wie früher, ja?«
»Nein. Wir sind zu spät. Also, du. Aber gib mir jetzt bloß kein Geld für die Karten.«
Sie gingen dann nach nebenan, in die Teufelsbar, in deren Fensterfront sich die Kerzen zu immer wilder wuchernden Wachsbergen auftürmten. Die Scheiben selbst waren beschlagen, ein leichter Alkoholgeruch schlug ihnen entgegen, als sie das Halbdunkel betraten.
»Fenster oder Tresen?«
»Scheint mir eher ein Tresenabend zu werden.«
»Pernod?«
»Doppelt, ja.«
Sie bestellte und nahm Kate den nassen Mantel ab und hängte ihn an den Garderobenständer, fragte, ob Kate etwas essen wolle, sie lehnte ab, Ruth bestellte Oliven, wenigstens das.
»Sind bio«, sagte der Barmann, als er das Schälchen vor ihnen abstellte.
»Das ist mir so was von egal«, sagte Ruth.
Sie aß. Die Oliven schmeckten ranzig, was sie in ihrem Urteil über korrekt erzeugte Lebensmittel bestätigte. Wie sollte etwas frisch sein, wenn es so fürchterlich korrekt war? Da entschied sie sich lieber für inkorrekt und frisch. Korrekt und ranzig hatte sie in ihrer Ehe lange genug gehabt.
»Ich bin von der Praxis direkt zur Kita und von der Kita zu Netto, und an der Kasse hat Sisal dann einen Heulkrampf bekommen, weil wir die Cornflakes vergessen hatten. Hinter uns eine Riesenschlange. Am Ende hab ich gezahlt und mich noch mal angestellt für die Cornflakes, zu Hause hab ich dann Essen gemacht für Sisal, und dann hat auch noch Jann angerufen, und –«
»Ich hab ihn neulich auf Radio Eins gehört.«
»Mit der Stelle, wo er lallt?«, fragte Ruth.
»Nein, die haben sie rausgeschnitten. Er kam eigentlich ganz sympathisch rüber.«
»Ja. Weil’s ne Wiederholung war. Von früher.«
Ruth überlegte, ob Kate absichtlich keine von den Oliven aß. Was wollte sie ihr damit sagen?
Kate sah sie nicht einmal mehr an.
»Und sonst, Sisal? Kann schon lesen?«
»Ich wollte heute eigentlich nicht von Sisal reden«, sagte Ruth.
»Du willst von nichts anderem reden. Nun sag schon, liest sie? Goethe? Heidegger?«
»Kate, hör auf damit. Lass uns einfach Pernod trinken.«
»Ich mag sie trotzdem. Ist ja nicht ihre Schuld.«
»Nicht ihre Schuld, dass sie so eine schreckliche Mutter hat?«
»Das wird doch heute nichts mehr, Ruth. Ruf mich an, wenn du mal einen Abend lang Zeit hast. Zeit haben? Zuhören? Weißt du noch, was das ist?«
»Kate, bleib. Wenn du jetzt aufstehst!«
»Dann was? Dann war’s das? Weißt du was? Seit du da raus bist, in dieses fürchterliche Oderkaff, war’s das doch längst. Seit du mit Jann bist. Mit Sisal oder Nichtsisal hat das alles gar nichts zu tun. Verstehst du? Ich brauche kein Kind!«
Sie wusste nicht, ob der türkische Barmann sie belauscht und sich beeilt hatte, oder ob es ein Zufall war, jedenfalls standen im nächsten Moment zwei doppelte Pernods vor ihnen, in den schönen Originalgläsern, mit Eiswürfeln und einer beschlagenen Karaffe kalten Wassers. Der Anisduft stieg ihr sofort in die Nase, stieg auch Kate sofort in die Nase, sie verharrte, bereits im Stehen, musterte den Pernod, musterte ihre beste Freundin, lächelte, musste einfach lächeln, setzte sich und stieß mit Ruth an. Ruth atmete durch. Wenn sie auch Kate noch verlor, war sie am Ende.
»Wie geht es denn dir?«, fragte sie. Da fing Kates Kinn auf einmal so seltsam an zu zittern, Tränen stiegen ihr in die Augen. Ruth beugte sich zu ihr, wollte sie in den Arm nehmen, doch da klingelte ihr Telefon.
Carlotte. Mist.
»Tut mir leid. Muss ich ran. – Ja? Carlotte?«
»Sie hat sich im Bett übergeben. Es ist alles braun. Die Laken, das Kissen. Es tut mir leid, aber sie will dich sehen.«
Ruth blickte Kate an, die sich die Tränen aus den Augen wischte, und sagte in den Hörer, sagte Kate ins Gesicht:
»Ist gut. Ich bin in einer halben Stunde bei euch.«
»Wär besser«, sagte Carlotte. »Sie sagt, sie hat den ganzen Abend nur Eis gegessen? Stimmt das? Eis zum Abendessen?«
Ruth legte auf.
»Sag nichts jetzt«, sagte Kate. »Sag jetzt einfach mal nichts.«
Später am selben Abend war Ruth schließlich in Sisals Armen eingeschlafen. Und Sisal in ihren. Sie hatte den warmen, kleinen Schlafatem des Kindes auf ihrer Wange gespürt, die nachtschlaffen Fingerchen in ihrer Hand, und sie hatte sie angeschaut, immer nur angeschaut, die geschlossenen Augen mit den feinen Wimpern, den blassen Mund. Sobald sie zu Hause angekommen war, hatte sich Sisals Übelkeit in Luft aufgelöst und war durch den Schornstein geflogen.
»Geht das denn?«
»Was denn, mein Bienchen?«
»Dass Bauchweh fliegt?«
»Hast du denn noch Bauchweh?«
»Nein.«
»Na, dann ist es wohl weggeflogen.«
»Aber wir haben gar keinen Schornstein. Nur Papa hat einen.«
»Dann ist es eben durch das Fenster geschlüpft.«
»Obwohl es zu ist?«
»So ein bisschen Bauchweh, das passt schon noch durch.«
Sie fürchtete sich schon heute vor dem Tag, an dem ein Einschlafen mit Sisal nicht mehr möglich war. An dem sich Sisals junge Glieder nicht mehr willfährig mit den ihren verflechten ließen. Immerhin war Sisal ein Mädchen. Das würde den Tag hinauszögern. Doch eines Tages würde auch Sisal sagen: »Mama, das ist peinlich.« Oder gleich: »Mama, du stinkst.« Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal ohne ihre Tochter entspannt eingeschlafen war. Wenn Sisal bei Jann war, konnte Ruth gar nicht schlafen, sondern guckte sich müde. Netflix. Die Mediatheken. Sie entspannte dann nicht, sondern erstarrte und dämmerte irgendwann weg, während Netflix in zehn, neun, acht Sekunden von allein die nächste Folge vor ihren geschlossenen Lidern abspielte.
Als die Weckfunktion des Handys sie aus dem Schlaf riss, lag kein Kleinkind neben ihr im Bett, sondern ein kleiner, warmer Stein. Komplett bewegungslos. Wecken unmöglich. Sie rollte auf Sisals Seite hinüber, auf Janns Seite, wie sie sie immer noch nannte, und nahm Sisal fest in den Arm. Keine Reaktion. Sie streichelte ihr die langen, blonden Haare aus der Stirn. Leichtes Nasekräuseln. Sie küsste Sisal auf den Mund. Energisches Wegdrehen des Kopfes, Embryohaltung.
»Binnomüde.«
»Guten Morgen, mein Bienchen.«
»Nobisschenschlafn.«
»Wir müssen aufstehen. Die Kita.«
»Mh-mh.«
Das Handy klingelte ein zweites Mal. Schon zehn Minuten weg. Zehn Minuten von einem entspannten Morgen mit ihrer Tochter. Sie beugte sich über Sisal und blies ihr sanft über das Gesicht. Stirnkräuseln. Ein leichtes Kinderschnarchen. Dann summte sie Sisal ins Ohr. Sisal zerrte an ihrer Bettdecke und verschanzte sich darunter, parierte den morgendlichen Angriff durch erneutes Totstellen.
Mist, schon Viertel nach. Sie wusste, wie das endete. Mit Tränen. Oder Geschrei. Sie hatte keine Lust mehr, die Organisierte, die Genaue, die Strenge zu sein, nur weil Jann an den wenigen Tagen, die er seine Tochter noch sah, alle Regeln für abgeschafft erklärte. Aufstehen? Warum nicht liegen bleiben. Ins Bett gehen? Warum nicht aufbleiben. Dreimal am Tag Nudeln mit roter Sauce? Warum nicht. Dreizehn Folgen Benjamin Blümchen hintereinander? Wo ist das Problem.
Es war einfach, der ruhige, der verständnisvolle Papi zu sein, wenn man sein Kind kaum noch sah. Seit dem Sommer füllte Jann eher die Rolle des Großvaters aus, der seiner Enkelin hin und wieder Schokolade zusteckte, wenn die Mutter gerade nicht hinsah.
Sie fasste einen Entschluss. Ihr fehlte die Kraft, ihre Tochter erneut durch alle ermüdenden Morgenabläufe zu schleusen, durch Zähne putzen und Spängchen suchen, durch Milch austrinken und Brot nicht aufessen. Heute setzte sie einfach mal aus. Wählte den Exitplan.
»Komm, Bienchen, heut frühstücken wir draußen. Im Café!«
»–«
»Du kriegst einen Kakao. Und eine Müslistange, die magst du doch so.«
»–«
»Freust du dich? Komm, wir gehen los!«
»–«
Sie trug Sisal schlafend ins Bad und setzte sie auf die Toilette, stützte sie, damit sie nicht herunterfiel, und hoffte, dass zumindest ihr vegetatives Nervensystem ansprang, Gleichgewicht, Blasenentleerung, und Sisal dadurch in einen annähernd der Wachheit entsprechenden Zustand fand. Doch keine Chance. Sisal sackte immer wieder zur Seite. Drohte von der Klobrille zu sinken. Und schnarchte leise.
Zwanzig Minuten später standen sie endlich unten in der Potse vor der Ampel, Sisal noch immer in einem tranceähnlichen Zustand, immerhin war sie die vier Stockwerke nach unten selbst gegangen, hatte brav einen Fuß vor den nächsten gesetzt. Die Fußgängerampel stand noch immer auf Rot, der morgendliche Berufsverkehr rollte langsam in beide Richtungen, darüber ein leichter, feiner Regen, beinahe Nebel, der dem Verkehr eine beruhigende, stille Haube gab.
»Was machst du denn da, Bienchen?«
»Papa hat gesagt, man soll das nicht atmen.«
»Lass den Quatsch, Sisal. Nimm sofort den Pulli wieder runter. Man muss nicht durch einen Pulli atmen.«
»Auch nicht, wenn man an einer Ampel steht?«
»Auch nicht, wenn man an einer Ampel steht.«
»Aber es stinkt.«
Es stank tatsächlich. Verdammt nochmal, ja, es stank. Aber wie lange atmeten sie das? Eine Minute? Zwei? Sie ließ sich nicht einreden, sie sei eine schlechte Mutter, nur weil ihr Kind in einer deutschen Großstadt eine Minute an einer Verkehrsampel stand.
Jann hatte so viel kaputtgemacht, mehr, als ihm eigentlich bewusst war. Er hatte sie von innen ausgehöhlt, wie es die Tumore taten, vor denen er solche Angst hatte. Wenn sie von etwas krank wurde, dann von ihm, von der ewigen Grübelei, von der schlechten Laune, von seinem beständigen Leid an dieser bösen Welt. Das bisschen Ruß, das da vor ihr aus dem Auspuff einer Kehrmaschine drang, war dagegen absolut zu vernachlässigen.
Die türkische Bäckerin begrüßte sie wie eine Freundin. Sie mochte das. Diese unkomplizierte Herzlichkeit. Morgens angelächelt werden, auch wenn man nur eine ganz gewöhnliche Kundin war. Das kannte sie nur von den Türken. Keine deutsche Frau, mit der sie nicht befreundet war, lächelte sie morgens um diese Uhrzeit an.
»Einen Kakao und einen Kaffee, bitte.«
»Kakao kalt oder warm?«
Sie sah auf die Uhr, die über dem Verkaufstresen hing.
»Kalt, bitte.«
»Nein, warm«, sagte Sisal.
»Wir sind spät dran. Wir haben getrödelt.«
»Ist ganz schnell«, sagte die Bäckerin.
Sie nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit nachzufragen, wie die Bäckerin eigentlich hieß. Sie setzten sich an den kleinen Bistrotisch in der Ecke vor dem Kühlregal, in dem Milch und Butter auslagen, Käsescheiben und alkoholfreie Getränke. Ein richtiger Morgenladen war das. Kein Alkohol, keine Zigaretten. Irgendwie auch mal nett.
»Ich dachte, ich krieg eine Müslistange«, sagte Sisal.
»Ach, ja, und noch eine Müslistange, bitte.«
»Leider«, sagte die Bäckerin.
Sie musste schmunzeln. Ein Glück, dass Jann nicht neben ihr stand. Der hätte den Satz allen Ernstes richtiggestellt. »Ist leider aus.« Oder: »Haben wir leider nicht mehr.« Natürlich hatte er recht. Aber was um alles in der Welt war daran so wichtig? Ihr war eine freundliche, türkische Verkäuferin mit kreativen Deutschkenntnissen lieber als die muffige Berlinerin vom Netto, die auch kein Deutsch konnte, sondern »Hamwa nich« murmelte und dabei den Blick nicht von ihren rosa Fingernägeln nahm. Zugegeben: Rosa lackierte Fingernägel hatte die türkische Bäckerin auch.
»Kein Problem. Dann ein Simit, bitte.«
»Kommt es sofort.«
Das war doch schön, dass Sisal schon mit fünf wusste, was ein Simit war. Sie selbst hatte es erst mit dreißig gelernt. Sisal mochte Simits. Und die Sesamkörner trugen sicher zu einer morgendlichen Grundversorgung an Mineralstoffen bei. Dazu das Calcium im Kakao. Das bisschen Zucker, geschenkt. Sie wollte nur das Beste für ihr Kind, ihm alles anbieten, ihm alles ermöglichen, ihm alle Wege öffnen.
Sie wollte es bunt haben für ihr Kind und es niemals der Enge aussetzen, die sie selbst erlebt hatte, in ihrem Tal in der Eifel. Wenn Sisal sich später entscheiden sollte, in der Provinz zu leben, auch in Ordnung. Aber bis dahin sollte sie das andere Leben wenigstens kennengelernt haben. Die Dreadlocks und Graffiti. Den sudanesischen Imbiss und den Ramadan. Die Bongos im Kleistpark und die Einradfahrer. Die melancholischen Banjospieler in der U-Bahn und den Berber, der ihr vorm Netto stets das Fahrrad hielt, wenn sie die Einkäufe darauf hievte. Das Hammelgrillen und Fastenbrechen. Den Wasserpfeifengeruch, der aus den türkischen Kaffees herausdrang, und die rund um die Uhr feiernden Touristen.
Die fein zurechtgemachten Punks und die etwas verwahrlosten Omas, die mit ihren Pudeln sprachen. Den Eckladen, in dem man nicht rauchen durfte und in dem alle rauchten. Die Boulespieler, die billigen französischen Rotwein tetrapakweise leerten und als Alibi hin und wieder eine der schweren Eisenkugeln vor ihre Füße fallen ließen. Die stolz Tätowierten, die aus ihren Gesichtern, Armen, Nacken und Rücken Kunstwerke machten, die niemals fertig wurden.
Den Inder, der im Kleistpark sein Papadam verkaufte, »Papa-Papa-Papadam!«, »Papa-Papa-Papadam!« Die Sintifamilien, die in aller Öffentlichkeit kochten und zankten, liebten und schliefen. Die jungen Modestudentinnen in ihren Stiefeln und schräg geschnittenen Mänteln. Den kleinwüchsigen, armenischen Friseur, der den Bürgersteig vor seinem Laden dreimal am Tag fegte.
Die Gewürzläden mit den soukähnlich aufgetürmten Auslagen, mit Safran und Kümmel und Kardamom, mit Minze und Chili und Paprikapulver. Die Ladengeschäfte mit dem Turkish delight, den gerösteten Mandeln und Dattelbällchen und Aprikosenkugeln mit Pekannuss. Der türkische Honig zum britischen Breakfast in der französischen Bäckerei. Die Saftpressen auf dem Bürgersteig, Orange, Apfel, Karotte oder auch Rote Beete, Kohlrabi, Ingwer, mit oder ohne einem Schuss Olivenöl. Die Souterrainpizzerien, die auf den Bürgersteig hochdufteten, betrieben von Ägyptern, die alle deutschen Arbeitslosen, die sich als Muslime ausgaben, umsonst bedienten. Das Coffee-Bike auf dem Mittwochsmarkt mit seinen Obstauslagen und Gemüsestiegen. Die Frisbeespieler. Die Jongleure. Die Bauchtänzerinnen.
Die wohlerzogenen Dealer, die jeden, der ein Kind an der Hand führte, nicht nur in Ruhe ließen, sondern freundlich grüßten. Die Geschäftsleute, die den ganzen Tag rannten, und dann, am Abend, wenn sie sich umsahen im Kiez, ihre Krawatten, ihre Blusen lockerten und so bewusst ihren Gang verlangsamten, dass es aussah, als würden sie bremsen. Die Kinder mit den zwei Vätern, die Mütter mit den zwei Männern. Die einsamen Alten mit ihren Gebetsketten, die einsamen Jungen mit ihren Handys. Die Spontanpartys vorm Spätkauf.
Die türkischen und die arabischen Eltern in der Kita. Die kroatisch-russischen Eltern. Die norwegisch-kirgisischen Eltern. Die französisch-peruanischen Eltern. Das Zuckerfest und Ostern. Chanukka und das Kirschblütenfest. Das Opferfest und die Fête de la musique. All das feierten sie in Sisals Kita, all das kannte sie schon. Die Frauen mit Kopftuch und die Männer im Wickelrock, auch die nickte sie ganz gelassen ab, wie auch die beinahe anrührende Tatsache, dass all das Platz hatte in dieser großartigen, lebendigen Stadt.
Nichts erschien Sisal seltsam, auf nichts reagierte sie mit einem »Guck mal, was ist denn mit dem los?« Für Sisal war es normal, dass alle anders waren. Darauf war Ruth, die Sisal diese Freiheit überhaupt erst ermöglicht hatte, stolz. Zu sagen, dass man das Andere nicht ablehne, war einfach. Das Andere tatsächlich nicht abzulehnen war dagegen schwer.
Sie dachte an Sisals Vater. Was, wenn Jann irrte? Wenn seine ewigen Messungen schlicht nicht stimmten, denen er, ausgerechnet er, verfallen war wie einer unantastbaren Gottheit, einer heiligen Größe, einem Absolutum, das er doch eigentlich gestürzt zu haben glaubte, oder nicht?
Mister Aufklärung schien auf einmal gläubig geworden zu sein. Mister »multiple Perspektive«. Mister »von unten betrachtet ist der Kegel aber ein Kreis«. Auf einmal hatte nichts mehr einen doppelten Boden. Auf einmal gab es wieder richtig und falsch, in seinem Leben. Drinnen und draußen. Stadt und Land. Türkisch und deutsch. Ruth verstand ihn nicht. Ja, die Welt war unübersichtlich geworden. Aber sie wurde doch nicht übersichtlich, indem man in ein Dorf zog. Dort bekam man keinen Überblick, dort blendete man aus. Darum ging es doch am Ende. Ums Ausblenden. Ums Ordnen. Um ein schales bisschen mehr Übersicht. Um einen Schutzraum. Und nicht, wie Jann behauptete, um reine Luft für ihr Kind.
Mikrogramm pro Kubikmeter.
Brüssel. WHO. Grenzwert.
Altlasten. Asbest. Bodenproben.
Sie konnte es nicht mehr hören.
Aber wo blieb denn nun der Kakao? Sie sah auf die Uhr über dem Verkaufstresen. Viertel nach acht. Punkt halb neun würde ein Schild an der geschlossenen Kitatür hängen »Morgenkreis. Bitte nicht stören!« Eltern, die zu spät kamen, durften ihr Kind dann erst wieder um neun bringen. Abliefern, wie Jann gesagt hätte. Verdammt nochmal, was war nur los heute Morgen? Konnte sie nicht einen einzigen Gedanken fassen, in dem Jann nicht vorkam? Wenn sie den Morgenkreis verpasste, wäre sie erst um halb zehn in der Praxis. Ganz schlecht. Denn heute kam Roland F., ein nicht ganz einfacher Klient. Danach war Teamsitzung. Danach eine Supervision. Und sie befand sich noch immer in der Probezeit.
»Entschuldigung? Entschuldigung!«
»Ja, bitte?«
»Haben Sie den Kakao schon gemacht, sonst würd ich den lieber abbestellen. Wir müssen leider los!«
»Gleich fertig. Die Milch muss noch warm!«
»Nein, das geht nicht. Wir müssen sofort los. Leider.«
»Ohne Kakao geh ich nicht in die Kita«, sagte Sisal.
»Können wir ihn vielleicht mitnehmen?«
»Zum Mitnehmen? Aber gern.«
Sie bat die Bäckerin, auf den heißen Kakao kalte Milch zu gießen, damit er wieder kalt würde und Sisal sich nicht an ihm verbrannte, dann drückte sie einen Plastikdeckel auf den Kartonbecher, nahm Sisal an die Linke, den Kakao in die Rechte. Ihr gemeinsames Frühstück war ohnehin nur ein kleines Ritual. Gleich nach dem Morgenkreis gab es in der Kita Müsli, Brötchen und Milch.
Die Kita Zwergenaufstand lag in der Gardenerstraße, einer verkehrsberuhigten Seitenstraße. Gardenerstraße. Der Name gefiel ihr. Ein gutes Omen, wie sie fand. Eine Oase in der Steinwüste. Ein richtiger, kleiner Stadtgarten, in dem die Kinder sprossen und den Aufstand probten. Zwei Minuten vor halb neun erreichten sie den Gruppenraum. Die anderen Kinder saßen schon im Morgenkreis. Sie knöpfte Sisals Mantel auf und zog ihr vorsichtig die Schuhe von den Füßen, dann schob sie sie durch den Türspalt.
»Und der Kakao?«
»Du kriegst heute Abend einen neuen, mein Bienchen!«
Sie küsste ihr Kind. Sie küsste es nochmal. Und nochmal. Umarmte es. Malte ein Herz in die Luft. Sisal strahlte. Ruth drehte sich um und lief zu ihrem Elektroroller, der neben der Kita parkte, goss den Kakao in einen Gully und warf den Becher in den nächsten orangen Mülleimer. Während sie am Sicherheitsschloss ihres Rollers nestelte, bekam sie eine Kurznachricht. Sie sah auf ihr Handy, falls Roland F. abgesagt hatte.
Doch es war Kate.
2.
Nebel lag über dem Land, das Land war weit. Knorpelige Äste einzelner Obstbäume. Apfel. Birne. Kirsche. Sonst nichts. Jann ging in Richtung Oder. Der Feldweg war grob geschottert, hin und wieder lief er über gebrochene Asbestplatten, die jemand hier entsorgt hatte, oder über kleine Berge von Schutt. Es war eine grobe, angegriffene Landschaft. Nichts stimmte. Feldwege. Äcker. Gräben. Alles wirkte versehrt.
Sein Handy vibrierte in seiner Parkatasche. Er fischte es heraus, wollte es ausstellen, doch dann sah er die Nummer.
»Papa?«, fragte sein Kind.
»Sisal. Mein Engel.«
»Papa?«
»Ja, ich bin dran.«
»Bist du das, Papa? Papa?«
Er legte auf und rief zurück. Ein nicht funktionierendes Handynetz, so etwas regte ihn schon lange nicht mehr auf. Es gab weitaus wichtigere Dinge, die in seinem Leben nicht funktionierten.
»Papa?« Sein Kind schluchzte. Aber die Verbindung stand.
»Ja, mein Engel.«
»Warum hast du einfach aufgelegt?«
»Ich konnte dich kaum hören.«
»Ja, aber warum hast du aufgelegt?«
»Wein doch nicht. Ich verstehe nichts, wenn du weinst.«
»Ich darf Sonntag kommen. Oder übermorgen, oder wann Mama gesagt hat.«
»Wie schön. Dann machen wir ein großes Indianerfeuer! Oder willst du lieber eine Hütte bauen?«
»Mama kommt jetzt. Willst du mit ihr reden?«
»Ich? Nein, ich glaub nicht.«
»Und du? Mama? Willst du mit Papa reden?«
»Was sagt sie?«, fragte er.
»Aber warum? Warum soll Papa nicht mehr hier anrufen?«
»Lass gut sein, mein Engel. Ist schon gut«, sagte er.
»Ich soll auflegen, Papa. Ich will aber deine Stimme hören!«
»Ist schon gut. Wir sehen uns. Leg ruhig auf.«
»Papa! Nicht auflegen! Nicht auflegen, Papa!«
»Ich lege nicht auf.«
Er hörte das Kind weinen, dann hörte er, wie es Tschüs, Papa sagte, und dann legte es auf. Er wartete einige Sekunden, dann steckte er das Handy in die Parkatasche und wärmte sich die vom Telefonieren klammen Finger auf. Der Feldweg näherte sich dem Bahndamm. Von Westen zog ein langes, donnerndes Stahlband aus rostfarbenen Loren vorüber. Schlagen der Räder. Quietschen der Kupplung. Eisiger Spurwechsel, dann langgezogenes Bremsen, offenbar ein rotes Signal oder ein Abstellgleis.
Einmal hatte er zuerst aufgelegt, danach nie wieder. Sisal hatte zurückgerufen, nicht gleich, sondern nach einigen Minuten, weil ihre kleinen Finger zu sehr zitterten, um richtig zu wählen. Du darfst nicht auflegen, Papa. Nie wieder. Versprich mir, dass du nie wieder auflegst.
Er stieg auf den Bahndamm und sichtete das Gleis. Von Osten näherte sich der Siebzehn-Uhr-Zug. Ein dieselbetriebener, gelb leuchtender Lindwurm, unter einem grauen Himmel, kaum größer als ein Stadtbus. Jann stieg ins Gleisbett und folgte den Bahnschwellen nach Westen, den nahenden Zug in seinem Rücken. Er drehte sich nicht mehr um. Ließ den Zug näher kommen. Immer näher. Erst, als der Zugführer das Signalhorn betätigte, sprang Jann mit heftig klopfendem Pulsschlag über die Böschung.
Sisals Anruf hatte ihn durstig gemacht. Er ging nicht zur Oder, sondern zurück nach Solikante, direkt in die Märkische Einkehr. Drei Stufen führten ihn in die Unterwelt hinab. Graue Schwaden in der Luft. (Rauchverbot? Wen interessierte das hier draußen?) Ein zerschlagener Ofen aus Ostzeiten. Ein ausgetrockneter Zapfhahn. Warmes Flaschenbier. Jann fühlte sich sogleich zu Hause. Er umarmte Frieda, auch wenn die ein wenig auf Abstand blieb, und schüttelte Karl Oles versehrte Hand.
»Na, auch diesen Wisch im Briefkasten gehabt?«, fragte Karl Ole.
»Was für’n Wisch? Frieda, machste uns zwei?«
»Na, wegen dem Syrer.«
»Keine Ahnung, hab keinen Briefkasten mehr«, sagte Jann.
»Erwartest keine Post, Nachbar?«
»Schon. Ist aber abgefallen.«
»Ein Schloss ohne Briefkasten. Na, dann Prost!«
»Prost. Was hat er denn diesmal vor?«
»Na, was wohl. Land kaufen. Moschee drauf bauen.«
»Das kann doch nicht wahr sein«, rief Frieda hinterm Tresen. »Keine zwei Minuten hier und schon beim Thema?«
Es gab wenig im Dorf, was weniger präsent war und dennoch so viel Raum für Gespräche einnahm wie der Syrer. Da hatte Frieda recht. Sie war im Sommer achtzig geworden. Aber der Syrer schreckte sie nicht. Auch Jann hatte nichts gegen den Syrer. Wenn er Solikante (Gut) zu steigenden Bodenpreisen verhalf, würde das auch Jann zugutekommen. Vielleicht konnte er dann endlich einen Trakt des Schlosses verkaufen?
»Frieda, sag du’s mir«, bat Jann.
»Spaßbad.«
»Was?«
»Na, Spaßbad, eben. Kennste nicht? Sandstrand. Dampfgrotte. Rutsche mit Looping. So’ne Sachen.«
»Ein Spaßbad in Solikante?«
»Fünfzig Arbeitsplätze, Bahnhalt halbstündlich«, sagte Frieda.
»Das hat er doch schon beim letzten Mal erzählt.«
»Nee, bei der Schweinemast waren’s dreißig Arbeitsplätze und Bahnhalt weiter nur stündlich.«
»Und der Haken?«
»Braucht keine Sau«, sagte Karl Ole.
»Die Schweinemast oder das Spaßbad?«
»Den Syrer.«
Der Syrer. Ohne dass die Bewohner von Solikante (Gut) den Mann je zu Gesicht bekommen hätten, sprachen sie über ihn wie über einen alten Bekannten. Heribert Koch, der nur zweihundert Meter neben dem Schloss in der Dorfstraße wohnte, hoffte darauf, dass sein Wasserwerk endlich einen Abnehmer fand. Die Grünlinge auf der Loose dagegen hatten sich noch immer nicht von dem Schock der drohenden Schweinemast erholt. Und Jann? Hatte gegen frisches Geld nie etwas einzuwenden. Syrer? Türke? Saudi? Alles gut.
Solange der Mann kein Moslem war.
Jann schmunzelte. Es hatte auch sein Gutes, dass er solche Sätze wieder denken durfte. Ruth hatte ihn ja mit einem umfassenden Denkverbot belegt. Ihr Mantra: Wo die Menschen am wenigsten Kontakt mit dem Fremden haben, ängstigen sie sich am meisten vor ihm. Und wenn Ruth mehr als drei Weiße auf einem Haufen sah, rief sie sofort: Nationalsozialistischer Untergrund! Ihr zufolge mussten die Menschen das Fremde möglichst früh kennenlernen. Jann hielt das für Blödsinn. Das Fremde war nicht per se besser oder schlechter als das Nichtfremde. Es kam doch auf den inneren Kompass an.
»Vielleicht ist er ja gar nicht gläubig?«, sagte Jann.
»Haste nicht zugehört? Syrien? Assad? Damaskus?«
»Vielleicht ist er Syrer. Aber Moslem?«
»Du bist ja wieder besonders schlau.«
»Welcher Moslem züchtet denn Schweine? Die dürfen ein Schwein nicht mal anfassen!«
»Solange die genug beten, dürfen die alles.«
»Wie viel Moslems haste denn schon gesehen?«, fragte Frieda.
»In Solikante? Keinen. Und ich hätt auch nichts dagegen, wenn das so bleibt«, sagte Karl Ole.
Jann kippte sein Bier in drei, vier großen Schlucken hinunter. Es war natürlich richtig gewesen, die Grenzen zu öffnen. Sie lebten in einem reichen Land, und es retteten sich Menschen zu ihnen, ganz gleich, aus welchen Gründen. Da gab es nichts zu diskutieren. Und doch war er einigermaßen verzweifelt, dass die Menschen, die er so gern begrüßt hätte, ausgerechnet Moslems waren. Wenn schon gläubig, hätten es dann nicht wenigstens Buddhisten sein können? Oder doch lieber eine Million Agnostiker?
Wenn es nach Jann ging, stand Deutschland am Scheideweg. Und das hatte nichts mit der Million Flüchtlinge zu tun. Von ihm aus konnte ganz Deutschland aus Flüchtlingen bestehen. Wenn das Abendland unterging, umso besser. Globalisierung, Mikroplastik, Hyperkonsum. Das Abendland, wie er es kannte, hatte auf ganzer Linie versagt. Deutschland stand aus ganz anderen Gründen am Scheideweg. Es blieb dem Land kaum noch Zeit, aus dem ganzen Wahnsinn geordnet auszusteigen. Zehn, zwanzig Jahre, danach kippten die Rechenmodelle und es folgte das finale Chaos. Sturmfluten und Überschwemmungen. Hitzesommer und Dürre. Seuchen und Entwurzelung.
»Zwei Möglichkeiten«, sagte Frieda, während sie einige mit Folie laminierte Spanholzplatten in den Ofen gab. »Entweder ich höre kein Wort mehr über den Syrer. Oder die Gaststätte Solikante macht heute früher zu.«
»Kannste nicht machen, Frieda. Wo sollen wir denn dann hin?«
»Dann mach uns mal lieber noch zwei.«
Jann leerte das neue Bier zur Hälfte. Wenn die Transformation in letzter Minute gelingen sollte, brauchte es jeden Mann und jede Frau. Egal, ob die nun aus Syrien stammten oder aus dem Allgäu. Das waren Petitessen. So was von egal. Aber sie mussten schon alle an einem Strang ziehen, wenn Sisal auch noch etwas abbekommen sollte von sauberem Wasser, von sauberer Luft. Mit Offenheit und Toleranz kamen sie da nicht weit. Da brauchte es keine Pluralität, sondern Identität. Ein Bekenntnis. Kein Glaubensbekenntnis, sondern ein Bekenntnis zur Natur, zum Leben. Die Kirchen, vor zweitausend Jahren gegründet, waren nicht so weise gewesen, dass sie die Probleme von heute vorausgesehen hätten. Auf Probleme von damals hatten sie womöglich Antworten gehabt. Vielleicht ergab es damals einen Sinn, kein Schweinefleisch zu essen? Die Aufzucht? Die Sache mit der Hygiene? Heute führte das Gebot dazu, dass es in Sisals Kita kein Schweinefleisch aus dem regionalen Biobetrieb, dafür aber globalisiertes Industrierind gab. Die Religion, die Mensch und Tier tatsächlich bewahrte, war noch zu gründen.
»Ob Syrer oder nicht«, sagte Jann. »Hauptsache, es räumt mal einer auf, hinten am Kraftwerk. Da ist doch noch immer alles voller Asbest.«
»Sag mal, spinnst du? Oder steckste mit den Spinnern von der Loose unter einer Decke?«
»Mit Yvonne? Besser nicht. Die trägt Pluderhosen.«
»Und dann will man nicht mit ihr unter einer Decke stecken?«, erkundigte sich Frieda.
»Sicher nicht. Aber wo ist eigentlich Kasiuk heute?«
»Der is’ schon duun.«
Als Jann zwei Stunden später das Schloss betrat, roch er den Bauschimmel. Immer noch. An den Geruch von Bauschimmel gewöhnte er sich nicht. Wie üblich, wenn er aus der Märkischen Einkehr kam, fand er den Lichtschalter nicht. Im Dunkeln roch der Schimmel besonders sporig. Dass er ein Bier zu viel getrunken hatte, fiel ihm niemals am Tresen, sondern immer erst im Schloss auf. Wenigstens hatte er keine Probleme mit dem Haustürschlüssel gehabt. Es gab keinen. Es gab nur einen eisernen, ohne Schlüssel zu betätigenden Riegel. Er stolperte über die Motorsäge und einen Betonquirl, er hielt sich an der Flurwand fest. Kalk rieselte zu Boden. Dann endlich fand er den Lichtschalter und stieg in den ersten Stock.
Schloss. Nun ja. Das alte Solikanter Gutshaus. Oder das, was hinter der fein herausgeputzten Fassade noch davon übrig war. Als Schloss hatten Ruth und er das Gutshaus nur im anfänglichen Überschwang bezeichnet. Bald waren die Pausen, die sie vor dem Wort Schloss machten, immer länger geworden. »Komm, wir fahren raus ins – Schloss.« »Wie viele Fenster hat das – – Schloss eigentlich?« »Glaubst du, wir haben auf dem – – – Schloss bald endlich mal Strom, wenn schon kein Gas?«
Am Ende hieß es nur noch: »Was ist teuer und führt zielsicher zur Scheidung? Ein – – – – Schloss.« Aber kein Schloss war auch keine Lösung. Der Satz stammte im Übrigen von ihr. Auch wenn sie sich nicht mehr daran erinnerte. Dass es in ihrer Ehe einmal eine Stimmung voller Sommerabende und Leichtigkeit gegeben hatte, musste Jann sich in Erinnerung rufen wie ein fernes, nur per Google Earth bereistes Land. Sisal im Tragetuch auf seinem Rücken, zur großen Belustigung der Bewohner von Solikante (Gut). Ruth mit einem angeschwipsten Lächeln beim Aufteilen der Räume. Und das wird das Kinderzimmer, und das wird die Wohnküche, und da kommt das Kino rein: »Auf Ebay hab ich schon samtene Kinosessel bestellt.«
Am wichtigsten waren ihr zwei Dinge gewesen: ein Bahnhof, um schnell wieder nach Schöneberg zu gelangen. Und ein Gästezimmer mit Doppelbett, damit auch die Paare länger blieben als nur eine Nacht. »Ohne Gäste«, sagte Ruth, »ist mir das hier nicht bunt genug.« Ruths vorrangiger Beitrag zur Sanierung: im Cranlower Toom-Baumarkt Kräuterpflanzen über das Kassenband zu ziehen, Rosmarin, Majoran, Zitronenmelisse, Minze, die dann bald überall wuchsen. Neben dem vom Anbau gewehten Asbestdach. Im alten Abort. In Töpfen auf dem schiefen Fensterbrett. Inmitten von mannshohen Birkentrieben. Auf dem alten, zu Schichten gehärteten Misthaufen.
Noch in der ersten Woche, als die Sonne die Stauden grün und golden färbte und Ruth einen Pernod aus ihrem Rucksack holte und sagte: »Das ist ja fast wie damals, mit Kate!«, hatte er gedacht, er hätte gewonnen. Und sich erst einmal an die Fassade gemacht. Die alten Fensterfluchten wiederhergestellt. Historische Farbmuster aufgetrieben. Feldsteinerne Fensterblöcke eingemauert und handgezogenen Stuck nach Originalschablone aufgebracht. Als die Fassade stand, war er pleite. Daran hatte sich bis heute im Wesentlichen nichts geändert. Nur für zwei Schmuckstrahler hatte das Geld noch gereicht, welche die Fassade Abend für Abend ausleuchteten. Seither war sein kleines, selbst erarbeitetes Vermögen dahin.
Er verstand bis heute nicht, was Ruth gefehlt hatte. Was brauchte man für eine kleine Familie? Vier Wände, drei Teller, zwei Gläser, eine Tasse. Für alles Weitere musste er bereits nachdenken. Besteck? Einen Spülschwamm? Gut, Besteck und einen Spülschwamm. Aber doch keinen Mixer und keine Auflaufform, keine Dunstabzugshaube und kein Gewürzregal. Er strich den Staub von dem dunkel lasierten Holz. Auch die Tütchen mit gemahlenem Kardamom, Safran und Ingwerpulver hatten Staub angesetzt, die Döschen mit Chilifäden und Nelken, mit Kreuzkümmel und Kurkuma, das Garam Massala, die Fenchelsamen, der Koriander und das Ingwerpulver: Über allem, über all der Farbigkeit, wie Ruth das nannte, lag eine ölige Schicht Staub.
Farbigkeit als Metapher hielt Jann für bedenklich. Auch er liebte die Farbigkeit: auf den Feldern, in den Auen, im Frühjahr, wenn der Raps gelb stand, im Herbst, wenn die Kastanien blutrote Blätter bekamen. Aber Ruths Farbigkeit, die meinte keine Farben, sondern Menschen, die sich selbst ausbeuteten, um zweiundzwanzig Stunden am Tag einen türkischen Spätkauf zu betreiben, einen sudanesischen Imbiss oder ein bangladeschisches Restaurant, das dann doch nur alle Inder nannten und in dem sie rannten und rannten, um deutschen Selbstverwirklichern zwischen zwanzig und Mitte vierzig Speisen unter zehn Euro anzubieten. Das war nicht bunt, das war der Sieg des Kapitals.
Er beugte sich über das Ofentürchen, um es zu öffnen, und ging auf dem Ofenblech in die Knie. Er fasste an die Kacheln. Kalt. Ärgerlich. Er äugte in den Spankorb. Leer. Auch das noch. Er ging zum Kühlschrank und nahm sich ein Bier heraus, dann ging er mit dem Bier in den Hof. Immerhin, eine Freitreppe hatte er. Man konnte nicht sagen, dass alles gescheitert war in seinem Leben. Er hatte sogar eine Kieszufahrt und eine ovale Blumenrabatte, vor der Limousinen vorfahren könnten.
Im Mondlicht hackte er einige Buchenscheite durch, trennte vom letzten Scheit Späne zum Anzünden und trug die Hölzer in die Küche. Im Brennraum des Ofens stand kalte Luft, Asche stob ihm entgegen. Er entzündete die Kontaktanzeigen der Cranlower Oderzeitung und hielt sie lodernd an die Brennplatte, bis sie in den Schornstein gesogen wurden. Er schloss die Ofentür nicht, sondern nutzte den Ofen als Kamin, hielt die kalten Hände vor die Flammen. Mist. Bier im Hof vergessen. Er stand auf und holte sich ein neues.
An der Kühlschranktür klemmte das Viererfoto aus dem Passbildautomaten. Natürlich im Retro-Look. In Berlin war ja irgendwie alles im Retro-Look. Offenbar litt die Stadt unter zu viel innerer Leere, um einen eigenen Stil zu entwickeln. Er griff nach dem Magneten in Kleeblattform und wollte das Viererfoto endlich abnehmen. Aber Ruth war leider zu hübsch. Nichts zu machen. Verbrennen unmöglich. Sie war so unglaublich und unverschämt hübsch auf diesen vier Bildern, die alle nur sie zeigten, die ohnehin hellen Haare vom Sommer weiter gebleicht, die Augen groß und gerundet, wie immer, wenn sie fotografiert wurde, dazu ein leichtes, unironisches, liebesbegabtes Kräuseln um die Mundwinkel, das bei ihr niemals gestellt aussah.
Er ärgerte sich, dass derselbe Mensch, der ihm das Leben schwermachte, so fürchterlich hübsch war. Das war nicht fair. Er hätte sofort mit ihr schlafen können, jetzt, hier, in dem ganzen Staub, in den ganzen Trümmern. Er wusste genau, wie sie sich anfühlte, er wusste genau, wie sie roch. Seltsam, dass das, ihre Anziehung also, nicht gelitten hatte. Manchmal fragte er sich, ob ihre Beziehung überhaupt beendet war? Vielleicht war alles nur ein riesiges Missverständnis? Und seine Aufgabe war, das Missverständnis zur allgemeinen Erheiterung und Erleichterung im Handumdrehen aufzudecken? Es wäre so einfach. Aber sie hatte ja gleich von einer Tat gesprochen. Als wäre er ein Täter. Als habe er ihr etwas angetan. Dabei hatte er nur ein wenig die Nerven verloren.
Er trank das Bier im Stehen am Kühlschrank aus, damit er nicht wieder aufstehen musste, um sich ein neues zu holen. Eine bewährte Taktik. Als er die Kühlschranktür zustieß, fielen einige Briefe von einem Stapel, der sich auf der Glasplatte des Kühlschranks auftürmte. Er bückte sich. Zweimal Strom. Dreimal Wasser. Strom ging ja noch. Strom öffnete er. Strom bezahlte er sogar. Aber Wasser war eine Frechheit. Wasser leistete seiner Pleite rasant Vorschub.
Heribert Koch hatte sein neues Wasserwerk mitten in die karge Landschaft geklotzt. Und die Bewohner von Solikante zahlten Kubikmeterpreise, die fünfmal höher lagen als in Berlin. Jann fragte sich, wer zuerst pleiteginge. Er oder das Wasserwerk. Und doch war Solikante gut gewählt, wie er fand. Zum einen war das Dorf nicht an das Gasnetz angeschlossen. Überhöhte Gasrechnungen blieben ihm mithin erspart. Und zum anderen fiel das Pleitemachen in Solikante nicht sonderlich auf. Da befand er sich in Solikante in guter Gemeinschaft. Wenn es stimmte, was sie bei Frieda erzählten, stellten sie einem den Strom vor dem Wasser ab. Offenbar galt es als menschlicher, im Dunkeln zu hausen als zu dursten.
Er stellte das halb ausgetrunkene Bier wieder zurück in die Kühlschranktür. Das war ihm geblieben vom Leben als Gutsherr. Dass er nachts um halb eins allein am Kühlschrank stand und sein letztes Bier nicht mehr schaffte. Er machte es sich vor dem Ofen bequem, genoss den Blick in die Flammen. Das Lodern und Züngeln beruhigte ihn. Das Knacken und Fauchen. Er legte sich vor den Ofen, den Kopf auf dem Oberarm.
Später schreckte ihn der Rauchmelder aus dem Schlaf. Ein fürchterliches, überlautes Piepsen. Die Küche war zugequalmt. Wie so oft bei Ostwind, wenn der Schornstein nicht ordentlich zog. Er stemmte sich am Ofen in die Höhe, stolperte zum Fenster und ließ frische Nachtluft herein. Nach wenigen Sekunden beruhigte sich der Piepser wieder. Jann blickte durch das geöffnete Küchenfenster ins Luch. Nebel über der nächtlichen Weite. Ganz fern, am Horizont, die Ahnung des beginnenden Morgens. Ein Schweif aufkommender Hoffnung, der Schweif aufgehenden Lichts. Mist, verdammt, es war schön hier! Das immerhin hatte sie auch immer gesagt. Und Sisal ihr nachgeplappert. Ein einziges Zimmer im Schloss war fertig geworden in dem Jahr, das er hier lebte:
Sisals.
Ein Zimmer mit einer Brio-Holzeisenbahn und einem Systembaukasten von Märklin, mit zwanzig Bänden Wieso? Weshalb? Warum? für Zwei- bis Vierjährige und elf Bänden Wieso? Weshalb? Warum? für Vier- bis Siebenjährige, mit Ice Age Junior und Siedler von Catan Junior und Ice Cool und Mogel Motte und einer Carrera-Bahn. Es war das nahezu perfekte Duplikat ihrer Spielecke in der kleinen Wohnung in Berlin. Es war ein Kinderzimmer, das einmal im Monat ein Kind sah und die restliche Zeit Staub ansetzte. Wenn er doch bloß auf das Sorgerecht bestanden hätte. Aber er hatte ja wieder auf niemanden gehört.
Ein Kind in Berlin großziehen. Was war das nun wieder? Witz? Wahn? Provokation? Welcher Geist hatte Ruth da nun wieder überfallen? Wenn es nicht ausgerechnet um seinen kleinen Engel ginge, ihre kleine Durchlauchtheit, seine freche Prinzessin, hätte er der Idee vielleicht etwas Komisches abgewinnen können. Aber nicht, wenn es um Sisal ging. Da konnte man ja gleich die Käfighaltung für Legehennen wieder einführen. Die Raubtierhaltung in Zoos gutheißen. Die minimale Quadratmeterzahl von Schweinekoben halbieren.
Wenn er Sisal zurückholen wollte, brauchte er Geld. Dass er sich in all den Jahren nach der Pleite nichts Neues aufgebaut hatte, schien dafür keine ideale Voraussetzung. Doch seit ihn das wütende Signalhorn des Siebzehnuhrzugs vom Gleis getrieben hatte, stand sein Entschluss. Sisals Mutter hatte lange genug bestimmt. Ab sofort bestimmte ihr Vater. Er würde Geld verdienen, gleich morgen früh. Er würde das Schloss renovieren, gleich nächste Woche. Und dann würde Sisal in Solikante eingeschult werden. Punkt. Fertig. Entschieden. Gegen die Schöneberger Superschule würde es schwer werden zu gewinnen. Aber er würde sich wieder holen, was ihm zustand. Entweder Ruth fügte sich, dann konnten sie ganz sittsam miteinander umgehen, ganz friedlich, ganz leidenschaftlich. Andernfalls versuchte er es ab sofort mit Gewalt.
Am Sonntag stand Jann beinahe zwanzig Minuten zu früh am Gleis. Vom Schloss zum Bahnsteig hatte er kaum zehn Minuten zu gehen, über die Alte Oder, links in die graue Apfelallee, die Äste nass vom Nebel, dann den alten Bahndamm entlang. Und doch hatte er Angst gehabt, zu spät zu kommen. Nicht auszudenken. Zu spät zu kommen, das war nicht mehr drin.
Er stellte sich vor, wie Sisal aus dem Zug in die karge Landschaft des Luchs blickte, Felder, Nebel, Weite, die Nase gegen das Fensterglas gedrückt. Wie lange mochte eine Stunde Zugfahrt dauern, wenn man fünf Jahre alt war? Einen Tag? Eine Woche? Ein Leben? Sisal mochte Kate, und sie war zu jung, um zu begreifen, dass diese Liebe einseitig war. Kate hasste Kinder. Auch wenn sie es sich noch immer nicht eingestand. Dass sie Sisal nach Solikante brachte, war nichts als ein Freundschaftsdienst an ihrer alten Studienfreundin Ruth Korwaczek.