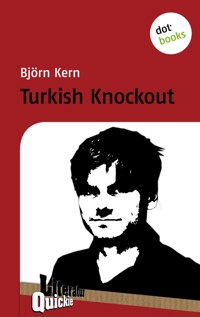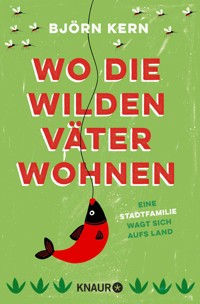14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In kalter Winternacht flieht Lee aus der Stadt an die Sydow, ins Revier seiner Kindheit, zum Vater, dem Großvater seines noch sehr jungen Kindes. Doch der hat das alte Forsthaus Hals über Kopf verlassen. Was ist vorgefallen im Sydower Forst? Was hat es mit den getöteten Tieren auf sich? Im Sydower Luch, einer zunehmend zerstörten Auenlandschaft, findet Lee schließlich seinen Vater. Doch der ist nicht mehr der stattliche Mann von einst, ein Anwalt der Natur und Hüter der Tiere, sondern ein verbitterter, wirrer Greis im Wahn. Lee begreift, dass er mit seinem Vater auch das Land seiner Kindheit verloren hat, und er weiß, um seinem eigenen Kind eine Zukunft zu bieten, muss er dieses Land endgültig hinter sich lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Björn Kern
Kein Vater,kein Land
Roman
Erste Auflage
© 2021 by Secession Verlag Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Typografische Gestaltung: Erik Spiekermann, Berlin
Satz: Marco Stölk, Berlin
Herstellung: Daniel Klotz, Berlin
Druck und buchbinderische Verarbeitung:
Friedrich Pustet, Regensburg
Papier Innenteil: 100g/m2 Fly 05
Umschlagmaterial: Schabert f.color neuleinen
Gesetzt aus Franziska & Dirty Seven Two
Printed in Germany
ISBN 978-3-966390-41-5
eISBN 978-3-966390-42-2
When your dreams are of some worldthat never was or of some world thatnever will beand you are happy againthen you will have given up.Do you understand?And you can’t give up.I won’t let you.
CORMAC MCCARTHYThe Road
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
I.
AM SYDOWER GRABEN erreichten sie die Stadtgrenze, der Bürgersteig verendete in einem Haufen Schnee. Auf dem Ortsschild war der Name der Stadt durchgestrichen, darüber stand nichts. Kein Ort in den nächsten Kilometern, nirgends. Lee bog aufs Feld ab, die Luft roch verbrannt. Er leerte seine Flasche, warf sie auf den toten Acker, stolperte weiter, zog das Kind über die verharschten Schneewehen. Nach einigen Kilometern wagte er sich zurück auf die Landstraße, näherte sich der Lichtinsel einer Tankstelle. Er bedeutete dem Kind, an den Zapfsäulen zu warten, und betrat den grellen Verkaufsraum.
– Gibt’s Milch?
– Machste dich über mich lustig?
– Wo’s Milch gibt?
– Und was willste mit Milch, mitten in der Nacht?
Der Mann zeigte aufs Kühlregal. Lee nahm den letzten, vorrätigen Milchkarton, zahlte, barg draußen das Kind in seinem Arm. Gemeinsam stemmten sie sich gegen den Wind, machten wieder Strecke auf der verwaisten Landstraße, nach Osten, natürlich wieder nach Osten. Nach einer Zeit im Wind und im Schnee und in der Dunkelheit erreichten sie endlich den Deich.
Die Sydow war zugefroren in diesem Jahr, die Grate der aufgeworfenen Schollen mit Schnee überzogen, ein Eisfall voller Winkel und Kanten und Zacken. In der Flussmitte dampfte ein Eisbrecher, schob zwei Lichtkegel vor sich durch die Nacht, das Brechen der Schollen klang hart herüber. Eine Böe trieb dem Kind erneut Schnee unter die Fellkrause seines kleinen Parkas. Lee fegte die gröbsten Flocken heraus, drehte sich um, spähte, lauschte, doch der Raum hinter ihnen schien dunkel und leer.
– Wird alles gut, wenn wir bei Opa sind, sagte Lee.
– Werden die Männer uns folgen?
– Nein. Hab keine Angst.
Beim nächsten Kilometerstein schlitterten sie die vereiste Böschung hinunter, auf einen Grenzpfosten zu, und gingen landeinwärts. An den drei Eichen querten sie die Feldentwässerung, hielten sich einige hundert Meter am Schützengraben, betraten den Sydower Forst. Die Nacht verdichtete sich, ein Eichhörnchen stob davon, aus der Ferne das unermüdliche Krachen des Brechers.
Das Forsthaus lag karg und verlassen, die Fenster duster, der Schornstein ohne Rauch. Das Wellasbest war vom Anbau heruntergeweht und ragte zersplittert aus dem Schnee, ein goldenes Vorhängeschloss versperrte die Eingangstür.
– Sind wir da?, fragte das Kind.
– Ja, sind wir.
– Hier wohnt er? Warum geh’n wir nicht rein?
– Er ist nicht zuhause.
– Dann warten wir auf ihn?
– Da können wir lang warten, wie’s scheint.
Lee wusste nicht, was er tun sollte. Dass der Vater nicht mehr an der Sydow leben könnte, war ihm nicht in den Sinn gekommen.
Sein Vater.
Der Großvater seines Kindes.
Er hob das Kind auf den Arm, umrundete das Forsthaus. Der Bauwagen stand noch; in den Rillen der blechernen Außenverkleidung brach sich der Mond. Lee schob das Kind die wenigen Stufen zum Wagen hinauf, folgte ihm und zog die Tür hinter ihnen zu. Er sank auf die Liege, deckte das Kind zu, das Kind nuschelte etwas und schlief sofort ein.
Draußen, hinter dem Schiebefenster, schlich ein Reh über den Vorplatz, in der mondgrauen Nacht eines späten Winters. Eine Ricke, die ihren linken Hinterlauf nachzog, das Fell hatte sich von der Flanke gelöst, auf der baren Haut wuchsen Schwären. Lee bereute, dass er nicht das Gewehr aus dem Keller geholt hatte, am Fenster rauchte er die letzte, klamm gewordene Zigarette aus seiner Parkatasche auf.
Auf seinem Handy sah er nach, wann Tauwetter einsetzen würde. Ende der Woche.
Schwerer Unfall auf der A9.
Ehemaliger Bundestagspräsident gestorben.
Bayern – Schalke 0:1.
Das Symbol für Anrufe in Abwesenheit blinkte. Sie hatten dutzendfach versucht, ihn zu erreichen.
Später in der Nacht weckten ihn Motorengeräusche, eine Autotür wurde aufgerissen. Im ersten Moment fürchtete er, die Beamten wären ihm gefolgt. Technomusik wummerte zwischen den Kiefern, Funkverkehr knackte, Lee dimmte das Display seines Handys herab.
– Was ist das?, fragte das Kind.
– Das ist nichts.
– Ich höre es doch. Es rauscht. Einer spricht.
– Das ist Musik, sagte Lee.
– So klingt keine Musik. Ich weiß, wie Musik klingt. Sag, was ist das?
– Das ist nichts.
– Ich höre es doch.
Die Autotür wurde wieder zugeschlagen, der Bass setzte aus, auch das Knacken und Rauschen der Funkgeräte verklangen. Unwahrscheinlich, dass die Beamten ihm bis hier heraus gefolgt waren. Vielleicht nur ein Jäger. Lees Handy war nun feucht unter seinen verschwitzten Fingern, der Akkustand zu niedrig für ausreichende Helligkeit. Es gefiel Lee nicht, wie schnell sich das Licht verzog, bis da keines mehr war, bis es schwarz wurde, und als er gar nichts mehr sah, traf ihn die Nacht wie ein Schlag.
Er richtete sich auf, hektisch atmend, nahm die Hand des Kindes, was ihn beruhigte. Lees Vater hatte recht behalten. Es war kein Land für Kinder. Es war keine Zeit für Kinder. Im Frühjahr würde die Sydow über die Ufer treten. Draußen zeigte sich zwischen den Kiefern der erste Beginn des kommenden Morgens. Weißlich, noch ohne Wärme, ohne Sonne, nur etwas heller im sonst kalten Schwarz.
– Öffnen Sie die Tür!
Die Männer klingelten, klopften. Lee hielt dem Kind den Mund zu, trug es in Marjuschas Küche, in ihrer Wohnung im Außenbezirk, und schloss die Küchentür ab.
– Wenn Sie nicht umgehend aufmachen, kommen wir wieder und lassen die Wohnungstür aufbrechen!
Die Stimme des Mannes klang durch die beiden Türen gedämpft. Das Kind kroch unter Marjuschas Küchentisch und hielt sich die Ohren zu.
– Und wenn er doch nicht da drin ist?, fragte der Kollege des Mannes, leiser, der Stimme nach jünger.
– Er ist da drin, und das Kind ist bei ihm. Ich weiß es. Aufmachen! Machen Sie sofort die Tür auf! Zeigen Sie Verantwortung!
– Das hat doch keinen Sinn.
– Kommen Sie raus! Denken Sie nicht an sich, denken Sie an Ihr Kind!
Als Lee aus dem Schlaf schreckte, schmeckte er Blut im Mund. Er hatte sich das Wangenfleisch aufgebissen, mit der Zungenspitze fuhr er die Grate und Knoten aus Haut entlang, dann schluckte er das Blut hinunter und stand auf. Er vergewisserte sich, dass niemand im Forst vor dem Bauwagen stand, dass er in Sicherheit war. Die Männer hatten fast eine Viertelstunde vor Marjuschas Wohnung mit Klopfen zugebracht.
– Guten Morgen, sagte er zu dem Kind.
– Ich hab nicht geschlafen. Es war zu kalt.
– Du hast geschlafen wie ein Baby.
– Ich hatte Angst, ich erfriere. Ich will, dass Mama hier ist.
– Ich war die ganze Nacht bei dir.
– Mama merkt, wenn ich wach bin. Sie streichelt mich dann. Hier, schau, am Hals.
– Wir werden nicht lange bleiben.
– Du sollst herschau’n. Wo sie mich streichelt. Hier, an der Seite, am Hals.
– Wir müssen weiter nach Osten, ins Luch.
– Zu Mama?
– Zu Mama, ja.
– Dann geh ich heut wieder nicht in den Kindergarten?
– Nein. Und jetzt trink deine Milch.
Im Schlaf hatte der Atem des Kindes in der kleinen Fellkrause Reif hinterlassen, der unter dem angestrengten Schnaufen, mit dem das Kind stets trank, zu schmelzen begann. Erst jetzt, im Morgenlicht, sah Lee die Abbildung an der Wageninnenwand, eine verknappt gezeichnete Geiß mit praller Kruppe, der rücklings ein Bock aufsaß; daneben zwei Geißlein.
Die Liege, auf der Lee und das Kind geschlafen hatten, war fleckig, auf dem Boden lagen Mäusekot und Zigarettenkippen, Bierdosen und Zeitungspapier.
Lee wischte dem Kind den Milchbart von der Oberlippe.
– Warte hier.
– Wohin gehst du?
– Ich lass dich nicht allein.
– Ich will nur wissen, wohin du gehst.
– Du musst lernen, ein paar Minuten allein zu sein. Hier draußen gelten andere Regeln.
– Ich will aber nicht. Ich will das nicht lernen.
– Ich lass dich nicht allein. Niemals, hörst du?
Er ging durch schafthohen Schnee, der von oben in das Futter seiner Stiefel drang, schlitterte über herabgestürzte Verkleidungsbleche unter der Schneedecke, über Dachanker und gesplitterte Ziegel vom südlichen First. Die Hasenställe sahen aus, als wären sie noch in Nutzung, altes Stroh, Futtertröge voller Maiskörner, leergesogene Wasserspender, der Maschendraht makellos dicht.
Er öffnete den obersten Koben, stellte sich auf die Zehenspitzen, um das Astloch in der Dachlattenverkleidung zu finden, griff hinein und fingerte nach dem langen Kellerschlüssel, er lag an seinem Platz.
Lee stieg ins Dunkle hinab, tastete sich den Mittelgang entlang. Die drei weißen Tiefkühltruhen standen noch, summten aber nicht mehr. Ihre Deckel waren geschlossen. Lee öffnete die mittlere Truhe. Ein martialischer Gestank drang aus dem Spalt, der Geruch der Verwesung, doch die Truhe war leer. An den Innenwänden und auf dem Truhenboden zeichneten sich braun getrocknete Lachen von Tierblut ab. Lee würgte, vergrub Nase und Mund in seinem Jackenaufschlag, sah in den anderen beiden Truhen nach. Leer auch sie. Der Gestank war böse, giftig, Lee ließ den letzten Deckel wieder fallen.
Er drang tiefer in den Keller, seine Erinnerung trog nicht. Er bückte sich nach der Streusandkiste, klappte den hölzernen Deckel auf, strich etwas Sand beiseite, grub, fand nichts. Natürlich, der Vater hatte sie bei sich. Dann grub er tiefer und fasste auf kaltes Metall. Also doch. Wenn das Gewehr noch hier war, war sein Vater nicht weit. Mit dem Finger glitt Lee das Lochbrett über der Werkbank entlang, fand den Kolbenreiniger, nahm das Gewehr in die eine, den Kolbenreiniger in die andere Hand und verließ hastig den Keller.
Draußen wiegte er das Gewehr, eine Sauer 101, tarierte sie leichter als in seiner Erinnerung. Er führte den Lauf an die Nase, linste in den dunklen Schacht, roch das feurig verbrannte Metall, klopfte mit den Fingernägeln auf das Magazin, legte dann an. Mit zugekniffenem Auge ging er rückwärts, bis er das vernagelte Badfenster im Rücken spürte, zielte auf das goldene Vorhängeschloss vor dem Forsthaus. Er lud, spannte, entsicherte, legte Kimme auf Korn, drückte ab.
Es klickte leise.
Er setzte das Gewehr wieder ab und hockte sich vor die Eingangstür, die mit Brettern verbarrikadiert war. Er legte das Gewehr auf seine Knie, schraubte den Lauf ab und öffnete das Patronenfach, reinigte Fach und Lauf mit dem buschig verrußten Wirbelreiniger. Er bewegte den Repetierbolzen, blies das Rohr frei, ölte den Abzug, dann schraubte er den Lauf wieder an den Kolben. Der Vater hatte ihm nicht erlaubt, auf bewegtes Gut zu schießen. Lee hatte nur Bierdosen von einem Holzstumpf geschossen, oder Wodkaflaschen, deren Nachschub gegen Ende nicht mehr versiegt war. Er hatte auf Kopfweiden und Grenzpfosten geschossen, aber noch nie auf etwas, das über ein Herz verfügte, ob Mensch oder Tier.
Das Gewehr würde er in jedem Fall gebrauchen können, nach allem. Wie sich die Dinge entwickelt hatten, war ein Gewehr nicht zu verachten.
Er nahm den Lauf in den Mund.
Er drückte ab.
Dann holte er Munition.
– Wo warst du?, fragte das Kind, das im Wagen auf ihn gewartet hatte.
– Eine rauchen.
– Mama mag nicht, wenn du rauchst. Und ich war ganz allein.
– Du warst nicht allein. Ich war vor der Tür.
– Ist Opa zurück?
– Nein.
– Mama sagt, dass er verrückt ist. Sie sagt, sie will gar nicht zu ihm.
– Er ist nicht verrückt.
– Ich will zu Mama, nicht zu Opa.
– Wir müssen warten, bis es taut. Vorher können wir nicht los.
Er fasste nach dem Kind, es entwischte ihm zum Spaß, sprang auf die Liege, lachte klar in der kalten Luft. Lee setzte nach, lachte auch, klemmte sich das strampelnde Kind unter den Arm und kitzelte es am Bauch.
– Aufhören! Du sollst aufhören! Ich kann nicht mehr!
– Du lachst aber so schön.
Als ihnen die Luft ausging, knieten sie sich nebeneinander vor den kleinen Ofen, rissen eine Spanholzstiege auseinander, verfluchten die Eisenklammern, die das Auseinandernehmen erschwerten, keilten die Splitter über den Feuerrost. Lee nahm etwas Zeitungspapier vom Boden und zündete es an. Bald brannten die Spanholzstreifen, an den dünnsten Enden glommen kleine Glutpunkte auf, erste Flämmchen lohten um das gehackte Holz.
Auf einmal hämmerte es gegen die Wagenwand. Lee gab dem Kind harsch zu verstehen, es solle sich still verhalten. Das Kind sprang zu ihm und klammerte sich an Lees Oberkörper fest.
Eine rote Wollmütze wippte vor dem Schiebefenster, darunter ein kahler Kopf. Lee erstarrte.
Dass es den immer noch gab.
– Wer ist das?, fragte das Kind leise.
– Ein Freund von Opa.
– Mach nicht auf.
– Dann kommt er rein. Versteck dich und rühr dich nicht vom Fleck. Verstanden?
– Du sollst nich’ aufmachen. Lass einfach die Tür zu, ja?
Lee ging zur Tür, nahm den Riegel zurück, öffnete.
Das Kind huschte hinter den Ofen.
Wachter, drei vier Trittstufen unter ihm, legte die Hand über die Augen und sah blinzelnd zu Lee hinauf, obwohl das Tageslicht diffus geblieben war. Er trug einen Ledermantel und tatsächlich noch immer dieselbe Wollmütze, rot, löchrig, mit dümmlicher Quaste.
– Lee?
– Sieht ganz so aus.
– Eins muss ich dir lassen. Mutig biste ja, dass de dich hierher zurücktraust.
– Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Wachter.
– Hör auf mit dem Scheiß. Schluck Schnaps?
– Würd ich nicht nein sagen.
Er nahm zwei lange Schlucke einer Billigmarke, die Wachter aus seinem Mantelschoß hervorgezogen hatte, wahrscheinlich Wodka, aber letztlich egal. Lee setzte ab, Wachter nickte auffordernd, Lee setzte wieder an und nahm einen dritten, langen Schluck.
– Und Marjuscha?
– In der Stadt.
– Ist sich noch immer zu schön für uns? Ich seh se noch vor mir, Sommerkleidchen, so gespreizt auf’em Rad. Strohhut, und alles!
– Wachter, was willst du von mir?
– Heut Nacht, da haste nich’ zufällig irgendwas gehört?
Lee gab die Flasche zurück. Der Wodka hatte einen leichten Schwindel verursacht.
– Glaub nicht, sagte Lee.
– Ne Streife vielleicht? Karlsson?
– Ne Streife eher nicht.
– Es ist nur … Geht einer um, der’s auf die Pferde abgeseh’n hat.
– Was will einer schon mit deinem ollen Gaul?
– Das willste nich’ wissen. Und Janusch is’ im Übrigen nich’ mehr.
– Seit wann das?
– Das weißte ganz genau.
– Ich hab keine Ahnung, Wachter. Ich hab nicht die geringste Ahnung.
– Du hast keine Ahnung?
– Ich weiß nicht mal, wo der Vater hin ist.
– Zur Hölle, will ich hoffen. Aber was war das?
– Hab nichts gehört.
– Na, da, am Wagen –
– Hier geht ne Ricke um, die krank ist. Vielleicht war’s das, was de gehört hast.
– Ne kranke Ricke? Hör bloß auf mit dem alten Scheiß.
Sowie Lee die Tür schloss, streckte ihm das Kind beide Arme entgegen, er nahm es auf. Das Kind schmiegte den Kopf an seinen Hals, hielt Lees Oberarm umklammert, die kleinen Hände zu Fäusten geschlossen.
Lee roch am Haar des Kindes.
Er biss ihm leicht in den Nacken.
Er wollte das Kind wieder in Ordnung bringen, hier draußen. In der Stadt hatten sie es in den letzten Wochen ein wenig kaputt gemacht. Er wollte ihm einen guten Morgen wünschen, es fragen, wie es geschlafen hat. Er wollte ihm beibringen, was sein eigener Vater ihm beigebracht hatte. Wie man auf Wels angelt. Was man mit einer kranken Ricke macht.
– Kommt er wieder?
– Er wohnt nur’n paar hundert Meter tiefer im Forst.
– Hat er Opa mitgenommen?
– Wie kommst du denn darauf?
– Er klang böse.
– Er ist nicht böse.
– Er klang aber so.
– Hör zu. Opa wohnt nicht mehr hier. Wir bleiben hier, bis es taut. Dann folgen wir ihm.
– Und Mama?
– Mama ist bei ihm.
– Is sie schon vorgegangen?
– Ja.
– Warum hat sie nicht auf uns gewartet?
– Lass uns besser mal rausgeh’n, die Ricke suchen.
– Warum sie nicht auf uns gewartet hat?
– Ich denk, sie braucht unsere Hilfe.
– Mama?
– Nein. Die Ricke.
Sie verließen den Bauwagen und dann den Sydower Forst in östlicher Richtung, der kurze Wintertag dämmerte schon. Mit zunehmendem Schnee waren die Zacken des Eisfalls auf dem Fluss weicher geworden, wie abgerundet, wie weichgeweht, der Schnee und der Wind und die Kälte lähmten Lee und dem Kind das Gesicht. Sie folgten der Rehspur, die sie mit ihren Stiefeln weiteten, brachen und kreuzten: vor ihnen wie jungfräulich gesetzt, hinter ihnen wie benutzt und verworfen.
Die Ricke stand an der Sydow, kaum fünfzig Meter vor ihnen. Trotz des grauen Winterkleids vor dem weißen Eis gab sie ein klares Ziel mit ihrer schwärenden Flanke. Lee klatschte in die Hände, trieb die Ricke nach Osten, ans Ufer heran.
Er setzte das Kind im Schnee ab und lud das Gewehr durch, dann folgten sie der Ricke parallel zu einem aufgeschütteten Polder. Sie erreichten das Eis, dessen Zacken und Verwerfungen hier flacher waren, begehbar, solange man nicht auf die Bruchlinien trat.
Als das Reh die Fahrrinne erreichte, schlug eine von Wachters Doggen an. Die Ricke erschrak, machte einen Satz auf das fein überglaste Uferwasser zu. Sofort brach sie ein, mit dem vorderen Lauf, zog den hinteren unglücklich nach. Sie fand keinen Halt, kam nicht zurück in den Stand, sank über die Brust in die offene Fahrrinne ein.
Wachters Dogge heulte auf, Lee ging in die Knie, streckte sich zu dem Reh hinab, unmöglich, es aus dem Wasser zu ziehen, ohne selbst hineinzustürzen. Einen Moment sahen sie sich Auge in Auge, Lee und die Ricke, sie ließ ihre Zunge aus dem Maul fallen, die Zunge war blau.
Das Tier bellte, dann brach das letzte Eis, das die Ricke am Ufer hielt. Lee entsicherte, zielte, legte den Finger an den Hahn und schoss. Die Ricke warf den Kopf in den Nacken, zuckte, drehte sich im Strudel der Fahrrinne um die eigene Achse, der Kopf sank auf die Wasseroberfläche, der Leib verfing sich in der nächsten Bucht flussabwärts.
– Hast du sie totgemacht?, fragte das Kind.
– Sie ist tot, ja.
– Ich hab noch nie geseh’n, wie du wen totgemacht hast. Ist sie wirklich ganz tot?
– Beruhige dich.
Er stand wieder auf.
Ihm war warm geworden unter dem Parka, doch nun, als er stand, kroch ihm der Ostwind unter den Saum.
– Verrückt, sagte das Kind.
– Was ist?
– Das Reh. Es friert fest.
Kaum einen Meter vor seinen Füßen, wo ein Ausläufer des Flusswassers eine Mulde aus dem Ufer geschwemmt hatte, ragte der Kopf des Tieres aus einer dünnen Schicht Eis. Die Augen geöffnet, glänzend, eines der Ohren fehlte, das andere stand in einem unnatürlichen Winkel vom Kopf ab. Der restliche Rehkörper war nicht zu sehen unter der Eisfläche, auf die der Schnee wehte. Der Schädel sah aus, als sei er von Hand auf das Eis gelegt worden.
– Wie kann es so schnell festfrieren?, fragte das Kind.
– Es ist neun Grad unter null.
– Dann werden wir auch festfrieren?
– Nein. So kalt ist das nicht.
Das Kind kam näher zu ihm, setzte einen Schritt zu nah an die Ricke, verfing sich mit seinem Hosenbein im Huf des Tieres. Das Kind riss sich frei, als habe die Ricke nach ihm gegriffen.
– Ich will hier weg, sagte es.
– Nimm meine Hand.
– Sie starrt mich an.
– Beruhige dich. Sie starrt dich nicht an.
– Ich hab Angst. Sie starrt mich an.
– Schau nicht hin. Schau mich an. Schau einfach nicht hin.
Zitternd stand das Kind im kalten Wind und umschlang Lees Beine, er ging in die Knie, der kleine Brustkorb des Kindes bebte unter dem Jackenfell.
Wieder bellte eine von Wachters Doggen. Der Wind trug das Gebell immer lauter an sie heran, als jagte die Dogge zu ihnen über das Eis.
– Besser, wir geh’n schnurstracks zurück in den Wagen, sagte Lee zu dem Kind.
Von Westen näherten sich zwei Helikopter mit Suchscheinwerfern. Der Rückstoß der Rotorblätter drückte eine Schneise ins gefrorene Schilf. Schnell glitt der Lichtkegel weiter, die Piloten folgten dem Ufer flussabwärts, nach Osten, bis sie nach links abdrifteten, das fremde Knattern lag noch eine Weile über dem gefrorenen Fluss.
– Sind die Männer da drin?, fragte das Kind.
– Nein.
– Aber wer fliegt dann?
– Andere Männer. Sie überprüfen, ob die Sydow überall schiffbar ist.
– Sie suchen uns nicht?
– Niemand sucht uns. Wir haben niemandem was getan. Hörst du? Es gibt niemanden, der uns sucht.
Als das Kind auf Lees Armen eingeschlafen war, baumelten seine Beine kraftlos herab, nur die Hände hielt es weiter hinter Lees Nacken verschränkt. Im Wagen bettete Lee das Kind vor den Ofen, zog ihm die schneenassen Schuhe und Socken und die kleine Jeanshose aus und legte alles zum Trocknen über das Rohr. Er strich dem Kind über die Stirn, die Augen unter den geschlossenen Lidern hörten nicht auf zu zucken.
Bei der ersten Untersuchung ohne Marjuscha hatten sie dem Kind Bilder von Sanitätern und Krangenwagen gezeigt, Lee fand das geschmacklos. Sie hatten nach den dazugehörigen Wörtern gefragt. Krankenwagen, hatte das Kind gesagt. Blaulicht. Bett, das man tragen kann.
– Eine Bahre. Und das hier?
– Bagger.
– Und hier?
– Müllauto.
– Und was macht das Müllauto?
– Es sammelt Müll ein.
Der Kinderarzt hatte das Bilderbuch zugeklappt und etwas in den Computer getippt.
– Ihr Kind ist nicht das Problem. Es ist altersgemäß entwickelt.
Als er sich sicher war, dass das Kind schlief, brach Lee wieder auf. Er senkte den Kopf gegen die Dunkelheit, tastete sich an überglasten Astausläufern entlang, die kalt hinter ihm entzweibrachen. Im Forst stand leichter Nebel, durchsetzt von Braunkohlegeruch. Bei Wachter brannte noch Licht. Schon von Weitem schlugen die Doggen an. Sie jaulten und warfen sich gegen den Zwinger, Ketten rasselten, schlugen gegen Metall. Lee hatte die Tölen schon damals gehasst.
Soweit sich das in der Nacht erkennen ließ, stand die vorderste Wohnstube des alten Bungalows noch, zumindest die Fassade. Wachters Leben im Forst war ohnehin nie viel mehr als das gewesen, eine Fassade, hinter die Lee niemals zu blicken vermocht hatte; in die Waldluft mischte sich immer herberer Braunkohlegeruch.
Wachter stand auf der Veranda im Schnee und rauchte, sein kahler Schädel war unbedeckt, das Johlen und Jaulen der Doggen beendete er mit einem einzigen Pfiff.
– Weißte eigentlich, wie spät das ist?, sagte er.
– Ich hab noch Licht gesehen.
– Das heißt nichts, das Licht brennt die ganze Nacht, seit wieder einer hinter den Pferden her ist.
– Also?
– Biste dir sicher, dass de nich’ einfach nur besoffen bist?
– Mach’s kurz, Wachter. Krieg ich den Kahn, oder krieg ich ihn nicht?