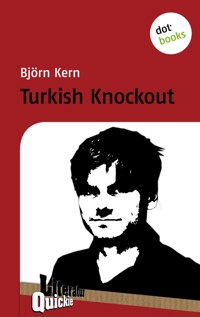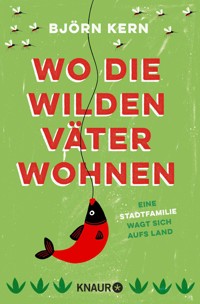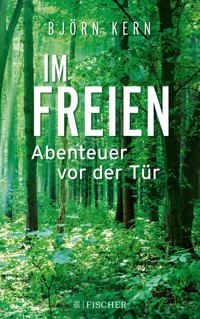
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von der revolutionären Kraft, draußen zu sein. »Ich beschließe, die Nacht genau hier, am Waldrand, zu verbringen. Mir ist nicht mehr kalt, ich habe die Augen geöffnet, sehe aber nirgendwohin. Ich sehne mich nicht mehr nach dem nächsten Tag, bereue nicht, dass ich den zurückliegenden am Rechner verbracht habe. Ich bin hier. Alle Anspannung ist abgefallen. Es ist der Moment, der süchtig macht.« Björn Kern ist nicht am Amazonas und nicht in eisigen Höhen unterwegs, sondern auf wenigen Metern über Normal Null, gleich vor der eigenen Haustür. Aber auch hier lauern existentielle Erfahrungen, wie sich zeigt, auch hier begegnen ihm Angst und Rausch und Begeisterung. Sinnlich und literarisch brillant offenbart er einen Ausweg für alle, die rauswollen, ohne aussteigen zu können. Für sie, die Sehnsüchtigen, ist diese magische Freiheitsfibel geschrieben. Doch beim Draußensein geht es nicht nur um das Freilegen weggeklickter Sinne. Das Draußensein hilft auch dabei, die Maßstäbe wieder zurechtzurücken. Neues iPhone? Flug auf die Antillen? Autofahrt zur Plastikfolie? Wirklich? Im Freien zeigt sich, dass das richtige Leben im falschen, mit etwas Glück, zu finden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Björn Kern
Im Freien – Abenteuer vor der Tür
Über dieses Buch
Um dem Alltag zu entkommen, muss man nicht gleich eine Fernreise buchen. Davon ist Björn Kern überzeugt. Das Abenteuer wartet direkt vor der Haustür. Dem Lauf der Jahreszeiten folgend erzählt uns Björn Kern von der Wunderwelt, die so nah liegt, dass wir sie leicht übersehen – und beginnt seine Reise ins Freie mit einer Nacht im heimischen Wald. Sinnlich und sprachlich brillant offenbart er eine Exit-Strategie mit perfekter CO2-Bilanz, die nichts kostet und für die keine Ausrede gilt. Denn egal ob Sommer oder Winter: Rausgehen ist jederzeit möglich. Und es befreit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Coverabbildung: Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490643-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel Nachts, im Wald
2. Kapitel Keine Zäune, keine Grenzen
3. Kapitel Im Gleisbett nach Osten
4. Kapitel So frei wie möglich
5. Kapitel Im Schützengraben
6. Kapitel Luftkampf
7. Kapitel Grenzgänger
8. Kapitel Flucht übers Feld
9. Kapitel Blitzschlag
10. Kapitel Wer ohne Sünde ist
11. Kapitel Im Osten der Fluss
12. Kapitel Insel am Feuer
13. Kapitel Wiedersehen mit Fuchs
14. Kapitel Glühende Großväter
15. Kapitel Eisschwimmen
16. Kapitel Schnee und Licht
1. Kapitel Nachts, im Wald
Ich erwache von einem scheußlichen Bellen. Gefolgt von Hufgetrappel, das von den Baumstämmen widerhallt. Der Waldboden erzittert. Ich hebe den Kopf, traue mich nicht aufzustehen. Mein Puls rast. Das Feuer ist ausgebrannt, die Lichtung liegt schwarz in der Nacht. Mir ist kalt in dem dünnen Schlafsack, er riecht nach Rauch. Ich bin allein, mitten im Wald. Umgeben von einem Rudel Wildtiere.
Wildschweine?
Wölfe?
Dann wieder das Bellen, hart und aggressiv, keine zwanzig Meter neben mir im Dunkeln. Panik kommt auf. Ich suche das Messer, das Handy, will nur noch eines: raus aus dem Wald.
Doch zu spät.
Zwölf Stunden zuvor.
Ich sitze am Computer. Seit einer Ewigkeit schon. Meine Arbeit und ich finden nicht recht zueinander. Sie gibt sich kapriziös, meine Arbeit, entwindet sich immer aufs Neue. Ich schreibe Sätze und lösche sie wieder. Und wenn ich sie gelöscht habe, tippe ich sie wieder hin. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Ich öffne Mozilla Firefox. Sehe ein Video an, auf dem ein Zweijähriger Skateboard fährt. Er trägt noch Windeln. Ich schiele auf die Nachrichtenportale: Trump. Roter Knopf. Weltfrieden. Taylor Swift gewinnt gegen ihren Stalker. Amerikanische Forscher züchten ein Ohr auf einem Unterarm. Ein Gorilla lernt kiffen. Währenddessen vollführe ich Verrenkungen, bei denen ich lieber nicht beobachtet werden möchte. Schulterrollen. Nackenkreisen. Hartnäckig öffne ich wieder und wieder den Artikel, an dem ich gerade arbeite, nur um ihn mit zunehmender Verzweiflung wieder zu schließen.
Am späten Nachmittag, nach einem Arbeitstag ohne körperliche Bewegung, stehe ich auf und trete ans Fenster. Draußen spiegelt sich die Sonne in der Dachluke des Schuppens. Drinnen surrt die Lüftung des Computers. Draußen verfärben sich die Wolken violett. Drinnen schimmert die Welt im Windows-Grau. Wildgänse ziehen über den Hof, verschwinden hinter einem Wolkenband. Ich öffne das Fenster. Die Luft, die hereinströmt, ist schon etwas warm.
Und da ist es wieder, das Nahweh. Es fühlt sich windstill an, riecht ein wenig nach Holzrauch. Es klingt nach den Zugachsen, die am Dorfende über die Gleise rattern.
Es bringt mich sofort um den Verstand.
Ich drücke auf Escape.
Schalte den Computer aus, schnüre mir die Stiefel. Ich muss da raus. Nichts zu machen. Dass es März ist und nachts noch frieren kann, scheint ein wenig hinderlich, aber das Nahweh ist einfach zu stark. Der Drang, draußen zu sein. Für ein paar Stunden alles hinter mir zu lassen. Luft zu atmen. Frei zu sein. Und so verlasse ich erst den Hof, dann das Dorf und folge der Bahnlinie, in Richtung der Alten Oder, in der das letzte Eis endlich geschmolzen ist, nehme von dort die Eichenallee und dann den Feldweg zum Wald. Auf meinen Schultern: ein Rucksack mit Taschenlampe, Handy, Gaskocher, Kaffeepulver, Blechgeschirr, Taschenmesser, etwas Wodka, einem Paar Thüringer, Brot, einer Isomatte und einem Schlafsack.
Ich werde die Nacht im Wald verbringen. Allein. So lautet der Plan. Meine erste Nacht im Wald überhaupt. Es ist ein Plan, von dem ich bis vor kurzem selbst noch nichts wusste. Ich kenne das schon. Erst die Stunden am Rechner. Dann ein Nahwehanfall. Und schließlich der totale Übersprung. Ziel ist der morsche Unterstand auf der Lichtung, die eine halbe Stunde im Waldinneren liegt.
Updates werden konfiguriert? Schalten Sie den Computer nicht aus?
73 % Fortschritt?
Soll Word die zuletzt gespeicherte Version wiederherstellen?
Tut mir leid. Ich mach nicht mehr mit.
Die Märzsonne steht tief über dem Acker, mein Schatten wandert neben mir über die Furchen und Schollen. Der Feldweg zum Wald ist verharscht, unter meinen Sohlen knirscht Reif. Ich drehe mich noch einmal um. Vom Dorf ist nichts mehr zu sehen. Erleichtert gehe ich weiter. In der Ferne brummt ein Mofa, vom Acker stieben Saatkrähen auf. Endlich erreiche ich den Waldrand, ein Band aus hochaufgeschossenen märkischen Kiefern. Sie stehen im Abendlicht wie auf der Bühne.
Ich betrete den Wald, und mit dem Wald eine andere Welt. Der Weg wird sandiger, weicher. Angenehmer zu gehen. Mein Blick, eben noch die Weite des Ackers gewöhnt, stellt sich auf Nähe ein. Die Kiefernstämme. Die gleichmäßigen Abstände dazwischen. Die Brombeerranken am Wegrand, blattlos und kahl. Das Licht schwindet mit jedem Meter, den ich in den Wald hineingehe. Nur einige überfrorene Farne leuchten weiß auf.
Es riecht nach nassem Sand und Kiefernharz, die Luft ist feucht, es wird Nebel geben. Beim nächsten Schritt knackt es, ein Kiefernzapfen schnellt unter meinem Schuh hervor, stößt gegen ein Büschel Farne. Reif rieselt herab. Ich ziehe den Handschuh aus und nehme eines der breitgefiederten Blätter zwischen die Finger. Der Reif schmilzt in meiner Hand, rinnt mir kalt von den Fingern. Ich muss lächeln. Geschafft. Endlich draußen.
Ich gehe. Ich atme.
Und strecke mich durch.
Mein Nacken ist noch immer verspannt, doch der Schmerz ist bereits gedämpft. Meine Schritte federn auf dem Waldboden. Vor mir liegt ein herabgesprengtes Stück Eichenrinde, ich hebe es auf. Es erinnert mich an das gegerbte Gesicht meines Großvaters. Je tiefer ich vordringe, umso dichter wird das Dornengestrüpp entlang des Weges. Der Wald rückt näher, legt sich um mich wie eine zweite Haut. Von oben fällt letztes Licht durch die Kronen der Kiefern, doch hier unten, auf dem Reisigboden, hüllt sich der Wald immer mehr in die Dämmerung ein. Die Brombeerranken werden zu drahtigen Gestalten, die Kiefern zu nunmehr grauen Säulen, ohne Rinde, ohne Struktur.
Es ist März, hatte meine Freundin gesagt, als ich eilig den Rucksack packte, nachts überfriere es noch. Aber im Grunde wusste sie, dass es keinen Sinn hatte zu protestieren. Akutes Nahweh ist stärker als ihre Bedenken. Und überaus hartnäckig. Es überfällt einen vor der Arbeit. Nach der Arbeit. Am Wochenende. In der Mittagspause. Nachts. Das Nahweh bahnt sich immer einen Weg. Zu stark ist der Drang, unverzüglich im Freien zu sein. Es zu unterdrücken macht alles nur schlimmer. Führt zu Ersatzhandlungen. Zu Ersatzbefriedigungen, die weit gefährlicher sind. Zu Alkohol und Popcorn, zu Nikotin und Chips.
Da es ohnehin stärker ist, das Nahweh, gibt es nur eine Möglichkeit, ihm zu begegnen: es zulassen, feiern, willkommen heißen. Als Gruß aus einer Zeit, zu der die Kerls noch auf den Bäumen lebten, wie es bei Erich Kästner heißt. Als kleine Mahnung gar, wer wir sind. Um dem Nahweh zu begegnen, muss man nicht ins Reisebüro und ins Internet. Man muss kein Auto in Bewegung setzen und keine Grenze queren. Man muss nur vom Schreibtisch aufstehen, die Haustür aufstoßen und nach draußen gehen.
Nahweh ist dabei äußerst unkompliziert. Es schert sich nicht um die Werbebilder der Outdoor-Industrie. Nahweh kommt ohne Patagonien aus und ohne Rocky Mountains. Es führt nicht zu Schöffel und nicht zu Globetrotter. Es lässt einen keine Zweitausend-Euro-Ausrüstung erstehen, die nach dem Erlebnisurlaub in Schweden im Keller verstaubt. Nahweh ist bescheiden und geht doch aufs Ganze. Es löst die Erstarrung. Es erlöst uns vom Dasein als Hampelmann. Es ist die Sehnsucht, mit der Welt da draußen wieder verbunden zu sein. Wer nicht mehr vierzehn ist und diese Sehnsucht noch immer kennt, wird gern belächelt. Erst von den Eltern, dann vom Partner, irgendwann von den eigenen Kindern: Werd erwachsen. Zahl deine Miete. Geh wählen. Komm endlich an.
Nicht ganz für voll genommen zu werden, das ist indes eine gute Startvoraussetzung. Um draußen zu sein, braucht man ein solides Grundmaß an Unreife. Pubertäre Anwandlungen haben sich durchaus bewährt. Zarte Ansätze von Verantwortungslosigkeit. Man benötigt keine Geistesschärfe, um draußen zu sein, keine politische Haltung und keine Religion. Man darf dieses Glück ohne Recherche erfahren und ohne Rücktrittsversicherung, ohne Ausbildung und hart erworbene Kompetenzen. Im Gegenteil: Von Vorkenntnissen aller Art ist möglichst abzusehen. Sie bergen nur die Gefahr, draußen weniger überrascht zu sein, weniger zu erleben.
Im Wald biege ich auf den Trittpfad ab, der zur Lichtung führt. Hoffentlich steht der Unterstand noch, ich war lange nicht dort. Inzwischen sehe ich nur noch wenige Meter vor mir ins Halbdunkel, Laub und Reisig liegen schwarz im Unterholz, die knorrigen Strünke aus dem Boden gerissener Wurzelballen sind unnahbare Schatten. Ich hätte früher aufbrechen sollen. Von einem Tümpel, starr unter einer Haut aus alten Blättern, steigt Nebel auf.
Der Trittpfad nähert sich dem Tümpel, wird schmaler, im letzten Moment ducke ich mich unter einem schiefen Birkenreißer hindurch.
Auf einmal spüre ich etwas vor mir.
Ich nehme die Kapuze vom Parka, um meine Sinne nicht abzuschneiden. Ich lausche. Ich starre. Nichts. Außer dem Zwielicht. Außer den Schemen der Kiefern. Dann glaube ich, ein Scharren zu hören. Wenn ich stehen bleibe, verstummt es. Wenn ich weitergehe, setzt es wieder ein.
Was ist das?
Und da ist er wieder, der Moment. Der Moment, den ich nur vom Draußensein kenne. Ich spüre das Adrenalin, die totale Wachheit, eine ungekannte Energie. Ich fühle mich aufgeputscht, in einem Zustand rigider Klarheit. Es ist die absolute Präsenz.
Wieder das Scharren.
Ich atme den klaren Nebel, den Geruch nach Harz und nach Nadeln, doch mein Atem geht zu gepresst, um die Luft bis tief in die Lungen zu saugen.
Sobald ich weitergehe, verwandelt sich das Scharren in ein Schnaufen. Als grabe jemand, als strenge das Graben jemanden ganz schön an.
Ich gehe vorsichtig weiter, der Trittpfad mündet in die Waldlichtung. Sie öffnet sich vor mir wie ein Schaukasten, wie ein Aquarium, das Licht ist diesig, verschwommen, aber eine Nuance heller als eben auf dem Pfad. Die Gräser und Farne am Boden schimmern grünlich, am gegenüberliegenden Ende sind die Schemen von Unterstand und Feuerstelle zu sehen, wo ich mein Nachtlager aufschlagen will.
Auf einmal ein Knacken im Unterholz. Jäh. Nah. Rücksichtslos. Zu laut, um durch einen Windhauch, durch herabrieselnden Reif verursacht zu sein.
Die Bilder im Kopf kommen ganz von allein. Die dunkle Kutte, die aus der Schonung bricht, das Grinsen des Verwirrten, das Messer an meinem Hals.
Doch auf der Lichtung taucht nicht mein Mörder auf, sondern ein Tier. Es steht genau zwischen mir und dem Unterstand. Ich schrecke zusammen, fasse nach dem Stamm einer Kiefer, Rinde bröckelt herab. Dann begreife ich, was aus der Schonung gebrochen ist.
Ein Fuchs.
Keine fünfzehn Meter vor mir.
Der Größe nach vielleicht ein Rüde, mit einer länglichen, eleganten Silhouette. Die spitze Schnauze. Der Schwung der Wirbelsäule. Der buschige Schwanz. Bewegungslos steht er da, bebend nur die Flanke. Aus dem dichten Winterfell, weiß an der Unterseite, ragen schwarz gestiefelte Pfoten. Ich rieche seinen leichten Räubergeruch. Ein wenig streng, ein wenig Urin, aber nicht stechend.
Ein uralter Atavismus läuft ab: Ist das Freund? Oder Feind?
Es ist, als sei der Fuchs von unserem Zusammentreffen nicht weniger überrascht. Er steht und atmet Kondenswolken aus. Auch ich stehe und atme Kondenswolken aus. Zwischen uns gerät der Bodennebel durch eine schwache Seitendrift in Bewegung, zieht ab, strömt nach. Der Nebel versteckt den Fuchs, gibt ihn frei, lässt nur den spitzen Kopf hervorschauen, dann liegen die zwanzig Meter Waldlichtung zwischen uns wieder leer im Zwielicht.
Unsere Gegenüberstellung erinnert an ein Duell. Die Kronen der Bäume und der Nachthimmel haben sich über uns zu einem Baldachin geschlossen. Doch der Fuchs scheint anders zu denken, mich eines Gegners nicht für würdig zu befinden. Gehe ich einen Schritt auf ihn zu, weicht er nicht zurück. Verharre ich, nähert er sich sogar an. Mir wird warm unter der Brust, unter der das Herz fester schlägt. Warum verschwindet er nicht? Müsste er keine Angst vor mir haben?
Er tänzelt sogar einige Schritte auf mich zu, im Schnürgang, die Hinterpfoten exakt in die Abdrücke der Vorderpfoten gesetzt. Ich atme so leise wie möglich. So wenig wie möglich. Der Oberkörper des Fuchses ist schräg zur Laufrichtung gestellt, die dreieckigen Ohren sind gespitzt. Er kommt immer näher, keine zehn Meter trennen uns noch. Ich sehe das glänzende, leicht schräg stehende Augenpaar. Die Schnurrhaare. Einen verbrannten Fleck im Deckhaar der Stirn.
Etwas wurde verrückt durch den Auftritt des Fuchses, etwas zwischen den Wald und mich geschoben. Ich höre nicht mehr, ich horche. Ich sehe nicht mehr, ich spähe. Die Freiheit, die der Wald eben noch bot, verengt sich, bekommt einen doppelten Boden. Um zum Unterstand zu gelangen, müsste ich direkt am Fuchs vorbei. Nicht möglich. Sein Bannkreis hält mich zurück. Jahrhunderte schlechten Leumunds haben Spuren hinterlassen. Der Fuchs, das war der Wilde, Sündige, Falsche, der Oberschlaue. Auch in der Schule wurde ich gewarnt: Wenn ein Wildtier nicht flieht, gib acht. Ein zahmer Fuchs sei tollwütig!
Nach einigen weiteren Sekunden, die wir voreinander stehen und einander belauern, wende ich mich ab. Der Fuchs hat gesiegt, obwohl er gar nicht gekämpft hat. Langsam setze ich Fuß um Fuß zurück, beschreibe einen respektvollen Bogen am Fuchs vorbei durchs Unterholz. Ständig bricht ein Zweig unter meinen Sohlen, ratscht ein Ast meinen Parka entlang. Der Fuchs verschwindet nicht, nimmt aber auch keine Verfolgung auf.
Während ich Reisig und Totholz zusammenklaube und vom Reif freiklopfe, wundere ich mich: Wir fahren nachts U-Bahn und auf Schnellstraßen Auto, laufen im dichten Berufsverkehr durch die Stadt und sitzen inmitten von vierzigtausend Menschen im Stadion, das zur Falle werden kann. Doch die Urinstinkte, die melden sich abseits realer Gefahr. Im Angesicht eines neugierigen Fuchses.
Im Wald.
Nach einigen Dutzend Metern durchs Unterholz traue ich mich auf die Lichtung zurück. Der Fuchs ist nicht mehr da. Wo er stand, ist nun dichter Nebel.
Endlich habe ich mein Ziel erreicht. Der Unterstand ist etwas windschief, ein morsch gewordener, runder Pavillon neben einer Feuerstelle. Immerhin, er steht noch. Die innenliegende Sitzbank bietet genügend Platz, um auf ihr zu schlafen. Seit ich den Pavillon vor einigen Jahren entdeckte, verfällt er, in einigen Jahren wird er vom Wald überwuchert sein.
Es ist kurios. Im Grunde fühle ich mich erst vollständig, wenn ich draußen bin. Doch die meiste Zeit meines Lebens habe ich drinnen verbracht. In der Schule, in der Uni, in der Wohnung, in der Bahn, am Schreibtisch. So verschieden die Orte auch waren, an denen ich mich aufhielt, eines war ihnen gemein: Sie waren von Mauern umschlossen, und über ihnen thronte ein Dach, das alles erdrückte. Offenbar war in jedem Fall eine Membran zwischen mich und die Luft draußen zu bringen. Möglichst viel Glas. Möglichst viel Beton. Möglichst viel Blech. Ich fühlte mich stets abgehängt hinter dieser Membran, meines Körpers beschnitten. Eingesperrt. Hinter Wänden, unter Zwängen. Drinnen eben.
Nur das Nahweh erinnerte mich daran, dass ich nicht nur über einen Schreibtisch, sondern auch über Muskeln verfügte. Dass sich die Muskeln sogar bewegen ließen. Dass ich diese Bewegung willentlich steuern konnte. Rennen. Ducken. Springen. Alles möglich, da draußen. Nahweh ist der Freund, der ein wenig mütterlich ist, einen beständig neu anstupst, es anders, es richtig zu machen. Der Freund, der es gut mit einem meint, dessen Ratschläge manchmal zwar ungebeten sind, von denen man aber weiß, dass es die richtigen sind. Nahweh ist die Kraft, die uns immer wieder nach draußen bringt.
Ich ziehe blättrige Birkenrinde von einem Stamm, die besonders leicht brennt, schnitze Späne von den aufgelesenen Ästen, schichte Reisig dazwischen, entzünde die Birkenrinde mit einem Feuerzeug. Es schwelt. Es dauert. Der Rauch steigt nicht auf in dem Nebel, drängt zur Seite, rollt zu Boden, dringt in den Pavillon. Doch als endlich Flammen aufzüngeln und Funken in den von Zweigen gerahmten Himmel aufschlagen, ist der Wald wieder, was er vor der Begegnung mit dem Fuchs war. Schutz, nicht Bedrohung. Nicht Fremder, sondern Freund. Das Knistern macht die Stille vergessen. Schatten lösen sich in harmlose Äste auf. Oben in den Kiefern zeigt sich der Mond.
Ich lege die Isomatte auf die Holzbank und blicke über die Brüstung in die Flammen. Gönne mir einen großen Schluck Wodka, um zur Ruhe zu kommen.
Rauskommen, dachte ich lange, sei das Vertauschen von Orten. Man zahlt viel Geld und fliegt weit weg. Man verlässt einen Kontinent, um einen anderen aufzusuchen. Tauscht Stadt gegen Land. Flachland gegen Gebirge. Mallorca, Mauritius, Malediven: mit wenigen Klicks im Internet bin ich da. Doch die schönsten Reisen fordern kein Vertauschen von Orten, sondern ein Vertauschen von Zeiten. Statt Buchungsformularen von EasyJet und AirBnB bietet das Draußensein ungekannte Freiheiten. An Orten, die nicht fremd, sondern ganz in der Nähe sind.
Zugegeben: An einem Samstagnachmittag ist es schwierig, im Wald zu verreisen, wo bald jede Senke, bald jede Biegung bekannt ist, jeder Waldweg von Spaziergängern bewandert. Doch muss man deswegen nicht gleich ins Flugzeug steigen. Es genügt, denselben Ort zu einer anderen Tageszeit aufzusuchen. Es genügt, die Koordinaten des Alltags leicht zu verschieben. Und schon wird das allzu Bekannte allzu fremd.
Beim nächsten Schluck Wodka stelle ich überrascht fest, dass ich den Flachmann beinahe ausgetrunken habe. Mir ist schon ganz warm auf der morschen Holzbank. Das Feuer wärmt zusätzlich. Ich feiere mein Draußensein mit einer einzelnen Zigarette. Inhaliere ihren Rauch, der mir nicht schmeckt. Ich schnüre den Schlafsack enger, fühle mich geborgen darin. Schnippe die Kippe in die Glut. Das Feuer brennt auch ohne mein Zutun herunter. Immer wieder fallen mir die Augen zu. Das Grillen verschiebe ich auf den nächsten Tag.
Und dann erwache ich von dem scheußlichen Bellen der Wildtiere. Es klingt heftig, ganz anders als das Bellen von Hunden, rauer, urtümlicher, würgender.
Wildschweine? Wölfe?
Mein Puls rast.
Der Schatten eines großen Tiers huscht über die Lichtung, verschwindet im Unterholz. Fluchtartiges Hufgetrappel. Zwei weitere Tiere setzen nach, eines links, das andere rechts des Unterstands. Hinter mir bellen weitere Tiere, sie klingen älter, zorniger. Sie halten auf den Unterstand zu, umrunden ihn, folgen einige Meter der Lichtung, verschwinden dann in einer angrenzenden Senke. Bellen von vorn, Bellen von hinten. Auf einmal Aufregung, eine Art Schrei, eines der Tiere scheint in der Böschung gestürzt zu sein. Hastig prescht ein neuer Tierschatten an mir vorbei, ich meine, seinen Windhauch zu spüren.
Ich krame mein Telefon hervor, bediene es mit verfrorenen Fingern. Die Uhrzeit, die auf dem Display aufleuchtet, versetzt mir einen Schlag. Es ist halb eins in der Nacht. Ich hatte gehofft, dass ich diese Stunden verschlafe, in denen die Nacht am leisesten und am finstersten ist, das Feuer aber nicht mehr brennt. Ich bringe das Display zum Leuchten, spiele mit dem Gedanken, zu Hause anzurufen.
Und dann? Wo bist du? Im Wald? Und warum rufst du an? Du fürchtest dich im Dunkeln? Oh.
Nein.
Ein Anruf scheidet in jedem Fall aus. Ohnehin habe ich so gut wie keinen Empfang.
Noch einmal brandet Hufgetrappel auf, erneutes Bellen, nun aber schon etwas ferner, dann verklingen die Hufe, das Bellen, das Keuchen im Wald. Ein letzter Ast bricht, dann ist es still.
Mein Puls aber beruhigt sich nicht. Ich kann nichts dagegen tun. Er prescht genauso voran wie die Tiere.
Aus der Stille ist wieder Beklemmung geworden, aus der Dunkelheit Bedrohung. Ich ruhe nicht, ich lauere, beobachte mich beim Beobachten, so macht das Draußensein keinen Spaß.
Immerhin, die Wildtiere kehren nicht zurück. Ich lausche, bis ich das Blut in der eigenen Ohrmuschel höre. Es ist die schiere Körperlichkeit, um mich herum herrscht schrankenlose Nacht.
Dann, plötzlich, blitzt etwas auf der Lichtung auf, hinter der erloschenen Feuerstelle. Zwei kleine, glänzende Punkte. Ein Fernglas, auf mich gerichtet. Dann ein knackender Ast. Eine Böe im Kiefernwald über mir. Darüber keine Sterne. Wo einmal Himmel war zwischen den Wipfeln, ist alles nur schwarz.
Und dann begreife ich: Es ist der Fuchs. Es ist sein Augenpaar, das aus dem gegenüberliegenden Hain leuchtet.
Erneut reagiert mein Puls. Ich höre ihn in den eigenen Ohren. Ich weiß nicht, was der Fuchs in mir sieht. Aber dass er mich erneut aufgesucht hat, macht mir bewusst, wie fremd ich an diesem Ort bin. Erst das Bellen. Nun der Fuchs. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Immer wieder vergewissere ich mich der Gegenwart des Fuchses, die beiden Augen glimmen silbern, so hell wie zuvor die Glut.
Dann scheint er näher zu kommen. Das Augenpaar wird größer, ich sehe nun auch seine Silhouette in der Dunkelheit.
Es ist mir zu viel.
Ich gebe auf.
Es wird kein Sonntagsspaziergang werden, dem Trittpfad durch die Nacht zu folgen, aber im Pavillon ist es nicht mehr auszuhalten. Ich falte den Schlafsack in den Rucksack, zwinge mich zu langsamen Bewegungen, um den Fuchs nicht zu erschrecken, das Kochgeschirr lasse ich stehen. Ich klettere über die Brüstung des Unterstands, auf der Seite, die dem Fuchs abgewandt liegt, tappe einige Meter durch die Dunkelheit, schalte dann die Taschenlampe an. Der Lichtkegel bricht sich im Bodennebel, streift über Farne und Ranken, die Fratzen tragen und mich verspotten, das Licht fällt auf eine Kröte, die unbeholfen in Richtung Tümpel tappt. Ich schalte das Licht wieder aus.
Die Kiefern rechts und links rücken näher, scheinen sich herabzubeugen. Ich blicke nicht hinter mich. Der Pfad ist kaum zu erkennen, Schatten allenthalben, die ich nicht zuordnen kann, die sich bewegen. Einige Brombeeren haben ihre Ranken quer vor mein Schienbein getrieben, haken sich in der Jeans fest. Ein langer Strunk, an dem vertrocknete Hagebutten baumeln, schnellt mir ins Gesicht. Im letzten Moment schließe ich die Augen.
Schritt um Schritt folge ich dem Pfad, weitere Kröten springen auf, gehen klackend auf der Blätterhaut des Tümpels nieder, in der Kälte um ihre Behändigkeit gebracht. Endlich biege ich auf den Weg, der aus dem Wald hinausführt. Meine Knie geben immer wieder nach. Es ist ein Zucken, das mir den Rumpf hinaufkriecht, bis in die Arme strahlt. Erst als ich den Waldrand erreiche und auf den freien Acker hinauslaufe, atme ich durch, beruhigt sich mein Puls.
Der Acker ist weit, der Feldweg hell, der Mond von Nebel verhangen. Zwei, drei Kilometer entfernt steht eine Straßenlaterne, nichts als ein gelber Punkt. Dahinter ein einzelner Hof. Es ist absurd. Ich weiß nicht, wer dort wohnt, aber der alleinige Anblick beruhigt mich, verleiht mir neue Sicherheit. Hinter mir der Wald, vor mir der Acker, klare Luft, Stille. Erst jetzt kann ich mich wirklich einlassen auf das Wunder, draußen zu sein.
Ich lehne mich im Schlafsack gegen eine der Kiefern und weiß, ich bin am Ziel. Im Freien. Frei. Ich beschließe, die Nacht genau hier, am Waldrand, zu verbringen. Mir ist nicht mehr kalt, ich habe die Augen geöffnet, sehe aber nirgendwohin. Ich sehne mich nicht mehr nach dem nächsten Tag, bereue nicht, dass ich den zurückliegenden am Rechner verbracht habe. Ich bin hier. Alle Anspannung ist abgefallen. Es ist der Moment, der süchtig macht.
Die meisten von uns suchen ja irgendetwas. Den richtigen Partner. Einen besseren Job. Den Sinn des Lebens. Ich unterscheide mich da nicht. Selbst wenn ich einmal etwas gefunden habe, ein Adjektiv oder auch nur eine Sense, weiß ich nie, ob es nicht noch etwas Besseres gibt. Jetzt aber, für den Moment, in dem ich draußen bin, habe ich alles gefunden. Die Suche hört auf. Den Ausweitungsmodus lasse ich hinter mir.
Ich sehne mich nicht, plane nichts und will nichts erreichen. Draußen kann ich meine Aussprache im Englischen nicht verbessern, kein Geld verdienen und niemandem einen Projektvorschlag unterbreiten. Draußen genügt es, da zu sein.
Die Zigarette am Feuer, der Wodka auf der Holzbank, das war noch das Abziehbild aus der Outdoorwerbung. Mein Hochgefühl beim Rauchen in etwa so authentisch wie der Marlboro-Mann. Erst der Fuchs und die Flucht durch den Wald haben mich wirklich nach draußen geführt. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, warum die Menschheit sich so viel Mühe gegeben hat, mit Tantra, Bhagwan, Zen und Transzendenz. Wo es doch viel einfacher geht.
Stiefel, Parka, Wald.
Das genügt.
Hinter mir ruft kein Kauz in dieser Nacht. Über mir geht kein Stern auf. Ich bin nicht eins mit dem Wald. Ich bin immer noch ich. Aber als der Mond im Laufe der Nacht etwas freier liegt, der Feldweg noch heller beschienen, steige ich aus dem Schlafsack und gehe einige Schritte in das Licht hinein, als zöge mich jemand an unsichtbaren Fäden.
Am Waldrand wache, schlafe, träume ich, mal im Sitzen, mal im Liegen, der Morgen lässt auf sich warten, ist dann ohne Ankündigung da. Ein Schweif Licht am östlichen Ende des Ackers. Noch ohne Farbe. Noch ohne Wärme. Doch mit dem Licht geht ein neuer Raum über dem Acker auf. Milchiger Nebel, der weniger dicht, im Morgendämmer nicht beengend ist. Überfrorene Spinnweben im Gegenlicht. Dann rötet sich der Osten in Minutenschnelle, vorsichtig ragt die obere Rundung des Sonnenballs aus dem Nebel heraus.
Ich schäle mich aus dem Schlafsack und strecke die klammen Glieder, springe ein wenig auf und ab. Ich habe noch nie mit Handschuhen geschlafen, offenbar schützen sie nicht. Eine dicke Wolke weißer Luft dringt aus meinem Schlund, und während Zehen und Finger weiter brennen vor Kälte, kommt vom Herzen her neue Wärme auf.
Dann gehe ich zum Unterstand zurück. Nicht ohne Stolz. Wenn ich auch nicht im Wald übernachtet habe, so doch am Waldrand. Geschafft ist geschafft. Das Licht im Wald wirft keine Schatten, kalt stehen die Kiefern im Morgengrauen. Der Reif auf dem Reisigboden weist Trittsiegel auf, die den Waldweg kreuzen. Hüpfende Geläufe von Amseln oder von Raben, klobigere Hufe, Wildschweine vielleicht, die auf Nahrungssuche durch den Wald gezogen sind.
Natürlich: Wildnis sieht anders aus. Dies ist der märkische Wald, nicht die Wildnis. Hier ist nicht Kanada, nicht Brasilien, nicht der Ural. Der Wald, in dem ich gehe, ist eingehegt und gepflegt. Er verfügt über Abschussfreigaben und Hochsitze, über einen Pavillon und eine Försterei. Er wird gezähmt durch Waldwege, durch Baumschulen und Holzschlagplätze, und zu Arbeitszeiten durchzieht ihn schon mal eine Wolke Traktorengestank.
In Deutschland ist an Wildnis kaum etwas übrig geblieben. Hier gibt es keinen Urwald, allenfalls ein paar Urwäldchen, den Thüringer, den Bayerischen Wald. Sie klingen nicht recht, diese Namen, zumindest nicht wild, aber das liegt nicht an den Wäldern, das liegt an uns. Wir glauben ja, Deutschland sei zusammenhängend zubetoniert. Doch das stimmt nicht. Die Wildnis liegt vielleicht in der Ferne, die Wunderwelt aber findet sich direkt vor unserer Tür.
Ich biege auf den Trittpfad ab, passiere den Tümpel, an dem in der Nacht die Kröten davonsprangen, bewundere wieder die tapfer gegen den Reif anstrebenden Farne, denen das Grün in den Spitzen wässrig geworden ist wie bei einem zu stark gekühlten Salatkopf.
Dann erreiche ich die Lichtung.
Hier sind es eindeutig Paarhufer, die ihre Spuren hinterlassen haben, keine Wolfstatzen, das sehe sogar ich. Der Austritt der Tiere aus der Böschung, die gehetzte Umrundung des Unterstands, die Flucht über die Senke, alles lässt sich genau nachzeichnen.
Aber wenn es Paarhufer waren, was hat dann so gebellt? Wölfe waren es jedenfalls nicht.
Und der Fuchs?
War ebenfalls keiner.
Was ich nachts für sein glühendes Augenpaar hielt, ist das polierte Metall eines Hydranten gewesen, der gegenüber dem Unterstand zwischen zwei Tannen steht und vor Waldbränden schützen soll.
Im Pavillon steht noch immer mein Kochgeschirr, unberührt. Verlassen in allerhöchster Gefahr. Die Panik lässt sich nicht mehr nachempfinden. Von hier bin ich geflohen? Einem Grillplatz? Im märkischen Wald? Ich habe mich aufgeführt, als hätte ich zwischen Boas und Tigern am Amazonas genächtigt. Ich war ein anderer, in diesem Moment. Aber was hat es hervorgerufen, dieses Gefühl der Gefahr? Ein nächtliches Bellen?
Ein Fuchs?
Nein, im märkischen Wald ist nichts, wovor man Angst haben muss. Angst hatte ich vielmehr vor dem, was nicht da war. Vor dem, was es gar nicht gibt. Nicht draußen, jedenfalls. Ich war noch drinnen, als die Angst aufkam, noch in den alten Geschichten und Filmen gefangen.