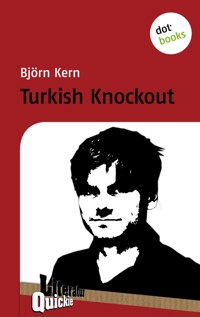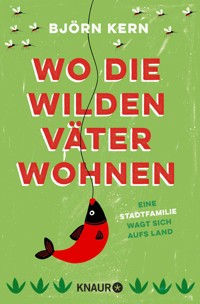9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Nichtstun heißt ja nicht, dass ich nichts tue. Nichtstun heißt, die falschen Dinge sein zu lassen.« In seinem neuen Buch ›Das Beste, was wir tun können, ist nichts‹ erzählt der preisgekrönte Schriftsteller Björn Kern, wovon wir alle träumen: Mehr Zeit, weniger Arbeit, mehr Leben. Wunderbar komisch und charmant schildert er seinen ganz eigenen Abschied von Fleiß und Tatendrang hin zu mehr Gelassenheit. »Früher war ich effizient, leistete sogar Multitasking. Eine scheußliche Fähigkeit, die einem noch fragilen Nichtstun schnell Schaden zufügt. Es kam vor, dass ich links das Kind auf dem Arm hielt, während ich rechts die Maus bediente, dabei aber telefonierte. In meinen dunkelsten Stunden kaufte ich bei Tchibo ein und rief bei Hotlines an. Bis mir klar wurde: So konnte es nicht weitergehen. Was war zu tun? Irgendwann ging es mir auf: Nichts!« Björn Kern beschließt, auf einen alten Hof in den verlassenen Weiten des Oderbruchs zu ziehen. Seither arbeitet er so wenig wie möglich und verbringt seine Tage größtenteils auf einer Bank unter einem Birnbaum. Von dort aus erzählt er ebenso inspirierende wie pointierte Geschichten vom Nichtstun, in denen er nicht zuletzt auf ganz praktische Fragen eingeht: Ich habe einen Job, den ich nicht kündigen kann – was tun? Wie schaffe ich es, keinen neuen Rechner und kein neues Smartphone zu kaufen, geschweige denn eine Klappsense vom Baumarkt mit Plastikgriff? Warum macht Nichtstun so glücklich und rettet nebenbei auch noch die Welt? ›Das Beste, was wir tun können, ist nichts‹ ist Memoir und Manifest zugleich, Anleitung und Aufruf an alle, die vor »zu viel Arbeit« und »zu wenig Zeit« gerade dabei sind, das Beste im Leben zu verpassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Björn Kern
Das Beste, was wir tun können, ist nichts
Über dieses Buch
»Es ist nicht einfach, nichts zu tun, ohne sich dabei zum Deppen zu machen. Wer etwas tut, hat das Verständnis auf seiner Seite. Wer nichts tut, leidet unter Rechtfertigungsdruck. Erst arbeitet man, heißt es, dann vergnügt man sich. Die Irrlehre sitzt tief.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
ISBN 978-3-10-403663-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Unterm Birnbaum
Luftschlösser und Sandburgen
Kleine Morgenmeditation
Pierre und Marie und die Ziegen
Herr Schrader, was können wir für Sie tun?
Zehntausend Dinge
Rückwärts aus der Sackgasse
Alles in Ordnung, mein Schatz?
Beinahe in Polen
Die Weltzeitskala
Tag der Buße
Beim nächsten Mal fragst du mich!
Tauben aufblasen
Auch Gips sollte man nicht unterschätzen
Die Welt in einer Nussschale
Angeln ist auch keine Lösung
Tabubruch
Ganz schön fleißig
Ab in den Warenkorb
Wie wende ich entbehrliche Taten ab?
Damals in der Lehre
Nichtstun ist schön, macht aber viel Arbeit
Und das ist auch gut so
Wildschweinbefall
Die Welt ohne Bildschirm
Wer will fleißige Handwerker sehen?
Fleiß und andere Altlasten
Schmerzensgeld
Wir nennen es Arbeit
Die Stunde der heimlichen Sammler
Nichtstun in der Unterwelt
Unterm Zapfhahn
Das Superhandy
Gleichgewicht des Schreckens
Der kleine Bruder
Das Paketzustellerballett
Lässig und tiefenentspannt
Das Leben der anderen
Zukunftsweisend
Und wer soll das alles bezahlen?
Ein Geständnis
Gewonnene Lebenszeit
Schaut auf diese Stadt!
Schlafen Sie nackt
Buddha unterm Birnbaum
Neues aus der Anstalt
Nichtstun im Arbeitsalltag
Der Praxistest
À la tradition
Tage wie diese
Neue Heimat
Augen auf bei der Partnerwahl
Nichtstun mit dem falschen Partner
Liebe in Zeiten der Scheinnähe
Zeit für die Siesta
Der Sanierungsfachmann
Eine alte Regel
Eigentlich nichts
Auf Entzug
Return to sender
Geh mal nach Peking!
Sie sind viel weiter als ich im Nichtstun?
Fahrerflucht
Kitchen stories
Wie jeschmiert
Bangladesch und ich
Geldverdienen unterm Birnbaum
Und noch mehr Geld
Auf Ihrem Konto befindet sich Geld. Was ist zu tun?
Frühlingsgefühle
Auftritt: der Heiland
Was tun, wenn Sie aufgefordert werden, einen Neukauf zu tätigen?
Zarter Fortschritt
Ozelotnasen und Ingwerwurz
Das arme Kind
Verbotsfreie Zone
Übermut tut gut
Ich gehe. Ich atme.
Blowin’ in the wind
Umfassendes Tätigkeitsverbot
Urlaubsstreik
Rezeptvorschlag für den Herbst
Nichtstun an Weihnachten
Mein Hof ist mein Hirte
Ein letzter Rest Würde
Und Schluss
Dank
Unterm Birnbaum
Wenn ich im Hochsommer auf meiner Bank im Oderbruch sitze, die Füße in eine Wanne voll Eiswasser getaucht, ein kaltes Bier neben mir, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Vor mir leuchtet das Kornfeld so gelb, dass es beinahe schon blendet, und die Libellen aus dem Entwässerungsgraben schießen in die Luft und umkreisen mich und verschwinden dann wieder im Wiesengrund. Mal huscht ein Wiesel vorbei, mal bricht ein Wildschwein aus dem gegenüberliegenden Hain, der Birnbaum über mir treibt seine Früchte aus.
Bin ich einmal traurig, genügt es, dass ich mich ausreichend lang auf die Bank setze, schon sind meine Sorgen nichtig geworden und klein. Vor keiner noch so großen Kinoleinwand kann ich annähernd so schöne Bilder bestaunen, wie ich das von meiner Bank aus vermag, den Himmel, das Feld und die Weite. Und wenn direkt über mir eine Biene den Birnbaum anfliegt und zehn Fuß vor der Bank ein Reh durch das Gras streift, klingt das besser als Dolby Surround. Ich brauche nicht fortzugehen, um aufzubrechen, ich muss nichts tun, nur das Richtige unterlassen, ich brauche nichts als die Bank und das Feld.
Die Bank war ein Bausatz und hat neunzehn Euro neunzig gekostet. Ein paar Bretter, ein paar Schrauben, mehr nicht. Doch die Bank war nicht nur günstig, es lässt sich sogar Geld mit ihr verdienen. Freilich braucht es dafür bereits einige Erfahrung im Nichtstun. Der Trick kann daher an dieser Stelle noch nicht verraten werden, nur so viel vorab: Wenn man mit der Bank Geld verdienen will, genügt es, sich daraufzusetzen und, ganz wichtig, nicht wieder aufzustehen.
Luftschlösser und Sandburgen
Nichtstun hat mich in meinem Leben immer sehr glücklich gemacht. Schon als Kind lag ich lieber im Sandkasten, als darin zu sitzen, und schaute lieber in den Himmel, statt Sandburgen zu bauen. Als Jugendlicher verbrachte ich ganze Sommer rücklings auf dem Steg eines nahen Waldsees. Ohne Weltschmerz, ohne Drogen, vor lauter Nichtstun war ich viel zu glücklich dazu. Im Grunde war mir damals bereits klar, dass Nichtstun meine Berufung ist, der mir vorherbestimmte Weg. Ich traute mich nur nicht, es mir einzugestehen. Als Dinge wie Ausbildung, Erwerbsarbeit und Familiengründung in mein Leben traten, schienen sie einem umfassenden Nichtstun im Wege zu stehen. Erst mit den Jahren fand ich heraus, dass sich Nichtstun hervorragend mit ihnen vereinbaren lässt.
Eine kleine Warnung vorab: Es ist nicht einfach, nichts zu tun, ohne sich dabei lächerlich zu machen. Wer etwas tut, hat das Verständnis auf seiner Seite. Wer nichts tut, leidet unter Rechtfertigungsdruck. Angeblich muss man es sich verdienen, nichts zu tun. Frei zu sein. Erst arbeitet man, heißt es, dann vergnügt man sich. Die Irrlehre sitzt tief. Noch heute fällt es mir leichter, am Abend nichts zu tun, als am Morgen. Ich muss nicht erwähnen, dass morgendliches Nichtstun die eigentliche Königsdisziplin darstellt.
Nichtstun widerfährt einem nicht nebenbei. Es bedeutet nicht, nichts zu tun zu haben. Gelingendes Nichtstun fordert Konzentration ein und bedarf eines magischen Quäntchens Glück. Im Grunde ist Nichtstun nicht, was es behauptet, sondern ebenfalls eine Tätigkeit. Die Urtätigkeit, die uns lange geläufig war und dann verlorenging. Nichtstun ist keine Tätigkeit wie Radfahren, einmal erlernt, für immer beherrscht, es bedarf täglichen Trainings. Wer außer Übung ist, erfährt Nichtstun als Melancholie. Auch ich muss das Nichtstun immer wieder neu erlernen.
Wer nichts tut, befindet sich in der Verteidigungshaltung. Wer seine Gesundheit nicht ruiniert und keine Dinge erwirbt, die seine Lebensgrundlage zerstören, und dann auch noch gut gelaunt ist, weckt Unmut. Früher habe ich mich noch jedem Einwand gestellt. Wer soll das finanzieren? Halte ich mich für etwas Besseres? Verschwende ich mein Leben? Bin ich faul? Irgendwann wurde mir das zu mühselig. Die Auseinandersetzung mit der Meinung der anderen brachte mich um erquickliche Stunden voll erfüllendem Nichtstun. Seitdem höre ich auf niemanden mehr. Meinen märkischen Nachbarn einmal ausgenommen.
Wenn man aufhört, auf die anderen zu hören, nimmt man auf einmal wahr, was man davor überhört hatte: die leise, vom Unterbewusstsein aufsteigende Stimme menschlicher Bedürfnisse, die nur selten darum bittet, zur Arbeit zu fahren, im Stau zu stehen, sich vor dem Bildschirm den Nacken zu reiben oder schon wieder eine Mail mit »Lieber Herr Hartmann« zu beginnen, obwohl der liebe Herr Hartmann der letzte Idiot ist, wie jeder weiß. Eigentlich will man das alles nicht. Eigentlich will man frische Luft, weite Sicht, ein bisschen platonische und sehr viel körperliche Liebe. Grundlage dafür: gelingendes Nichtstun.
Nichtstun ist oft nicht einfach. Es verlangt uns viel, manchmal alles ab. Dafür macht Nichtstun glücklich, ist unschädlich und umweltfreundlich. Nur die Wirtschaft kurbelt Nichtstun nicht an. Wir können nun entweder glücklich sein und auf das Kurbeln verzichten, oder wir kurbeln und verzichten aufs Glücklichsein. Noch entscheiden wir uns für die zweite Möglichkeit. In Bhutan haben sie sich dagegen fürs Bruttoinlandsglück entschieden. Das wächst vor allem dann, wenn man gar nichts tut.
Kleine Morgenmeditation
In bester Absicht habe ich mich an den Rechner gesetzt und warte nun geduldig, dass er hochfährt. Solange er hochfährt, kann ich leider nicht arbeiten. Ich schaue durchs Fenster. Da es geregnet hat, stehen die Felder in leichtem Nebel. Am Birnbaum taumelt ein abgeknicktes Blatt, das sich auch bei stärkeren Böen nicht vom Ast löst, Tag für Tag trotzt es dem Wind. Genau in dem Moment, in dem der Rechner hochgefahren ist, lichtet sich draußen der Nebel, die Sonne bricht durch. Sofort verlasse ich das Haus. Ich bin nicht gläubig und nicht spirituell. Aber es scheint mir unanständig, die Schönheit draußen nicht anzunehmen, die sich auflösenden Nebelbänder über dem Feld, das Reh, das davonspringt, sobald ich die Tür öffne, den Reiher, der am aufklarenden Himmel kreist.
Vor dem Rechner zu bleiben, das ist, als würde man in eine Ausstellung gehen, sich aber keines der Bilder ansehen. Zu Recht wäre der Künstler enttäuscht. Auch ich wäre enttäuscht, wenn ich die Schönheit des Oderbruchs geschaffen hätte, die Bewohner des Oderbruchs aber nur vor dem Rechner säßen. Ich würde mir eine Strafe für jede vor dem Rechner verbrachte Stunde ausdenken. Hier eine Sehnenscheidenentzündung, dort ein Bandscheibenvorfall.
Ich stehe. Ich staune. Ich atme.
Das Reh verharrt, begreift mich nicht mehr als Gefahr, nähert sich wieder den Ähren, gelbrotes Fell vor rotgelbem Korn. Es wittert, macht halt, senkt den Hals, erst zur Probe, dann ein zweites Mal, sieht zu mir herüber, als bitte es um Erlaubnis. Endlich zupft es den ersten Strohhalm hervor.
Schönheit muss man sich leisten können?
Zeitlich? Finanziell?
Das habe ich auch lange gedacht. Doch es ist höchste Zeit, mit diesem weitverbreiteten Irrtum aufzuräumen. Der Genuss von Schönheit ist nicht nur günstig und jedem von uns zugänglich, sondern auch immerzu möglich. Grundlage dafür: gelingendes Nichtstun. Wie sich diese Grundlage schaffen, pflegen und nach und nach erweitern lässt, steht in diesem Buch. Geld benötigen Sie jedenfalls nicht dafür.
Einige meiner Nachbarn verwechseln mein morgendliches Nichtstun mit Faulheit. Tatsächlich aber ist es Ausdruck von Hochachtung, wenn nicht von Verehrung. Ich tue nicht nichts, um nicht zu arbeiten, sondern ich arbeite nicht, um die Bank am Grundstücksende von Morgentau zu befreien, ein erstes Bier darauf zu trinken, in die Weite zu schauen, auf den schwirrenden Punkt, der nicht oben, nicht unten ist, und aus Gründen der Ehrfurcht einmal nichts zu tun. Vor einem Bandscheibenvorfall hat mich diese kleine Morgenmeditation bislang bewahrt.
Nicht alle Nachbarn haben dafür Verständnis, dass ich bei schwindendem Nebel gerne mit einer Bierflasche auf meiner Holzbank sitze, auch wenn es gerade zehn Uhr morgens und zufällig Montag ist. Seltsamerweise ist mir das gesammelte Verständnis gewiss, wenn ich das Bier am Samstagabend um acht trinke. Der Unterschied leuchtet mir nicht recht ein.
Pierre und Marie und die Ziegen
Ich fürchte, dass ich Nichtstun bis heute mit Faulheit verwechseln würde, wenn ich damals, nach der Schule, nicht Pierre und Marie kennengelernt hätte. Pierre und Marie hatten einen wundervoll verkommenen Hof im französischen Doubs mit einem Stall voller Ziegen. Ich wurde ihr Praktikant. Anfangs sollte ich nur lernen, Ziegenkäse zu machen, doch dann lernte ich weit mehr. Ich war nur sechs Wochen dort, doch vor allem Pierre lehrte mich, unnötige Tätigkeit und nötiges Nichtstun genau zu unterscheiden. Gerade weil er nichts Missionarisches an sich hatte, wurde er mir zum Missionar.
Pierre war alle nötigen Karriereschritte rückwärtsgegangen, um endlich zum Nichtstun zu finden. Er war etwa fünfzig und hatte seine zweite Lebenshälfte dazu verwendet, die Fehler der ersten ungeschehen zu machen. In seinen Zwanzigern hatte er als Bauunternehmer bereits fünf Angestellte beschäftigt. Als einige Jahre später aus fünf Angestellten fünfzig geworden waren, zog er die Notbremse. Seine Tage müssen damals ausschließlich aus dem Bedienen von Versicherungspolicen, dem Analysieren von Steuerbescheiden und schlaflosen Nächten vor den Monatsersten bestanden haben, an denen er zu Hochzeiten eine knappe Million Francs zu löhnen hatte.
Er zahlte seine Mitarbeiter aus und machte den Laden dicht. Dann ging er auf die Walz. Er lebte in Paris und München auf der Straße, und da es dort zu kalt war, bald in Rom und Marseille. Als das Finanzamt ihn einbestellte, war er ungewaschen und drehte effektvoll seine Hosentaschen um. »Rien ne va plus«, sagte er dann. Das Spiel wiederholte sich einige Jahre, bis man ihn von der Liste strich. Dass er heute wieder ein Dach über dem Kopf hat, ist ausschließlich Marie zu verdanken, die sich von seinem Aussehen nicht abschrecken ließ, als er an ihrem kleinen Hof vorbeikam.
Als ich die beiden kennenlernte, war das alles Geschichte. Sie lebten bereits seit zehn Jahren zusammen und hatten einen kleinen Sohn, der sich weigerte, sprechen zu lernen. Sie liebten ihn über alles. An meinem ersten Arbeitstag geschah eine Überraschung. Da ich gelernt hatte, dass der Bauer früh in den Stall geht, weckte ich mich um sieben und saß danach volle drei Stunden allein in der Küche. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Morgenstund hat Gold im Mund. Die Irrlehren kreisten in meinem Kopf wie die Stubenfliegen auf dem etwas speckigen Küchentisch. Erst gegen zehn knarrten über mir Dielen, rauschte Wasser durch Leitungen. »Schon wach?«, wunderte sich Pierre, als er mich sah. Und er klopfte mir auf die Schulter und rauchte erst einmal zwei Gitanes ohne Filter.
Die Tage dort behielten diesen Rhythmus bei. Kurz nach Mittag, wenn wir gefrühstückt hatten, fuhr einer von uns mit einem dreißig Jahre alten Toyota rüber in den Stall. Wenn ich an der Reihe war, genoss ich die einsame Fahrt über Feldwege und Waldpfade, und wenn ich ankam, kniff ich die Augen gegen die Sonne zusammen und tat erst einmal nichts. Dann molk ich die Ziegen, was ich schneller beherrschte als gedacht: Zitze oben mit Daumen und Zeigefinger abdrücken, Milch mit den restlichen drei Fingern herausstreichen, aufpassen, dass der Eimer nicht umfällt, fertig. Natürlich taten mir bald die Finger weh. Aber dann hörte ich eben auf.
Für zwanzig Ziegen hatte ich den ganzen Tag Zeit. Es war Pierre und Marie egal, wann ich zurückkehrte, sie wollten nur bis zum Abend die Milch. Die Ankunft der Milch auf dem Hof glich einem täglichen, kleinen Fest, es wurde augenblicklich Landwein aus einem Fünfliterfass ausgeschenkt, dessen Duft sich mit dem sämigen Geruch der Milch mischte. Und da der kleine Sohn nun, am frühen Abend, seinen Mittagsschlaf hielt und nicht bespaßt werden wollte, taten wir erst einmal nichts.
Allenfalls aßen wir ein wenig Brot, ein wenig Chèvre, bevor wir alle zusammen in die Käserei hinübergingen, die Milch labten, den frischen Chèvre vom Vortag wendeten, den aus der Vorwoche aus der Form brachen, den für den morgigen Markttag in Folie wickelten, um dann wieder ins Wohnzimmer zum Rotwein zurückzukehren, wo der kleine Sohn eines Tages sein erstes Wort sagte, nämlich, so waren wir uns alle drei einig: rien, also nichts. Die wenigen Käserollen, die wir am Wochenende auf dem Markt verkauften, brachten so gut wie kein Geld ein, aber mehr, als sie einbrachten, brauchten Pierre und Marie nicht.
Herr Schrader, was können wir für Sie tun?
Im Rückblick ist es nicht unwahrscheinlich, dass meine Initiation ins Nichtstun schon lange vor Pierre und Marie stattfand, nämlich in einem Elektrofachgeschäft, in welches ich meinen Vater seit meiner Kindheit regelmäßig begleite. Mein Vater ist ein feiner Mensch, der sich viele Gedanken gemacht hat, wie wir alle anders zusammenleben könnten. Aber in einem tut er mir sehr leid. Im materiellen Sinne ist er immer Kind seiner Zeit geblieben. In seinem Fall heißt das: Kind der Wirtschaftswunderzeit. Ich kenne keine Generation, die so viel Lebenszeit darauf verwendet hat, sich dem Unbill der Dingkultur zu widmen. Dem Anschaffen, Reparieren, Austauschen und Neukaufen von Gegenständen, ohne die man vermutlich auch ganz gut gelebt hätte. Für gelingendes Nichtstun blieb da keine Zeit.
Als mein Vater seinen Haushalt einmal verkleinerte, fielen große Kisten voller Telefone aus den Sechzigerjahren, Stereoanlagen aus den Siebzigerjahren, Massagegeräten aus den Achtzigerjahren an. Mein Vater telefoniert nicht sonderlich gern. Er hört so gut wie keine Musik. Er leidet nicht unter Verspannungen. Er weiß vermutlich selbst nicht, wie die Dinge in seinen Haushalt fanden. Seit den Neunzigerjahren füllen sich neue Kisten, nunmehr mit staubigen Tastaturen, Kabellabyrinthen und Computermäusen, die entweder noch nicht per Infrarot funktionieren oder bei denen das Infrarot bereits wieder ausgefallen ist.
Denn leider war es nie damit getan, diese Dinge zu kaufen. Die meiste Zeit waren diese Dinge auch kaputt. Wenn ich meinen Vater anrufe, komme ich alle paar Wochen nicht durch. Dann wird das neue ISDN, DSL, VDSL konfiguriert, bis eine Woche später die gesamte Telefonanlage zusammenbricht. Wenn ich zu Besuch bin, müssen wir schnell mit einer Halbleiterplatine in einem Plastikgehäuse unter dem Arm in die Stadt aufbrechen (Fön, Mikrowelle, Heizkissen, Bewegungsmelder), denn in Kürze schließt der Kundendienst des Elektrofachgeschäfts. Dort kennen sie meinen Vater seit Jahren mit Namen, er trägt einen anderen als ich.
»Herr Schrader, was können wir für Sie tun?«
»Das Ding hier tut’s irgendwie nicht. Der Fernseher geht damit nicht an.«
»Die Infrarot Fujitsu Siemens DLX 2311? Die ist nicht für Ihren Fernseher, sondern für Ihren Videorekorder.«
»Ich habe keinen Videorekorder!«
»Sie haben kein VHS, richtig, aber Blu-ray haben Sie letzten Monat gekauft.«
»Aber Sie hatten gesagt, das ist eine Fernbedienung für alles. Fernseher. Radio. Video.«
»Nur, wenn die Geräte von derselben Marke sind. Ihr Fernseher ist aber nicht von Siemens.«
»Dann brauche ich einen Fernseher von Siemens.«
»Vielleicht nehmen Sie erst einmal eine neue Fernbedienung?«
»Eine neue? Ich dachte, die alte ist gar nicht kaputt?«
Von diesen Gesprächen führt mein Vater im Monat durchschnittlich zwei. Dabei hat er keinerlei Drang zur Selbstzerstörung. Er liebt lange Waldspaziergänge und ist ein hervorragender Großvater. Es ist nicht so, dass er all diese Dinge freiwillig gekauft, repariert, ersetzt hätte. Er konnte nicht anders. Er war Gefangener seiner eigenen Gegenstandswelt. Irgendwann begriff ich, dass er damit nicht alleine ist: Wer eine Nespresso-Maschine hat, muss in den Laden fahren, in dem es diese speziellen Kapseln gibt. Oder sich durch das Bestellformular im Internet arbeiten. Wer eine Mikrowelle hat, muss irgendwann die Glühbirne darin ersetzen. Und eine Mehrfachsteckleiste besorgen, weil der Tischgrill auch noch angeschlossen werden will.
Wenn er abends beim Wein saß, konnte mein Vater überzeugend darlegen, warum er verachtete, was er da tat. Aber am nächsten Morgen funktionierte schon wieder der Drucker nicht.
Letztlich bin ich meinem Vater sehr dankbar dafür, dass er mir gezeigt hat, wie Nichtstun niemals gelingt. Das hat mir viele Umwege erspart. Und was ist gelingendes Nichtstun anderes als das Vermeiden unnötiger Umwege?
Zehntausend Dinge
Auf einmal war die Zahl in der Welt und wurde immer wieder abgeschrieben. Ob sie stimmt, lässt sich schwer überprüfen, aber irgendjemand hatte offenbar nachgezählt. Über zehntausend Dinge müllen angeblich einen durchschnittlichen Haushalt voll. Zehntausend Dinge, die angeschafft und in Betrieb genommen, die repariert und ersetzt und instand gehalten werden müssen, die klemmen und quietschen und tropfen und brechen, die immer zu laut oder zu leise sind, die immer langsamer werden oder zu schnell funktionieren, die hinter Sofas rutschen und wieder hervorgeangelt werden müssen, im Winter schnell spröde werden und im Sommer leicht austrocknen, die herunterfallen und springen, an denen man sich sticht und stößt, die einem die Bewegungsfreiheit rauben und manchmal den Schlaf, die an der Wand mit Nägeln befestigt werden müssen, die aus dem Putz brechen, deren Rahmen verbiegen, die zu modern anfangen oder versehentlich mit dem Altpapier aus dem Haus getragen werden, die man erst braucht, wenn sie verschwunden sind.
Zehntausend Dinge, die schon wieder einen Fettfilm bilden oder sich bei zu starker Hitze verformen, die eine Entscheidung vor dem Spiegel einfordern, lang oder kurz, Wolle oder Seide, die nie aufeinander liegen bleiben, deren Akku schon wieder leer ist, weil sie auch im Stand-by-Modus Strom verbrauchen, die Pflegeprodukte benötigen und Sorgfalt im Umgang, denen man das Alter auch schon wieder ansieht und von denen es bereits Nachfolgemodelle auf dem Markt gibt, die man nicht braucht, aber ausstellt, wenn derjenige zu Besuch kommt, der sie geschenkt hat, die man besser nicht einatmen sollte, auf deren Existenz man noch vor kurzem nicht gewettet hätte, auf die man dann aber nicht verzichten will, die nicht so gut wärmen wie erhofft, die beim Einfrieren tropfen, schon beim Auspacken kaputtgehen oder nur dann funktionieren, wenn man sie hart gegen die Tischkante schlägt.
Zehntausend Dinge, die man immer länger schütteln muss und aus denen dann doch nur die Hälfte herauskommt, die früher irgendwie einfacher zu bedienen waren, heute dafür unglaublich viel können, die man mal wieder ordnen sollte, wenigstens nach Größe oder nach Farbe, die man zum Säubern mal in den Hof tragen sollte oder wenigstens aufschrauben und nach dem Batteriekontakt sehen und die danach noch immer nicht funktionieren, die immer vom Wannenrand rutschen, Falten werfen oder von Motten zerfressen sind, denen ein Knopf fehlt, über die man schon wieder stolpert und die man manchmal gern aus dem Fenster werfen würde, aber vielleicht eines Tages noch brauchen kann, die nicht mehr richtig schließen und deren Plastiklaschen schon wieder abgebrochen sind, zehntausend Dinge, die nur dafür in unserem Haushalt sind, damit sie uns davon abhalten, nichts zu tun.
Rückwärts aus der Sackgasse
Zwanzig Jahre. So lange ist es her, dass ich bei Pierre und Marie in die Lehre gegangen bin. Ich weiß nicht, wie viele Klischees mich damals leiteten (Praktische Arbeit! Vor der Uni! Ziegenkäse! Bukolik! Frankreich!), aber ich war glücklich dort. Das folgende Studium hätte ich mir sparen können. Das Büro. Die Stadt. Erst nach einem zwanzigjährigen Umweg kam ich wieder dorthin zurück, wo ich offenbar hingehöre, nämlich aufs Land.
Zwar ist ein geisteswissenschaftliches Studium für jemanden, der nichts tun möchte, nicht völlig ungeeignet. Erst ist man nicht gefordert und dann nicht zu vermitteln. Doch der Aufwand für diese Erkenntnis war im Rückblick deutlich zu hoch. Heute weiß ich: Wer nichts tun will, sollte gleich nach der Schule mit dem Nichtstun beginnen. Learning by doing führt deutlich schneller zum Ziel.
Damals jedoch hatte die Irrlehre mich fest im Griff. Mache Praktika! Gehe ins Ausland! Ziehe in die Stadt! Vernetze dich! Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Da sich unglücklicherweise eine Berliner Textagentur für mein Diplom interessierte, wurde ich freier Mitarbeiter in einem Büro. Dazu kaufte ich mir ein Auto. Damals hielt ich Büros für Orte, an denen sich gut arbeiten lässt. Mein Irrtum hätte größer nicht sein können. Das Büro lag im Souterrain und blühte im Winter feucht aus, die Kollegen nannten es nur noch die Gruft. Ich war nicht fest angestellt, für meinen Arbeitsplatz musste ich sogar Miete zahlen. Durch das Fenster drang der Lärm der Schnellstraße herein. Wenn ich es öffnete, roch ich die Abgase.
Meine ersten Aufträge kamen von Firmen, die Plastikspielzeug importierten. Ich deutschte Texte wie diesen ein: »Abwurf schleisslich mit Ringen, welcher ins Mantelkarosserie einzuführen. Vor Initial mit Öllumpen (beigefügt) durch und durch fetten. Wurf niemals auf Müttern oder Kühen gestattet. Mit geübten Wartem ein wenig Zerbrechlichkeit, wünschen das Bereitstellungs-Team.«
Erst nach Monaten – oder waren es Jahre? – schwante mir, dass ich irgendetwas falsch gemacht hatte. Die Arbeit in der Gruft machte nicht nur keinen Spaß, sie brachte auch kaum Geld ein. Vom morgendlichen Berufsverkehr war ich meist schon erschöpft, bevor ich den Computer auch nur anschaltete. Zur Erholung gönnte ich mir aufwändige Mischgetränke. Triple Hot Chocolate. Iced Caramel Macchiato. Spiced Root Beer Fizzio. Mit großem Trostbecher neben der Tastatur verbrachte ich meine Nachmittage überwiegend auf Spiegel Online und mit dem Lesen privater Mails. Abends bei meiner Freundin klagte ich über alles und nichts, ich zog sie mit in die Gruft hinab.
Irgendwann fiel Pierre mir wieder ein. Der Hof, die Ziegen, das Glück. Und ich beschloss, jeden Schritt, den ich getan hatte, um in die Gruft zu gelangen, rückwärts wieder aus ihr hinauszugehen. Als Erstes schaffte ich das Auto ab. Mein nötiges Arbeitspensum reduzierte sich sogleich um ein Fünftel. Prompt erschien ich freitags nicht mehr im Büro. Die festangestellten Kollegen beneideten mich. Leider musste ich feststellen: Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, tut sich nichts Gutes. Das ist eine der größten Gesundheitslügen überhaupt. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, bringt sich vielmehr in höchste Gefahr. Atemraubende Abgase, rücksichtslose Rechtsabbieger, hemmungsloser Straßenkampf – nach wenigen Wochen war ich am Ende. Als Nächstes gab ich also meinen Arbeitsplatz in der Gruft auf. Mit einem Schlag musste ich zweihundertfünfzig Euro Büromiete weniger verdienen. Nur langsam realisierte ich, dass ich auf eine Goldader gestoßen war.
Das nach und nach einsetzende Glücksgefühl bestärkte mich darin, weitere Dogmen der Irrlehre in Frage zu stellen. Warum durfte Arbeit nur in der Stadt, im Büro, am Computer stattfinden? Warum musste sie täglich acht Stunden umfassen? Wer schrieb das eigentlich alles vor? Jetzt wollte ich es wissen. Mit aller Kraft rüttelte ich an den Festen des Gesellschaftsvertrags, mit stetig zunehmender Konsequenz verfolgte ich den Pfad des Nichtstuns. Ich arbeitete nur noch von zu Hause und nie länger als drei Stunden täglich. Ich tauschte mein Blackberry gegen ein Handy für fünfzehn Euro ein. Ich erklärte meiner Freundin, dass ich niemals Karriere machen und niemals ernsthaft Geld verdienen würde. Sie sagte, nicht zuletzt deshalb habe sie sich für mich entschieden.
Alles in Ordnung, mein Schatz?
Dann kündigte sich das Kind an. Im Krankenhaus machte sich meine Freundin große Sorgen um mich. Sie ließ den Blick nicht von mir. »Geht’s?«, fragte sie mich. Die Geburtshelferin war empört. »Sie sind es, die hier das Kind bekommt!« – »Aber er ist so blass?« Meine Freundin blieb tapfer bis zum Schluss. Ich aber tat so verkrampft nichts, dass ich noch Wochen später unter Muskelkater litt. Als sie wieder sprechen konnte, nahm sie mich als Erstes an die Hand und fragte: »Alles in Ordnung, mein Schatz?« Tatsächlich war die Geburt der einzige Moment meines Lebens, in dem ich gern etwas getan hätte, aber zum Nichtstun verdammt war. Gütigerweise behauptet meine Freundin noch heute, in meinem Nichtstun sei ich ihr eine große Hilfe gewesen. Eine schöne Geste, wie ich finde. So war mein Nichtstun nicht ganz umsonst.
Normalerweise ist es ja so: Erst haben wir keine Zeit für uns wegen der Schule, dann keine Zeit für die Partnerschaft wegen der Ausbildung, dann keine Zeit für Kinder wegen des Berufs, dann keine Zeit für den Beruf wegen der Kinder, wir lassen uns ausbilden, dann auspressen, und erst wenn wir uns aussortieren lassen, kommen wir wieder zu uns. Mein Vater, wie viele Väter seiner Generation, wickelte und badete nicht zum ersten Mal in seinem Leben einen Säugling, als er ein Kind bekam, sondern dann, als dieses Kind seinerseits Vater wurde.
Heute ist er vernarrt in sein Enkelkind und macht wett, was er beim eigenen Kind ausgelassen hat, als er arbeiten musste. Aus nächster Nähe verfolgt er das ganze mühsame Austasten und Einfinden, Sprechenlernen und Regelbrechen, Schelmischwerden und Angstempfinden eines Charakter werdenden Menschenkinds. Mir scheint dieses Modell etwas heikel, der Scheck nicht gedeckt. Was, wenn ich nicht mehr auf der Welt bin, wenn es mein Enkelkind ist? Warum arbeiten, um Geld zu verdienen, um die Kita zu bezahlen, um arbeiten zu können? Das ließe sich doch abkürzen, dachte ich. Folglich ließ ich die Karriere einfach aus.
Inzwischen ist das Kind drei. Und ich muss zugeben: Es gibt wenig, was mehr Zeit einfordert als ein Kind in seinen ersten Lebensjahren. Nichtstun und Vaterwerden schließen sich aus, sollte man meinen. Doch das Nichtstun, das ich meine, zielt vor allem darauf, nicht das Falsche zu tun. Gelingendes Nichtstun ist ein vorzeitiges Aussortieren dessen, was man im Nachhinein besser unterlassen hätte. Gemeint ist das Nichtstun, das verhindert, dass man später einmal bereut. Und was könnte man später einmal weniger bereuen als das eigene Kind?
Zunächst jedoch litt ich unter Anlaufschwierigkeiten. Das Kind warf meine noch junge Praxis des Nichtstuns einfach über den Haufen. Auf einmal war ich effizient, leistete sogar Multitasking. Eine scheußliche Fähigkeit, die einem noch fragilen Nichtstun schnell Schaden zufügt. Es kam vor, dass ich links ein Milchfläschchen schüttelte, während ich rechts die Maus bediente, dabei aber das Telefon zwischen Schulter und Wange geklemmt hielt und mit einem Auftraggeber sprach.
Es gab diese Momente, in denen ich nicht lebte, sondern Zeit nutzte. Bevor das Kind in die Kita kam, frühstückte ich nicht, sondern las meine Mails und trank dabei einen Kaffee. Wenn ich nachts wach lag, weil das Kind schlecht träumte, tröstete ich es mit der Linken und las mit der Rechten Korrektur. Wenn es krank war, genügte es mir nicht, es gesundzupflegen, ich räumte parallel noch die Wohnung auf. In meinen dunkelsten Stunden betrieb ich Online-Shopping und rief bei Hotlines an.
Heute weiß ich, dass Nichtstun mit dieser Haltung niemals gelingen kann. Nichtstun muss sich entfalten, muss Zuwendung erfahren, gehegt werden und immer wieder eingeübt. Die Attribute seines natürlichen Lebensraums sind Stille, Weite und Reizarmut. Berlin dagegen war Enge, Feinstaub und Lärm. Mehr und mehr musste ich mir eingestehen, dass mein Traum vom gelingenden Nichtstun hier nicht gedeihen konnte. Ich hatte zwanzig Jahre verloren. Aber noch war es nicht zu spät. Ich war bereit für den letzten Schritt.
Beinahe in Polen
In Brandenburg geht man nicht zelten, in Brandenburg kauft man ein Haus. Der Preis ist in etwa derselbe. So lautet zumindest ein böses Berliner Sprichwort. Auch wenn es ziemlich überheblich daherkommt, trifft es einen wahren Kern. Der Leerstand hat die Preise vielerorts sinken lassen. Wenn es unbedingt die Villa am Starnberger See sein muss, das Loft an der Elbe, die Wohnung in der Freiburger Innenstadt, dann könnte es schwierig werden mit dem Nichtstun. Daher habe ich die Suche umgedreht. Ich habe mir keine Ziele gesteckt und überprüft, wie viel ich dafür arbeiten muss, sondern ich habe abgesteckt, wie viel ich arbeiten will, und dann überprüft, welche Ziele sich damit erreichen lassen.
In Brandenburg mehr, als man denkt. Vor allem in den schönen, verlassenen Weiten des Oderbruchs gibt es Häuser zu einem Preis, für den man in München seine Gästetoilette renoviert. Es ist ein Glücksfall, dass Berlin mitten im sandigen Nichts liegt, dass Mietwucher und Immobilienblase strikt auf das Stadtgebiet beschränkt sind. Ob Nord, ob Ost, ob Süd, ob West, man kann sich darauf verlassen, dass die Freiheit, sobald das Berliner Ortsschild rot durchgestrichen ist, ringsum beginnt. Bekanntlich ist Berlin überhaupt nur deshalb erträglich, weil es von Brandenburg umgeben ist.
Auf dem Weg zum Nichtstun verfiel ich also erst einmal in Aktionismus und kaufte ein Haus. Der kleine, verfallene Hof, den ich übernommen habe, liegt beinahe in Polen. Für den Kaufpreis erwies sich diese Tatsache als besonders förderlich. Offenbar ist die Nähe zu Polen für einen allzu hohen Kaufpreis ein Hindernis. Dass vor Polen die Oder kommt, ein Naturspektakel aus schilfgesäumten Auen, endlosen Zugvogelschwärmen und kleinen Flussinseln, auf denen einzelne Trauerweiden stehen, wurde vom Makler offenbar übersehen. Neben der Bank auf meiner Wiese kenne ich keinen Ort auf der Welt, an dem es sich besser nichts tun lässt als hier, auf dem Oderdamm, an einem bereits fahlen, windigen Nachmittag im Herbst.
Dass diese Rechnung nicht aufgehen würde, liegt auf der Hand. Als ich den Kaufvertrag unterschrieben hatte und an einem regnerischen Nachmittag versuchte, das Grundwasser im Keller abzupumpen, konnte ich mich nur noch dunkel erinnern, warum ich der Meinung war, dass ausgerechnet der Kauf eines baufälligen Hofs im Oderbruch zu einem Mehr an Freiheit, Freizeit und gepflegtem Nichtstun führen oder gar dem Familienglück dienlich sein sollte. Zumindest die erste Zeit nach dem Kauf führte ohne größeren Umweg in den Untergang: damals, als diese Sache mit dem Keller passierte und dann diese Sache mit dem Dach und schließlich noch diese Sache mit dem Geschoss dazwischen. Ich hatte geglaubt, zehn Jahre Berlin hätten mich auf die Herausforderungen gelingenden Nichtstuns hinlänglich vorbereitet. Doch weit gefehlt. Die wahre Schule sollte erst noch beginnen.
Die Weltzeitskala
Wer nichts tut, hat ein unschlagbares Argument auf seiner Seite. Es ist die Zeit. Man muss sich nur einmal zurücklehnen und nicht an das Kind denken, das mit dem Auto von der Kita abgeholt werden muss, weil die Arbeit, mit der man das Auto finanziert, fünfzehn Kilometer von der Kita entfernt liegt. Einmal nicht an die Kündigung denken, die droht, wenn man nachmittags zu früh zum Kind aufbricht, und die zur Folge hätte, dass man nicht mehr tun müsste, was einem nie Spaß gemacht hat. Einmal vergessen, dass man das Kind vor allem wollte, weil man mit seinem Partner glücklich war, den man nun aber nicht mehr sieht, weil er immer mehr arbeitet, für das Kind.
Einmal nicht daran denken, dass man in der Zeit, in der man das Geld verdient hat, um die Putzhilfe zu zahlen, auch selbst hätte putzen können. Einmal nicht daran denken, dass früher der Mann unglücklich war, weil er die Familie vernachlässigte, und die Frau unglücklich, weil sie die Karriere vernachlässigte, während heute beide wegen beidem unglücklich sind und weder Zeit für die Karriere noch für das Kind noch füreinander haben. Einfach einen kurzen Moment lang zulassen, dass das alles auch anders zu organisieren sein muss.
Es ist so eine Sache mit den Vergleichen. Meistens treffen sie nicht zu, oder sie werden missbraucht, um eine Haltung plausibel aussehen zu lassen, die es nicht ist. Einen Vergleich aber gibt es, der einem zu sofortiger Gelassenheit verhilft. Es ist der Vergleich der Weltgeschichte mit den vierundzwanzig Stunden eines Tagesverlaufs. Man kennt das. Vor vierundzwanzig Stunden wäre der Urknall gewesen, und dann käme sehr, sehr lange nichts. Vor zehn Minuten hätte es den ersten Menschenaffen gegeben, der erst seit zwei Minuten aufrecht gehen kann und seit gerade einmal null Komma zwei Sekunden Ackerbau und Viehzucht betreibt.