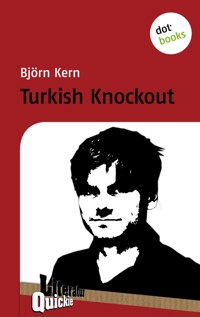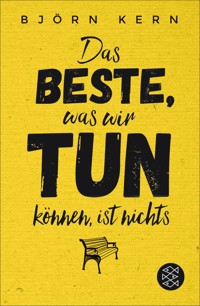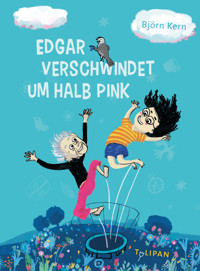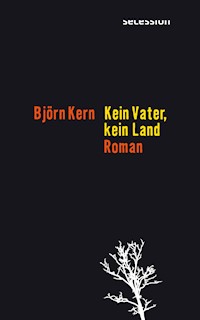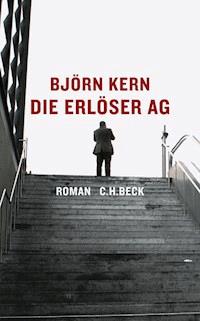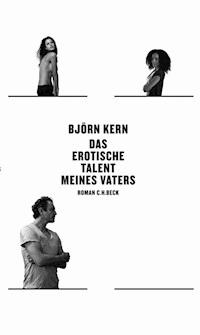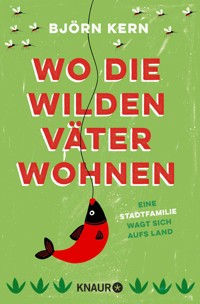
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Mach den Fisch wieder lebendig!" Den Traum vom Landleben – Björn Kern und seine kleine Familie wollen ihn wahr machen, und so ziehen sie von Berlin ins Oderbruch. Statt Etagenwohnung: ein verfallener Hof. Statt überfüllter Spielplätze mit quengelnden Helikopter-Eltern: wilde Natur und wortkarge Landväter, von deren stoischer Lässigkeit sich so einiges lernen lässt. Doch das Landleben hat auch seine Tücken: Denn während seine Tochter sich rasend schnell akklimatisiert, realisiert Björn Kern, dass es ihm an den zentralen Fertigkeiten eines Landvaters mangelt. Er scheitert am Aufbau eines Wurf-Zeltes ebenso wie am fachgerechten Ausnehmen eines versehentlich geangelten Fischs. Doch zum Glück gibt es den schnoddrigen märkischen Nachbarn, der ihm in heiklen Situationen immer wieder mit liebevollem Spott auf die Sprünge hilft ... In seiner neuen Landlustfibel, einem starken Buch voller Pointen und von großer Herzenswärme, macht sich Björn Kern vor allem über einen lustig: sich selbst. "Wo die wilden Väter wohnen" ist der perfekte Lesespaß für alle, die aufs Land ziehen wollen. (Und für alle, die das Landleben lieber aus der Ferne genießen, erst recht.) • Witzig, selbstironisch, unterhaltsam – großer Lesespaß, nicht nur für Eltern • Von der Stadt aufs Land – ein ungeahnter Kulturschock • Vom Autor des Buches "Das Beste, was wir tun können, ist nichts"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Björn Kern
Wo die wilden Väter wohnen
Eine Stadtfamilie wagt sich aufs Land
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Den Traum vom Landleben – Björn Kern und seine kleine Familie wollten ihn wahr machen, und so zogen sie vom hippen Berlin ins Oderbruch. Statt Etagenwohnung: ein verfallender Hof. Statt überfüllter Spielplätze mit aufgeregten Helikoptereltern: die wilde Natur und wortkarge Landväter, von deren stoischer Lässigkeit sich so einiges lernen lässt. Doch das Landleben hat auch seine Tücken: Denn während seine Tochter sich rasend schnell akklimatisiert, realisiert Björn Kern, dass es ihm an den zentralen Fertigkeiten eines Landvaters mangelt. Er scheitert am Aufbau eines Zeltes ebenso wie am fachgerechten Ausnehmen eines selbst geangelten Fischs. Doch zum Glück gibt es den schnoddrigen märkischen Nachbarn, der ihm in heiklen Situationen immer wieder mit liebevollem Spott auf die Sprünge hilft ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Angeln für Städter
Flug über den Baggersee
Salto im Birnbaum
An der Bushaltestelle I
Kindheitstrauma
Auch schon wach?
Ich hab Bronze!
Das Wurfzelt
Endlich Selbstversorger
Best friends forever
Die Freundinnenübernachtung
An der Bushaltestelle II
Joggen und Doggen
Ihr mögt doch Cashewnut-Pepper-Tomato?
Keine Katze ist auch keine Lösung
Gehen zwei Väter zelten
An der Bushaltestelle III
Das Insektenhaus
Schatzsuche im Regen
Die Jugendweihe
Nicht weitersagen!
Dank
Der Dorfwirtin gewidmet.
»Wir ham hier Platz jenuch.
Sogar für so krumme Eulen wie dich!«
(Mein märkischer Nachbar)
Angeln für Städter
Sophie hat einen Fisch gefangen. Seither ist sie am Boden zerstört. Vielleicht hätte ich sie über das Zusammenwirken von Angelhaken, Schnur und Fischmaul genauer aufklären sollen. Aber das ist ja das Problem mit der Aufklärung. Sie kommt immer zu spät. Ich erwäge ernsthaft, einen Kindertherapeuten aufzusuchen, falls ihr Zustand weiter anhält. Ihr Zustand? Völlige Teilnahmslosigkeit. Gesenkte Schultern. Tränen bei jedem Anlass. Frage ich beispielsweise: »Soll ich dir Pfannkuchen braten?«, lautet die Antwort: »Papa, du bist gemein!« Dann wieder Tränen.
Ich habe gelesen, dass das typisch ist für eine posttraumatische Belastungsstörung. Anlässe, die mit dem Trauma nicht das Geringste zu tun haben, werden auf verschlungenen Wegen mit ihm in Verbindung gebracht.
Erst nach vorsichtigem Herantasten erfahre ich: Die gebratenen Pfannkuchen erinnern Sophie an den gebratenen Fisch! Ich denke, ich werde Gespräche, die ums Essen kreisen, ganz einstellen oder mit einem Codewort versehen müssen. »Willst du Paradies zum Abendessen, Liebes? Soll ich dir das Paradies schneiden?«
Ich gestehe, dass ich mir Vorwürfe mache. Auch aus ethischer Sicht. Immerhin geht es hier nicht um einen Teddy, sondern um ein Tier. Andererseits gibt es einiges, was ich zu meiner Verteidigung vorbringen kann. Sophie angelte nämlich mehrere Tage lang lediglich mit einer plastinierten Büroklammer, die an die Kordel ihres Sommerkleides geknotet war. Man muss kein Angler sein, um die Fangaussicht eines derartigen Vorhabens auf null zu schätzen. Jeden Tag nach dem Mittagessen sagte sie: »Papa, ich gehe dann angeln!« Und ich sagte: »Natürlich, Süße. Viel Glück!« Das war zu unserem kleinen Ritual geworden. Niemand hatte die Absicht, einen Fisch zu fangen!
Zwei volle Sommerwochen ging das gut. Kein Haken, kein Fisch. So einfach, sollte man meinen. An dieser Stelle kommt nun Sophies Landfreundin ins Spiel. Annelie ist nur zwei Jahre älter als Sophie, aber im Gegensatz zu uns im Dorf fest verwurzelt. Mein märkischer Nachbar ist ihr Großvater. Was ich nur lautstark behaupte (dass wir nächstes Jahr dann aber wirklich Himbeeren-autark sind!), lebt Annelie mit größter Selbstverständlichkeit vor. (Und bringt schon mal breit grinsend einen Eimer Himbeeren vorbei.)
Hinter meinem Rücken – und, ganz wichtig: ohne meinen Segen – schien sich nun mit Annelies Hilfe eine Art Hakenwechsel vollzogen zu haben. Die Kleiderkordel war zur Nylonschnur geworden, die Büroklammer zum Friedfischhaken. Noch einmal ganz deutlich, an alle Freunde weidgerechter Tötung gerichtet: Davon hatte ich nicht das Geringste mitbekommen! Ich lag nämlich derweil im Hof im ungemähten Gras und analysierte die Vorteile meines neuen Daseins als Landvater. Der größte Vorteil in diesem Moment: Sophie war nicht da!
So etwas gesteht man sich ja normalerweise nur nach Mitternacht ein, wenn der Mond aufgeht und der Pegel in der Bierflasche sinkt. Aber es war die pure Erholung. Die totale Entspannung. Eine nervliche Befreiung wie nach einer Ganzkörpermassage. Nichts zupfte an mir! Nichts rief nach mir! Nichts und niemand wollte etwas von mir! Ich durfte, was ich zum letzten Mal vor Sophies Geburt gedurft hatte: einfach nur sein. Die Schmetterlinge tanzten im Hof umher. Der Flieder duftete. Und ich tat nichts.
Auf einmal aber ein Schrei. Heftiges Rütteln am Hoftor. Mein kinderloses Dasein hatte etwa dreizehn Minuten gedauert. Völlig aufgelöst stand nicht Sophie, sondern Annelie vor mir. Braune Haare, sommerlich gebräunte Haut. Nervös zappelnde, dünne Mädchenarme. Annelie stieß einige unverständliche Wortfetzen hervor und zog an meiner Hand. Mein Puls beschleunigte sich. Was war passiert? Lag Sophie im Graben? Kämpfte sie gegen die Strömung? Trieb sie bereits ab? Ich rannte über die Landstraße, an der alten Bettfedernfabrik vorbei, unter der Bahnlinie durch. Sophie stand an der Angelstelle und weinte. Zu ihren Füßen zappelte etwas von beachtlicher Größe.
»Oh Gott!«, rief ich. »Was ist denn das?«
»Eine Rotfeder«, sagte Annelie.
»Und was machen wir jetzt damit?«
»Also, mein Bruder macht immer so«, sagte Annelie und vollführte eine fürchterlich rohe Handbewegung über der Bordsteinkante.
Ich war entsetzt. Der Fisch war kaum zu greifen, so zappelte er. Konnte man ihn nicht einfach wieder schwimmen lassen? Ich meinte, so etwas schon einmal gehört zu haben, und machte mich daran, den Haken aus dem klappenden Maul zu entfernen. Unmöglich. Die Konsistenz der Unterlippe werde ich noch auf meinem Sterbebett aufrufen können. So knorpelig zäh und gleichzeitig so weich, dass in keinem Fall ein Angelhaken hineingehörte.
Ich merkte, dass ich als Landvater soeben versagte. Mein Auftritt war lächerlich. Das Tier tat mir leid. Also packte ich allen Mut und auch den Fisch, schloss die Augen und knallte den Kopf des Tieres mit voller Wucht gegen die Bordsteinkante. Dreifaches Schreien. Sophie schrie. Annelie schrie. Und ich schrie offenbar auch. Der Fisch immerhin war tot. Sein Maul klappte nicht mehr auf und zu, seine Schwanzflosse wedelte nicht mehr in der Luft. Nur ein paar letzte Zuckungen vollführte er noch.
Er hat nicht lange gelitten, beruhigte ich mich. Ich setzte zu einer kleinen Ansprache an, die um die Themen Tierethik, fachgerechte Tötung und den Unterschied zwischen toter und belebter Materie kreisen sollte, als ich feststellte, dass Sophie einen Weinkrampf erlitt. Einen der stillen Sorte. Der verzweifelten. Einen der Sorte, der meine pädagogischen Anwandlungen sofort untergrub. Ich erklärte behutsam, dass der Tod zum Leben dazugehöre. Doch das machte alles noch schlimmer.
Die Tränen liefen und liefen.
Ich klemmte mir den Fisch unter den linken Arm und meine Tochter unter den rechten, selbst die forsche Annelie ging ziemlich geknickt nach Hause. Als wir den Hof erreichten, stellte ich Sophie wieder auf ihre eigenen Füße.
»Wollen wir den Fisch nicht einfach in unseren Teich setzen?«, fragte sie.
»Ähm? Sophie?«
»Dann kann er doch wieder schwimmen!«
»Süße. Er ist tot.«
»Dann mach ihn sofort wieder lebendig!«
Als angehender Landvater glaube ich ja an Geschichten. Daran, dass mein Kind besser zurechtkommt, wenn ich den kleinen und großen Absonderlichkeiten des Lebens einen nacherzählbaren Plot verpasse, mit Anfang und Ende. Es war also klar, dass das Kapitel »Fang des ersten (und allem Anschein nach auch letzten) Fisches ihres jungen Lebens« keineswegs mit einer nutzlosen Tierleiche enden durfte. Da fehlte noch was.
Wenn es um den Kreislauf des Lebens geht, bin ich als angehender Landvater recht resolut. Es fällt mir schwer, Reste von Tieren in den Hausmüll zu geben. Knochen, Gräten, Knorpel: So etwas will ich mir nicht in der Müllverbrennungsanlage vorstellen. Es stand also fest: Der Fisch war dem großen Kreislauf wiederzugeben! Seinem Tod war ein tieferer Sinn zu verleihen! Ich musste aus dem Trauma eine Geschichte machen, mit Anfang und Ende. Was würde sich mehr anbieten, dachte ich, als zu diesem Zwecke ein wenig Öl in die Pfanne zu träufeln und die Rotfeder wieder in die Nahrungskette einzugliedern? Doch weit gefehlt. Was der Fisch in der Pfanne vollführte, machte Sophies Trauma erst perfekt.
Zunächst stand freilich das Ausnehmen bevor. Ich meinte mich zu erinnern, dass man an einer bestimmten Stelle auf jeden Fall, an einer anderen Stelle hingegen auf keinen Fall in den Fisch stechen sollte. Alles in allem eine unzureichende Arbeitsgrundlage. Was tun? Ich schielte zu Sophie, der meine neue Ratlosigkeit nicht verborgen blieb. Derlei Situationen häuften sich, seit ich zum Landvater wurde. Das natürliche Hierarchiegefälle zwischen Vater und Tochter war in seinen Grundfesten zerstört. Ständig sah sie mich fragend an, und ich zuckte mit den Schultern.
In der Stadt war es übersichtlicher gewesen. Geordneter. Hier die Autos, da die Dealer. Mit beiden bitte nicht in Kontakt treten. Doch hier draußen? Sophie durfte alles, und ich konnte nichts. Wie hatte ich nur in diese Lage geraten können? Warum waren wir nicht in Berlin geblieben?
Ich weiß nicht, ob es an der Stadt lag oder an mir, aber in letzter Zeit hatte etwas nicht mehr gestimmt in Berlin. Wo ich eben noch die ganze Nacht ausgegangen war und Fahrten in überfüllten U-Bahnen als höchst inspirierend empfunden hatte, räumte ich auf einmal Spritzen vom Spielplatz. Für die spätnächtlichen Treffen vor dem Spätkauf war ich, seit Sophie auf der Welt war, nur noch eines: zu müde. Und waren schon immer so viele Stoßstangen auf Kinderkopfhöhe herumgefahren?
Wenn Sophie in Berlin etwas erleben wollte, musste ich sie erst einmal irgendwo hinbringen. Dann fand das Erlebnis unter einem Dach statt (Schwimmbad, Boulderhalle). Kindheit, hatte ich im letzten Jahr immer öfter gedacht: War das nicht ein viel großzügigeres Konzept? Eines, das dem Leben in der Stadt mit all seinen Regeln diametral entgegenstand? So eine Kindheit, das war doch etwas mit Wald und Wiese gewesen? Mit Wegbleiben, solange man will? Mit freihändigem Fahrradfahren auf der Dorfstraße? Mit Verabredungen von Tür zu Tür? Mit selbstständigen Erkundungen von Waldrändern und Bachufern?
Nichts davon war in Berlin möglich gewesen. Sah Sophie einen Busch, erleichterte sich darunter ein Chihuahua. Fand sie eine Wiese, steckte ein Fakirteppich aus Kronkorken darin. Und allein auf die Straße würde sie vor ihrem vierzehnten Lebensjahr keinesfalls dürfen. (Und nach dem vierzehnten erst recht nicht mehr!) Um Missverständnissen vorzubeugen: Keinesfalls will ich an dieser Stelle die großartige Stadt Berlin schlechtmachen! Ich fürchtete nur: Sie ist für Erwachsene gemacht.
Der Familienrat tagte. Wir studierten die Immobilienanzeigen. Fanden die Reste einer Hofstelle im Osten des schönen Landes Brandenburg. Es war nicht mehr viel übrig von diesem Hof, aber als Wohnraum war er gerade noch zu erkennen. Nach zehn durchaus glücklichen Jahren in Berlin packten wir die Koffer und begannen ein neues Leben. Ein Leben ohne Handy und ohne Auto und ohne U-Bahn, ein Leben in Entschleunigung und Muße, voller Widerstandskraft in einer Zeit der Trockensommer und Waldbrände, der Plastiknahrung und Pandemien.
Dachte ich zumindest …
In den Sommerferien zogen wir um. Nur wenig später stellte sich heraus: Ein Landvater hatte es auch nicht leichter. Vor allem zwei Dinge machen ihm das Leben schwer. Punkt eins: Er ist Vater. Punkt zwei: Er lebt auf dem Land. Ohne Plastikverpackungen konnte man hier draußen ebenso wenig satt werden. Überraschend viel Zeit verbrachte man an Bushaltestellen. Ohne Handy war man nicht überlebensfähig. Und der Kleinfamilienwahnsinn war hier draußen auch nicht leichter zu organisieren als in der Stadt. Nicht, wenn man keine Großeltern in der Nähe hatte. Nicht mit zwei Jobs. Nicht ohne Nanny. Nicht ohne Gärtnerin. Nicht ohne Koch.
Am schwierigsten aber gestaltete sich der Kontakt mit der heimischen Bevölkerung. Mit Landvätern, die wirkten, als stammten sie aus einer anderen Zeit, aus einem vergessenen Land. Von ihnen lernte ich, wie verkümmert mein Leben bislang verlaufen war. Doch ich wollte es besser machen! Ich wollte werden wie sie! Ich wollte ebenfalls Landvater werden! Tapfer nahm ich die Herausforderung an.
»Was machen wir denn jetzt mit dem armen Fisch?«, fragte Sophie.
Das Tier lag noch immer vor mir auf der Spüle. Und ich stand hilflos daneben. Das durfte so nicht weitergehen, wenn ich mir einen Rest Respekt bewahren wollte. Ich schlich ins Bad und zückte heimlich mein Handy. Gut, dass ich es doch noch nicht entsorgt hatte. Für die Anglervideos, die ich zu sehen bekam, stellte es sich als hilfreich heraus, dass ich mich in der Nähe einer Toilettenschüssel befand. Was war denn das für ein Gemetzel, das man dort betrieb? Und was war das, was da aus den Bäuchen der Fische quoll? Diese Angler waren doch alles Sadisten! Hatten sie Richtmikrofone auf die Fischkörper angesetzt? Messer kratzten über Schuppen, Bauchfleisch ploppte auf. Gurgelnd ergossen sich die Gedärme.
Dann fand ich den Beitrag »Fischausnehmen für Städter«. Na, bitte. Schön, dass das Internet wirklich an alles dachte. Also: Messer hinter der Bauchflosse ansetzen, dann wegschauen und denken, man würde eine Melone aufschneiden. Hände unter heißes (oder eiskaltes Wasser) halten und mit den so betäubten Fingern die Gedärme herausnehmen. Gallenblase nicht zerstechen! Ich fasste neuen Mut.
Sophie stand in der Küche und versuchte weiter, den Fisch zum Leben zu erwecken, doch er zuckte nicht einmal mehr.
»Ich werde jetzt mal kurz den Fisch ausnehmen«, sagte ich.
»Kannst du das denn?«
»Kein Problem!«
Ich packte den Fisch, der nur eines wollte: mir aus den Händen gleiten. Mit aller Kraft rang ich ihn auf der Arbeitsplatte nieder. Ich schloss die Augen. Dachte mit aller Kraft an Melonen. Dann stach ich zu.
Was soll ich sagen. Ich habe mein Lebtag nichts Schlimmeres getan. Ich hätte ebenso gut unseren märkischen Nachbarn oder seine Enkelin Annelie erstechen können. Die Haut war zäh, und der Schnitt zum Fisch-After hatte nichts, aber auch nichts mit dem Schnitt durch eine Melone gemein. Immerhin: Sophie sah aufmerksam zu. Legte sich nicht bereits etwas wie Achtung in ihren Blick?
Ich kochte Wasser auf und goss es mir über die Hände. Der Schmerz tat gut. Als ich nach den Gedärmen griff, spürte ich tatsächlich nichts. Dieser Tipp immerhin war hilfreich. Als die Innereien endlich vom Fischleib getrennt waren, musste ich mich erst einmal setzen und einen kleinen Mirabellenschnaps trinken. Wirklich nur ein kleines Landschnäpschen. Ein Schockschnäpschen. (Hatte ich in der Stadt nie gebraucht. War hier draußen essenziell geworden. Bei so viel roher Kreatürlichkeit.)
Die Pfanne erweckte den Fisch zu neuem Leben. Erst war es nur die Schwanzspitze, die sich ein wenig hob. Natürlich, beruhigte ich mich, die Hitze. Schlug nicht auch ein Pfannkuchen mal eine Blase? Na bitte, die Schwanzflosse legte sich wieder. Das Öl brutzelte. Der Fisch dünstete einen gar nicht mal so üblen Geruch aus. Wir befanden uns mitten in der Transformation vom Tier zur Nahrung. Das war es doch in etwa, was ich Sophie beibringen wollte, nachdem sie Fisch bislang nur als Stäbchen kennengelernt hatte.
Dann ein neuer Schock. Ein winziges Heben des Fischkopfes. Ein, zwei Schrecksekunden tat sich nichts. Der Kopf verharrte in der Luft. Sophie hielt die Hand vor den Mund, die Augen aufgerissen. Sogar das Weinen hatte sie vergessen. Und dann sprang der Fisch mit einer letzten, heftigen Konvulsion aus der Pfanne und schlug auf dem gekachelten Boden auf.
»Er lebt!«, rief Sophie. »Ich hab doch gesagt, dass er noch lebt! Und du hast ihn in der Pfanne umgebracht!«
Bis zum nächsten Morgen sprach sie kein Wort mehr mit mir.
Flug über den Baggersee
Nach dem ersten Schultag machte Sophie es spannend. »Sag schon, wie war’s?«, beharrte ich, doch sie sagte nur ein ums andere Mal: »Toll.« Mehr war aus ihr nicht herauszubekommen. Ihr weitaus größeres Interesse galt dem nächstgelegenen Badesee. Also radelten wir los. Nach sieben Minuten kamen wir an. Das war ja das Schöne an unserem neuen Leben: See, Wald, Feld – alles da. Alles in der Nähe. S-Bahn? Auto? Wozu? Noch bevor wir das Ufer erreicht hatten, schallte eine helle Kinderstimme über die Liegewiese: »Guckt mal, Sophie kommt auch!« Ich war perplex. Sophie würde doch nicht etwa an ihrem ersten Schultag eine Freundin gefunden haben?
Schule, das kannte ich so: Man ging maulfaul und muffelig hin, das Wetter auf dem Schulweg war immerzu unwirtlich und nass. Dann setzte man sich in die letzte Reihe und wartete einige Stunden auf den Schulschluss. Derweil wurde man gehänselt (Brille, Frisur, Klamotten). Dann folgte wieder Regen, diesmal auf dem Heimweg. Das Ganze wiederholte sich noch viermal, dann war wenigstens Wochenende.
Doch nun, bei Sophie? Eine Freundin? Aus Fleisch und Blut? Am ersten, sonnigen Schultag? Wie hatte Sophie das hinbekommen? Unter immensem Staunen sah ich zu, wie sich die beiden Mädchen um den Hals fielen und zum Wasser marschierten.
Ich legte mich in den Ufersand, schlug ein Buch auf und genoss, nicht gebraucht zu werden. Wann immer ich heimlich über den Buchrand linste, um zu überprüfen, ob Sophie zwischenzeitlich gemobbt oder unter Wasser getunkt wurde, hatte sich ein neues Mädchen hinzugesellt. Es waren bald schon fünf kleine Wassernixen, die prustend und jauchzend durchs Wasser pflügten. Es stellte sich heraus, dass diese Form der Verabredung hier draußen üblich war. Man brauchte keine Telefonnummer. Man brauchte im Grunde auch keine Verabredung. Man fuhr einfach an den See. Da waren dann alle wieder, die gerade noch in der Schule gewesen waren.
Wie anders so eine Verabredung in Berlin ausgesehen hatte! Eine Berliner Verabredung begann nicht selten ein, zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin. (Im Falle eines Geburtstags, dem jährlich pompöser werdenden Ego-Booster eines Berliner Kindes, war man sogar vor einem »Save-the-Date« nicht gefeit, zwei bis drei Monate im Voraus verschickt.) Nach der Erstanfrage wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um alle Beteiligten auf den aktuellen Stand der Verabredung zu bringen. Nur bei besonders spontanen Elternteilen kam es vor, dass man am Montag eine Einladung bereits für den kommenden Freitag erhielt. (Diese wurde dann in der Regel in letzter Sekunde abgesagt, weil »der Henry« ja freitags immer noch Flöte hat, nach dem Sport.)
Näherte sich ein ausgemachter Termin hingegen tatsächlich (ohne abgesagt zu werden), schnellte die Nachrichtenfrequenz nochmals in die Höhe. Dienstagmittag lautete der Ort der Verabredung noch: »vorm Schwimmbad«, Dienstagabend schon: »im Café«. (»Laut Regenradar soll es ab achtzehn Uhr regnen!«) Dann plötzliche Neuplanung: »Wäre es okay, wenn du eine Stunde auf Linn und Matze allein aufpasst, ich muss noch mit Feli zu den Zitronenzwergen.«
Ab Mittwoch (zwei Tage vor der Verabredung) dann mediales Dauerfeuer: Zu- und Absagen, Absagen der Absagen, Umleitungen des Treffpunkts, um auf dem Weg zur Boulderhalle noch beim Bäcker (Pausenbrot) oder an der Bibliothek vorbeizukommen (Leihfrist überzogen). Donnerstagmorgen kratzte Jonas dann leider der junge Hals, und die Verabredung wurde endgültig abgesagt. (»Hey, sorry, ist echt doof jetzt, ich meld mich einfach noch mal.«)
Hatte man hingegen sämtliche Präliminarien überstanden und saß tatsächlich zur verabredeten Zeit am verabredeten Ort, drohte noch die Verspätung. Die Verspätung ging mit einem letzten Aufbäumen des Nachrichtenschreibers einher. »Wird ne halbe Stunde später, die S-Bahn!« Halbe Stunde später: »Sorry, du, ich noch mal, die S-Bahn hab ich gekriegt, aber jetzt ist der Miri der Riemen an der Sandale gerissen. Kommen in zwanzig Minuten.« Zwanzig Minuten später: »Bin gleich da, muss aber früher los!«
Zwischen verspäteter Ankunft und verfrühtem Aufbruch blieben dann noch einige zerfaserte Minuten. In diesen war zu beobachten, wie sich ein abgehetztes männliches Wrack in emanzipatorischen Dingen um Kopf und Kragen redete. (»Aber hey, ich find’s trotzdem voll super, dass Tine den Auftrag angenommen hat. Ich will ja auch, dass sie vorankommt, beruflich!«) Dann heulte der Kleine. Dann schlossen die Geschäfte. Dann wartete die Kindsmutter. Um gemeinsam während dieser gehetzten Verabredungen einen Kaffee oder gar ein Bier zu trinken, blieb meist keine Zeit.