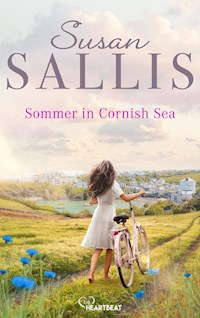
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glück und Leid liegen oft so nah beieinander.
Madge ist vier Jahre alt, als sie zum ersten Mal in Cornwall das Meer sieht und sich direkt in die Küstenlandschaft verliebt. Während ihrer vielen Sommer in Cornish Sea sieht Madge ihre Familie wachsen, leiden und lieben. Hier im Südwesten von England werden sich Madge und ihre Mutter von einer Familientragödie erholen, Madge wird widerstrebend in eine Heirat einwilligen, und hier wird sie doch noch einer wilden und leidenschaftlichen Liebe begegnen ...
Eine zauberhafte Familiengeschichte vor der malerischen Kulisse Südwestenglands - voller Schicksalsschläge, aber vor allem auch voller Liebe und Hoffnung.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Glück und Leid liegen oft so nah beieinander.
Madge ist vier Jahre alt, als sie zum ersten Mal in Cornwall das Meer sieht und sich direkt in die Küstenlandschaft verliebt. Während ihrer vielen Sommer in Cornish Sea sieht Madge ihre Familie wachsen, leiden und lieben. Hier im Südwesten von England werden sich Madge und ihre Mutter von einer Familientragödie erholen, Madge wird widerstrebend in eine Heirat einwilligen, und hier wird sie doch noch einer wilden und leidenschaftlichen Liebe begegnen ...
Susan Sallis
Sommer in Cornish Sea
Aus dem Englischen von Eva Malsch
Für meine Familie
1
1964
Niemals hätte Madge gedacht, dass es in St. Ives so kalt sein könnte. Natürlich, es ist Januar, sagte sie sich. Später als im Oktober waren sie nie hierhergekommen. Aber manchmal hatten sie sogar an Sommertagen in den regnerischen Wind gerufen: »Wie im November, nicht wahr?«
Selbst bei schlechtem Wetter war die Gegend immer beglückend gewesen, nie deprimierend. Einmal, kurz vor der Kriegserklärung, als sie Rosemary erwartet hatte, war über Clodgy ein spektakuläres Gewitter von wagnerianischer Majestät losgebrochen. Madge entsann sich, wie sie auf dem Old Man's Head gestanden, den Regen zu trinken versucht und geschrien hatte: »Wundervolles, warmes Himmelswasser!« Und sie hatten zusammen gelacht, vereint von der besonderen, verbindenden Wirkung des St.-Ives-Wassers, mochte es dem Regen oder dem Meer entstammen.
Jetzt, fünfundzwanzig Jahre später, lächelte sie nicht bei dieser Erinnerung. Ihre Grimasse – zumindest redete sie sich das ein – galt dem beißenden Wind, der sie nicht beglückte, sondern quälte, durch die schmalen Straßen mit dem Kopfsteinpflaster fegte und die Granit-Cottages blank scheuerte. Kein Wunder, dass St. Ives den ganzen Winter so sauber aussah, wenn es einer so gnadenlosen Sterilisierung unterzogen wurde.
Sie wandte sich von Roses Fenster ab und ging zum elektrischen Ofen. Noch nie hatte sie dermaßen gefroren. Nicht einmal im Krieg, trotz des Kohlenmangels. Damals hatte sie gearbeitet oder mehrere Sachen übereinander angezogen, um sich zu wärmen. Nun fanden unter ihrem eleganten Kamelhaarmantel nur ein Twinset, ein Rock und ein Seidenschal Platz. Sie betrachtete den geliehenen schwarzen Hut, der auf dem Esstisch lag. Daheim trug sie im Winter Strickmützen. Der Hut würde sie nicht vor der Eiseskälte schützen.
Rose kam herein und sah die unglückliche Miene, bevor Madge ein Lächeln zustande brachte. Von Natur aus widerstandsfähig, körperlich und seelisch, spürte Rose weder Hitze noch Kälte. »Haben sie das Tor noch nicht geöffnet?« Sie trat ans Fenster, spähte zur Kapelle hinüber und beantwortete ihre Frage selber. »Nein. Wahrscheinlich warten sie bei diesem Wetter bis zur letzten Minute.« Für Begräbnisse nahm sie sich keine Zeit. Etta Nolla und sogar Philip waren schockiert gewesen, weil sie nicht einmal an der Beerdigung ihres Mannes teilgenommen hatte. Aber sie verfolgte alle diese Ereignisse von ihrem Fenster aus, nur um zu sehen, wer da war und welche Kleider die Leute trugen. Sie schaute Madge über die Schulter an und schenkte ihr das gleiche offenherzige Lächeln wie vor vierzig Jahren. »Also hast du die weite Reise auf dich genommen, nur um dem alten Philip Nolla das letzte Geleit zu geben. Wie albern! Aber du bist mutig, das muss man dir lassen.«
Erstaunt hob Madge die Brauen. Mut war nicht nötig gewesen, nur Entschlossenheit. Im Januar allein nach Cornwall zu fahren hatte komplizierte häusliche Arrangements und Reisevorbereitungen erfordert. Trotzdem hatte sie keine Sekunde lang gezögert. Sie hielt ihre Hände in den schwachen Widerschein des elektrischen Feuers. »Natürlich musste ich kommen. Immerhin habe ich Etta und Philip mein Leben lang gekannt.«
Nach einer merkwürdigen kurzen Pause räusperte sich Rose. »Ja. Nun ...« Dann rieb sie einen imaginären Fleck von der Fensterscheibe. »Ich meine – es ist sonderbar, dass du zu mir gekommen bist. Wer Rose Care kannte, hat nichts mit Rose Foster zu tun.«
Roses unverblümte Art brachte Madge immer noch in Verlegenheit. »Wohin sollte ich denn sonst gehen?«
»Um diese Jahreszeit gibt's genug freie Zimmer in der Stadt, kleine Madge. Und was wird Etta Nolla sagen, wenn sie erfährt, dass du bei mir bist?«
Wie sie beide wussten, würde Etta vernichtende Kommentare abgeben. Aber Madge erwiderte hastig: »Darüber müsste sie sich freuen. Philip hat immer sehr nett von dir gesprochen.«
»Klar.« Rose stützte ihre Hände auf das Fenstersims und starrte hinaus. »So ein guter Mann ... Und jetzt wird er mit einem würdigen Begräbnis geehrt.«
Madge stellte sich mit dem Rücken vor den Herd und hoffte, etwas Wärme würde durch den Mantel, den Rock und den Unterrock dringen, zu der Lücke zwischen den Strümpfen und dem Slip. Während sie die kerzengerade Gestalt am Fenster musterte, erinnerte sie sich an die junge, anmutige, schöne Rose – die Hure von St. Ives. »Komm doch mit«, bat sie vorsichtig. »Philip hat mir erzählt, du hättest Martin Foster vor seinem Tod aufopfernd gepflegt. Und als ich Philip kennenlernte, sah ich ihm an, wie glücklich du ihn gemacht hast.«
Lächelnd wandte sich Rose zu ihr. Für ein paar Sekunden war sie wieder die alte Rose Care, die der Welt eine lange Nase drehte. »Sicher hat er auch erwähnt, dass ich nicht zu Martins Beerdigung ging. Nicht einmal meinem Ehemann erwies ich die letzte Ehre.« Lachend fügte sie hinzu: »Alle wünschten sich brennend, ich würde am Grab stehen, damit sie mir die kalte Schulter zeigen könnten. Aber ich war gar nicht da. O Gott, hättest du bloß ihre Gesichter gesehen, als sie den Friedhof verließen!«
»Hast du zugeschaut? Vom Fenster aus?«
»Aye. So wie jetzt. Ich bin eine Außenseiterin, Madge. Das war ich immer. Und Martin ... Lieber Himmel, ich war nur ein Jahr lang seine Frau. Er hat mich geheiratet, weil er eine Pflegerin brauchte. Und ich habe meine Pflicht erfüllt. Dass er in diesem Haus friedlich starb, verdankte er mir. Ich mag alles Mögliche sein, Madge. Aber ich bin keine Heuchlerin.«
Ein langes Schweigen entstand, während beide Frauen an vergangene Zeiten dachten, die sie geteilt hatten und über die sie nicht reden konnten.
Schließlich verkündete Rose: »Da sind sie.«
Madge trat zu ihr ans Fenster und beobachtete, wie die Männer die beiden schweren Torflügel der Kapelle öffneten und mit einiger Mühe festhakten. Der Wind blähte die Mäntel, die Hüte steckten unter ihren Armen. »Arme Etta«, seufzte sie.
»Oh, es wird ihr großen Spaß machen«, versicherte Rose mitleidlos. »Sie gehört zu den Leuten, die von den komischen Ureinwohnern abstammen, und die schwärmen alle für Beerdigungen.«
Darauf gab Madge keine Antwort. Auch sie war eine Außenseiterin. Ein Sommergast, wie die Schwalben. Nicht gewöhnt an den eisigen Wind. Würde Etta ihre Anwesenheit missbilligen?
Rose warf ihr einen Seitenblick zu und schien ihre Gedanken zu erraten. »Zweifellos würde sich Philip über deine Anwesenheit freuen. Vor allem, weil du so hübsch aussiehst. Dieser Mantel – und der Hut ... So was hat man früher im Mennion House getragen. Er wäre stolz auf dich!«
Plötzlich kämpfte Madge mit den Tränen. Beide Frauen starrten unverwandt aus dem Fenster, bis der peinliche Augenblick überstanden war.
Nun erschienen die ersten Trauergäste – die Trevorrows in identischen schwarzen Mänteln, sie mit verschleiertem Hut, er mit Bowler. Würdevoll versuchten sie, die Kapelle zu betreten. Daran wurden sie vom Wind gehindert, der die Säume ihrer Mäntel emporwehte.
»Schwarze Schuhe und schwarze Strümpfe«, bemerkte Rose und seufzte, als der Bowler mühsam gerettet wurde. »Ein Jammer, dass Männer keine Hutnadeln benutzen!« Von Madges Gelächter belohnt, fuhr sie in munterem Ton fort: »Du musst gehen.« Kritisch inspizierte sie Madges äußere Erscheinung. »Zieh den Hut möglichst tief in die Stirn, damit dein Nackenknoten gebührend bewundert wird ... Ja, so ist's gut. Ich sehe dich immer noch vor mir, mit dem langen Zopf am Rücken. Und jetzt bist du fast fünfzig.«
»Fünfundvierzig«, protestierte Madge in scherzhafter Empörung, doch sie hätte beinahe geweint.
»Da bin ich dir um ein paar Jahre voraus. Bald werde ich zweiundfünfzig.« Rose ging in die Diele und öffnete die Haustür gerade weit genug, dass Madge hindurchschlüpfen konnte. »Mach dir nichts draus, wenn sie sich komisch aufführen!«, rief sie in den Wind. »Und komm nachher sofort zurück. Dann trinken wir Tee oder was Stärkeres.«
Madge hielt ihren Hut fest und versuchte, die ausdrucksvollen schwarzen Augen anzulächeln, die sich in vierzig Jahren nicht verändert hatten. Seltsam, dieses Gefühl, Rose hätte immer zu ihrem Leben gehört, obwohl sie sich in all den Jahren nur ein halbes Dutzend Mal begegnet waren ...
Den gesenkten Kopf gegen den Wind gestemmt, ging sie den Bunkers Hill hinab. Ihre persönliche Trauer um Philip blieb unter der Oberfläche ihrer bewussten Gedanken und war sehr tief. Sie wagte nicht sich vorzustellen, was Etta empfinden mochte. Wenn die Frau sie mit diesem kalten Blick musterte, der alles sah, würde Madge das verstehen. Ganz egal, ob es irgendwen störte oder nicht – sie musste an diesem Begräbnis teilnehmen. Sie repräsentierte so viele dankbare Menschen, die Philips Lebensweg gekreuzt und sich dadurch verändert hatten. Sich selbst wollte sie vergessen und einfach nur – Dankbarkeit bekunden.
Alle Kirchenbänke waren besetzt. In der hinteren Reihe, unterhalb der Galerie, mussten die Leute flache Hüte tragen. Wer vorn saß, hängte Regenschirme an die Balustrade, zupfte Schleier und Röcke zurecht. Madge wünschte, sie wäre nach oben gegangen, wo ihr Kamelhaarmantel nicht so auffallen würde. Zum Glück hatte Rosemary ihr den schwarzen Hut geliehen. Das hatte sie zunächst abgelehnt. »Nimm deinen braunen Filzhut, der ist wärmer und eignet sich genauso gut.«
Aber Mark verstand die Bewohner von Cornwall so gut wie ein Einheimischer. »Sei nicht albern, Ro. Mum kann nicht mit einem braunen Filzhut zu Philips Beerdigung gehen.« Da war Rosemary ins Schlafzimmer hinaufgelaufen, um den schwarzen Hut zu holen, den sie erst vor fünf Jahren gekauft hatte.
Madge gab Mark recht. Wie dumm von ihr, sich keinen schwarzen Mantel zu leihen, trotz Roses Begeisterung ... Kamelhaar mochte respektabel wirken, bildete aber einen krassen Kontrast zum vorherrschenden Schwarz. Nachdem sie in einer Bank Platz genommen hatte, versuchte sie sich möglichst klein zu machen, fing Mrs. Trevorrows Blick auf und wurde mit einem eigenartigen Lächeln bedacht. Mitleidig? Ahnten die Trevorrows, was ihr Philips Tod bedeutete? Nun, jede Art von Lächeln war besser als die frostigen Mienen der anderen, und sie erwiderte es warmherzig. Da wurde es sofort abgeschaltet wie eine Lampe, und Madge sank in sich zusammen. Also war Roses Warnung begründet gewesen – die Leute führten sich »komisch« auf. Besitzergreifend hüteten sie das Andenken ihres Lokalhelden Philip und entrüsteten sich, wenn eine »Außenseiterin« einen kleinen Teil davon beanspruchte.
Trotzdem hatte Madges Familie den Nollas näher gestanden als sonst jemand, mochten sie auch nur Sommergäste gewesen sein. Das wussten alle. Und sie, Madge, repräsentierte die Familie. Außerdem durfte sie Roses Worte nicht vergessen – Philip wäre stolz auf sie.
Und so straffte sie die Schultern. Versonnen beschwor sie sein Bild herauf. Würde er jetzt neben ihr sitzen und sie anschauen, könnte sie in seinem Gesicht lesen, was er dachte. Seine Gedanken hatte er nicht allen gezeigt. Schon vor langer Zeit war ihr das bewusst geworden. Er war ein sehr verschlossener Mann gewesen. Aber ihr hatte er sein Herz geöffnet und ihr zu verstehen gegeben, sie sei etwas Besonderes.
Jemand betrachtete den leeren Platz an ihrer Seite. Es war Jim Maddern. Vor vielen Jahren hatten sie das letzte Mal miteinander gesprochen. Doch sie erkannte ihn. In der Kindheit war er ein Bindeglied zwischen Madges Clique und Rose Care gewesen. Jetzt begegneten seine dunklen Augen ihrem Blick, als wäre sie eine Fremde. Dann ging er zu den vorderen, für die engen Angehörigen des Toten reservierten Reihen, obwohl er nur wenig mit den Nollas zu tun hatte. Unter der kalten Haut kroch brennende Röte in ihre Wangen. Ausgerechnet von Jim Maddern war sie absichtlich geschnitten worden. Nun wusste sie, was Rose gemeint hatte. Nach dem Begräbnis würde sie sofort in ihre Zufluchtsstätte am Bunkers Hill zurückkehren und bis zum Abend warten, um in aller Ruhe mit Etta zu reden.
Mit einem schrillen Akkord verstummte das Harmonium, und die Trauergäste erhoben sich. Dann erklang die Stimme des Priesters, von einem Windstoß untermalt, der durch die Kapelle fuhr. »›Ich bin das Licht der Welt‹, sprach der Herr. ›Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis ...‹« Den Kopf gesenkt, dachte Madge nicht mehr allein an Philip, denn diese unvergänglichen Worte galten der ganzen Menschheit, den Lebenden und Toten.
Langsam zog die Prozession durch den Mittelgang zum Altar – all die Menschen, in Philips Netz gefangen. Die Mannschaft des Rettungsbootes trug den Sarg auf den Schultern. Billiges Ulmenholz. Etwas Besseres konnte Etta sich nicht leisten. In kurzem Abstand folgte sie den Sargträgern, ganz allein. Älter als ihr verstorbener Mann, musste sie an die achtzig sein. Wenn sie auch keine Kinder hatte – warum war niemand an ihrer Seite?
Neben Madge hielt sie inne. Auch die Leute hinter ihr, meistens Nachbarn, blieben stehen und wechselten verstohlene Blicke. Sie hob ihren Stock und klopfte auf Madges Arm.
Erschrocken blickte Madge auf und sah das vertraute zahnlose Grinsen.
»Ich wusste, du würdest kommen.« Mühelos übertönte Ettas Stimme die Predigt. »Und ich habe einen Platz für dich freigehalten.« Sie nahm den Stock in die andere Hand und ergriff Madges Arm.
Wie in einem Traum trat Madge aus der Kirchenbank. Etta seufzte erleichtert und stützte sich auf sie. Gemeinsam gingen sie zur vordersten Reihe, setzten sich und beobachteten, wie der Sarg vor den Altar gestellt wurde. Auf dem Ulmenholz lag Ettas Kranz in der obligaten Form eines Ankers und dahinter – als wollte es ihn festhalten – das Gebinde aus Christrosen, das Madge am Vortag nach ihrer Ankunft gekauft hatte, auf dem Weg vom Bahnhof zu Roses Haus.
*
Das letzte Mal hatte sie Philip vor fünf Monaten gesehen. Im Sommer. Da hätte sie es ahnen müssen. Aber wahrscheinlich wollte sie's verdrängen.
Träumerisch saß sie im Sand, an die Hafenmauer gelehnt. Die Flut wogte heran, und Madderns Pony, vor den Karren gespannt, wartete geduldig auf den Fang in den Fischerbooten. Vielleicht gibt's Makrelen zum Tee, dachte Madge. Etta würde sie in Essig marinieren, und sie würden Salat, Brot und Butter dazu essen. Wenn sich das Wetter hielt, könnten sie später nach Marazion fahren und den Sonnenuntergang hinter dem St. Michael's Mount beobachten.
Wie herrlich heiß es war ... Sie schloss die Augen vor dem heilsamen Sonnenlicht und sah immer noch den weißen Sand, das gläserne grüne Meer, aber nicht, wo das Wasser in durchscheinendem Blau mit dem Himmel verschmolz. Um das festzustellen, hob sie die Lider, und da winkte ihr Philip zu, der vor dem Fisherman's Lodge stand.
Mit einiger Mühe stand sie auf, ergriff ihre Handtasche und ihr Buch und stapfte barfuß durch den Sand. Er öffnete ihr die Gartenpforte. Eigentlich durften Fremde das Gelände des Lodge nicht betreten. Aber Philip hatte sie schon in ihrer Kindheit hierhergeführt, und sie wurde widerwillig akzeptiert. Sie setzten sich auf eine Bank vor der Holzhütte mit dem schiefen Schornstein, abseits von den Touristenscharen. Von hier aus sah sie immer noch Madderns Ponywagen.
»Da kommen sie«, sagte Philip. Hinter dem Smeaton's Pier tauchte das erste Boot der Fischereiflotte auf, die allmählich reduziert wurde, ein wannenförmiger Kahn mit breitem Heck. Wie ein Spielzeug hüpfte er auf den Wellen. »Sieht nach einem guten Fang aus.«
Unter der schweren Ladung lag das Boot tief im Wasser. Vom lauten Geschrei der Besatzung begleitet, legte es am Smeaton's Pier an. Vom Hafen her näherte sich ein anderer Kahn und übernahm die Fracht. Die Szene erinnerte Madge an ein Ölbild von Sargent in einer der Galerien. Vor über hundert Jahren gemalt, schlug es eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart.
»Denkst du wieder mal an Mark, Frau?«, fragte Philip.
»Nein, an die Zeit. Manche Dinge ändern sich nie.« Was für eine banale Phrase ... »An Mark denke ich nicht ununterbrochen, Philip.«
»Aber sehr oft.«
Schweigend entsann sie sich, wie unglücklich sie Rosemarys wegen gewesen war, erst vor Kurzem.
Für ein paar Sekunden berührte er den Rock ihres Sommerkleids. Die Finger wirkten so knotig wie die Taue, mit denen die Boote festgemacht wurden. Dann beugte er sich vor, die Ellbogen auf den Knien. Locker hingen die Hände hinab. »Für mich war er immer wie ein Sohn. Weißt du das?« Sie schluckte. Zwischen ihnen gab es Dinge, die niemals ausgesprochen wurden. Ohne eine Antwort abzuwarten, fügte er hinzu: »Sorg dich nicht um Mark, Frau. Ich hab's ja gesagt. Wie mein Sohn.«
Sie räusperte sich. »Wenn ich bloß Worte fände, um dir zu sagen, wie dankbar ich bin! Immer warst du da ...«
»Nun, das steht auf einem anderen Blatt.« Doch er blickte nicht auf, um sie zu beruhigen. Plötzlich empfand sie eine seltsame Angst.
»Alles in Ordnung mit dir, Philip?«
Endlich schenkte er ihr ein Lächeln. »Klar. Etta und mir geht's gut.« Er schaute wieder zum Hafen hinunter. Jetzt lud Jim silberblaue Makrelen, die wie Quecksilber glänzten, auf seinen Karren. »Viel brauchen wir nicht zum Leben. Immer das Gleiche. Fisch und Tee.«
Das hatte Madge nicht gemeint. Aber sie atmete erleichtert auf, weil sich das Gespräch wieder um alltägliche Dinge drehte. »Ihr solltet auch Obst und Gemüse essen.«
Er lachte. »Da wir bald achtzig werden, müssen wir uns immer richtig ernährt haben, nicht wahr, Frau?«
Etwas wehmütig stimmte sie in sein Gelächter ein. Die Nollas trugen keine Brillen und waren noch nie in einem Krankenhaus gewesen. Vom Rheumatismus gebeugt, gingen sie täglich am Strand spazieren.
In einträchtigem Schweigen beobachteten sie die Leute, die sich um Jims Ponywagen drängten und Makrelen kauften. Begierig steckte er das Geld ein. Sein Vater zahlte ihm immer noch ein Vorkriegsgehalt. Hinter dem Smeaton's Pier glitt ein zweites Fischerboot hervor. Die Hitze wirkte wie Balsam. Die Augen geschlossen, dachte Madge an die Geborgenheit ihrer Kinderzeit. Damals hatte immer jemand anders Pläne für den nächsten Tag geschmiedet.
*
Der Friedhof an der Klippe oberhalb des Porthmeor-Strands war ein Albtraum, von einem eisigen Wind gepeitscht, aber genau der Ort, den Philip gewählt hätte – mit Blick aufs Meer und hoch genug über den Krallen der Brandung. Am Grab stand Madge neben Etta und stützte sie – unfähig, den schwarz behandschuhten Fingern zu entrinnen.
Danach versammelten sich die Trauergäste im Haus – die Trevorrows, die Gurnards, die Madderns, die alte Mrs. Peters, Miss Lowe, die Flugblätter und Traktate zu verteilen pflegte. Mrs. Fosdick, die Nachbarin, hatte Stühle zur Verfügung gestellt. Nun saßen sie alle dicht beisammen, während Tassen mit süßem Tee über ihre Köpfe hinweg gereicht und Sandwiches mit Dosenfleisch auf ihren Knien deponiert wurden. Sobald Etta eine freie Hand oder ein freies Knie entdeckte, legte sie ein Foto darauf. »Das ist Philip hinter einer Staffelei. Dauernd wollten ihn diese Künstler malen.« Sie übergab Madge mehrere Schnappschüsse. »Nimm sie. Auf den meisten sind dein Bruder und dein Pa drauf. Die haben mir das Leben ziemlich schwer gemacht.« Aber sie lächelte.
Mrs. Fosdick reichte Jem Gurnard eine Sandwichplatte und ignorierte Madge.
Sofort nahm Etta ihr die Platte ab, setzte sich mit Madge auf das durchhängende Sofa und teilte die Brote nur mit ihr. »Wie gut ich mich an die Kricketmatches am Porthkidney-Strand erinnere ... Dein Pa war ein fabelhafter Schlagmann.«
»Ja«, stimmte Madge mit schwacher Stimme zu und wünschte, sie wäre daheim in ihrer Küche und würde das Gemüse für den Eintopf klein schneiden, den sie jeden Donnerstag aßen. Zum ersten Mal in ihrem Leben störte sie der Fischgeruch des Cottages.
»Weißt du noch, wie er uns am Strand herumkommandiert hat, mein Mädchen? Beim Kricket mussten wir immer genau da stehen, wo er uns haben wollte. Dann rannte er los und ...«
»Wenn alle bereit sind, sollte mein Mann jetzt anfangen!«, rief Mrs. Trevorrow. »Heute Abend sind wir verabredet.«
Madge stand auf, um sich zu verabschieden, weil sie nicht an der Testamentseröffnung teilnehmen wollte. Aber Etta zog sie energisch in die Sofapolsterung zurück, stellte ihr die Sandwichplatte auf das eine Knie und legte die Fotos auf das andere. »Gut, hören wir uns Philips letzten Willen an. Obwohl's da sicher kaum was gibt, das wir noch nicht wissen.«
»Falls Sie andeuten«, sagte Mrs. Trevorrow zum Lüster über dem Tisch, »mein Mann würde die Angelegenheiten seiner Klienten öffentlich erörtern ...«
»Ach, seien Sie doch still! Philip hat seine Wünsche hier in diesem Zimmer auf einen Zettel geschrieben, mit Mr. Fosdicks Hilfe und vor zwei Zeugen, die's jedem erzählen konnten. Das Papier wurde im Safe Ihres Mannes verwahrt. Deshalb ist man noch lange kein Klient.« Irritiert hob Etta die Schultern. »Bringen wir's hinter uns.«
Ob Philip ein Klient gewesen war oder nicht – Mr. Trevorrow legte großen Wert auf Formalitäten. Entschlossen verscheuchte er Jim Maddern vom Tisch mit der Plüschdecke, setzte sich und machte mit seinen Ellbogen Platz für mehrere Dokumente. Dann kramte er das richtige hervor, rückte seinen Kneifer zurecht und begann, das Testament vorzulesen. »›Ich, Philip John Sebastian Nolla, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, vermache hiermit meinen gesamten Besitz Mark Briscoe, unter der Voraussetzung, dass meine Frau Etta Margaret Nolla bis zu ihrem Tod im Zion Cottage wohnen kann.‹« Ein paar Sekunden lang wartete er, bis das lebhafte Stimmengewirr verstummte. Ausdruckslos fuhr er fort: »›Dieses Papier werde ich Mr. Trevorrow überantworten. Sicher sind meine Partner vom Forty-niner enttäuscht. Aber ich bitte sie um Verständnis, und ich hoffe, sie werden meine Wünsche nicht infrage stellen.‹« Mr. Trevorrow hob den Kopf, wich Madges Blick aus und erklärte: »In der Tat, dieses Testament wurde in Anwesenheit von zwei Freunden abgefasst und außerdem später von meinen beiden Sekretären beglaubigt. Wenn der Wortlaut auch nicht den juristischen Gepflogenheiten entspricht, ist es nach dem Gesetz gültig.«
In Ettas Wohnzimmer entstand ein langes Schweigen. Jetzt wusste Madge, warum man sie beim Trauergottesdienst, auf dem Friedhof und in diesem Haus geächtet hatte. Das konnte sie nachempfinden. Philip hatte einen Teil von St. Ives einem Außenseiter vererbt – einem Sommergast.
»Dann ist ja alles klar«, bemerkte Mrs. Fosdick in scharfem Ton. »Wir haben uns schon oft gefragt, ob Marks Schwierigkeiten mit der St.-Ives-Hüfte zusammenhängen. Jetzt wissen wir's.«
Der Fischgeruch drehte Madges Magen um. In früheren Zeiten waren viele Leute in St. Ives mit einer Hüftluxation geboren worden. Ohne ärztliche Behandlung hatten sie sich mit ihrem Leiden durchs Leben geschleppt und die Schmerzen fraglos akzeptiert. So wie Philip. Aber wie um alles in der Welt – selbst wenn man bösartige Absichten verfolgte – konnte man Marks »Schwierigkeiten« mit der St.-Ives-Hüfte in Verbindung bringen? Würgend presste sie eine Hand auf den Mund.
»Hört mal zu!«, befahl Etta. »Das ist Philips letzter Wille. Den kannte ich, und ich war einverstanden. Wie ihr alle wisst, hatten wir keine Familie. Die da waren unsere Familie.« Sie legte eine Hand auf Madges Schulter. »Und eine bessere als die meisten richtigen Familien. Wir haben ihnen nichts geboten außer schönen Ferien. In schweren Zeiten haben sie uns immer wieder geholfen. Bis jetzt. Natürlich, sie sind Sommergäste. Aber der junge Mark ist was anderes – kein Sommergast. Dem konnten wir was bieten. Und das wollten wir auch. Falls sich jemand den Mund zerreißt, erzähle ich selber ein paar Klatschgeschichten. O ja. Über die meisten von euch weiß ich was. Wir alle wissen was voneinander, und wir behalten's für uns. Das lässt sich ändern. Wenn's nötig ist.«
Mit gesenktem Kopf saß Madge neben ihr. Etta hatte Mrs. Fosdicks Andeutung nicht bestritten. Und Philip hatte erklärt, Mark bedeute ihm so viel wie ein eigener Sohn. Könnte er sich einen Wunschtraum lange genug eingeredet haben, um selber daran zu glauben? Und Etta? Glaubte sie daran?
Während die Trauergäste das Haus verließen, rang Madge nach Fassung. Die Wut der Leute schien in der Luft zu hängen. Nur wenige rafften sich zu einem höflichen Abschied von Etta auf. Mit Madge sprach niemand. Als würde sie gar nicht existieren. Bedrückt legte sie eine Hand über die Augen. »Was soll ich sagen, Etta? Dein Heim, die Forty-niner ... Wir wollen für Mark sorgen. Dieses Erbe darf er nicht annehmen. Sonst würde er bestätigen – was sie alle vermuten ...«
»Philip wusste, was er tat, mein Mädchen.«
»Hätte er's bloß nicht getan! Begreifst du nicht, was Mrs. Fosdick gemeint hat? Nie wieder können wir hierherkommen!« In Madges Stimme schwang tiefe Verzweiflung mit, was Etta nicht beachtete – wie immer, wenn sie mit Kummer und Leid konfrontiert wurde.
»Red keinen Unsinn, Mädchen! Hilf mir, die Stühle in den Flur zu tragen. Die wird Ernest Fosdick heute Abend holen. Philip wäre mit seiner Trauerfeier zufrieden gewesen, nicht wahr?«
»Ja, sicher, nur ...«
»Darüber rede ich nicht mehr, Madge, und dabei bleibt's. Meine Kräfte lassen nach. Jetzt brauche ich eine gute Tasse Tee und mein gemütliches Feuer.« Etta führte Madge nach hinten zur Küche, wo der Herd einladend glühte, stellte den Kessel auf den Dreifuß und sank in Philips Sessel. Vor Erschöpfung waren ihre Augen rot gerändert. In ihr Gesicht hatten sich tiefe Falten gegraben.
»Etta, ich verstehe deine Gefühle ...« Unglücklich lehnte Madge am Türrahmen. »Aber überleg doch, was die Leute denken. Sie ärgern sich nicht nur, weil Philip seinen Besitz einem Außenseiter vermacht hat, sondern weil sie glauben, dafür würde es einen Grund geben. Offenbar nehmen sie an ...«
»Dass Mark sein Sohn ist?« Etta lachte grimmig. »O nein, das wollen sie nur glauben. Dadurch wird's viel interessanter. Andererseits – wenn sie's glauben, müssten sie Philip von seinem Podest runterholen, und das tun sie nicht.« Der Kessel spritzte zischende Wassertropfen auf die Kohlen. Mühsam stand sie auf. »Geh nicht zu hart mit ihnen ins Gericht, Madge. Sie sind auch nur Menschen. Über Philip und mich wurden schon immer Klatschgeschichten verbreitet. Die haben uns nie gestört. Und Mark wird geradezu darin schwelgen. Das wusste Philip. Deshalb hat er den Jungen zu seinem Erben eingesetzt. So wie wir's wollten, wird Mark hier leben, mit Fug und Recht.« Sie brühte den Tee auf. Ächzend setzte sie sich wieder. »Trinkst du eine Tasse mit mir, mein Mädchen? Oder musst du deine Sachen packen? Reist du morgen ab?«
Nur zu gut wusste Madge, welche Antwort die alte Frau hören wollte. Jede weitere Diskussion wäre »sinnloses Gerede«. »Eigentlich sollte ich packen. Ich werde dir schreiben. Falls du heute noch mal mit mir sprechen willst – du findest mich bei Rose Foster ...«
»Hat dich der Teufel geritten? Wieso wohnst du da?«
»Jetzt ist sie respektabel«, verteidigte Madge ihre Freundin. »Und Philip hielt sehr viel von ihr.«
»Aye, von allen Leuten hielt er sehr viel, und er liebte sogar die schlechten Menschen. Daran solltest du dir ein Beispiel nehmen, mein Mädchen.«
Madge fragte sich, wie viel Etta wissen mochte. »Ja, er war herzensgut.«
»Vielleicht ...« Lächelnd blickte Etta ins Feuer. »Fahr nach Bristol und erzähl deiner Familie, was passiert ist. Bevor ich Philip folge, soll Mark herkommen. Bis dahin erledige ich alles für ihn. Und danach – muss er sich allein zurechtfinden.«
»Etta, er kann seinen guten Job nicht so einfach aufgeben.«
»Warum nicht? Jetzt ist er hier zu Hause, und sein Anteil an der Forty-niner bringt ihm genug ein – wenn du ihn hin und wieder ein bisschen unterstützt.« Genüsslich nippte Etta an ihrem Tee. »Leb wohl, Madge. Schließ die Küchentür, wenn du rausgehst. Im Flur zieht's ganz gewaltig.«
Madge gehorchte. Dann folgte sie dem langen Korridor – zum letzten Mal in ihrem Leben? An der Leine hingen Laken zum Lüften, wahrscheinlich Philips Bettzeug. Die geliehenen Stühle reihten sich aneinander. Jetzt begannen die Tränen zu fließen, die sie den ganzen Tag unterdrückt hatte. In der schmalen Gasse mit dem Kopfsteinpflaster starrte sie blind zu Philips Schlafzimmerfenster hinauf.
»Was hast du getan, Philip?«, flüsterte sie.
Hastig schluckte sie die Tränen hinunter, weil sie fürchtete, Mrs. Fosdick könnte sie beobachten. Dann wanderte sie zur Hafenmauer und beobachtete die Forty-niner, die vor Anker lag und auf den stürmischen Wellen schaukelte. O ja, sie verstand, warum er Mark alles hinterlassen hatte. Und was würde geschehen? War dies das Ende ihrer Sommerferien in St. Ives? Hatte Philip auch das bezweckt?
2
1924
Die Bahnfahrt von Bristol nach Cornwall war endlos. Acht Stunden mit Lachssandwiches, die nach Schwefel schmeckten, bitterem Tee aus der Thermosflasche, einem kratzigen Unterhemd und Papier-und-Bleistift-Spielen mit Neville, die sie nie gewann. Das erwartete sie auch gar nicht. Ihre Rolle als jüngstes weibliches Familienmitglied war klar definiert.
Bei der Ankunft im winzigen Bahnhof von St. Erth fühlte sie sich leicht benommen. Sie hatte fast vergessen, dass es noch eine Welt außerhalb des Zugabteils gab. Aber sobald sie auf den Bahnsteig stolperte und das Gummiband des Huts in ihr Kinn schnitt, begann die Verzauberung. An den Bäumen entlang der Station wuchsen keine Blätter, sondern Säbel. Riesige Kiesel säumten üppige Blumenbeete. Vermutlich magische Steine, weil sie im Licht der sinkenden Sonne kristallklar und bläulich schimmerten. Und die Blumen legten ihre Köpfe darauf, als wären es Kissen. Auch die Luft war anders. Nie zuvor hatte sie die Luft für ein Wesen gehalten. Kein einziges Mal in den ganzen vier Jahren ihres Lebens. Die Luft gehörte einfach nur zur Welt, und man atmete sie ein. Davon war genug da, vor allem in der Park Street im Winter. Oder eine Feder, die man aus dem Sofakissen gezupft hatte, schwebte zur Zimmerdecke empor, von der Luft getragen, und hüpfte herum wie ein Papierboot auf dem River Avon. Hier erschien ihr die Luft ganz anders. Sie roch nicht nur anders, sie schmeckte auch anders, und der schreckliche Nachgeschmack der Sandwiches im Mund verschwand. Ihr Haar, unter den Panamahut gezwängt, lockerte sich und flatterte, und der Ruß in den Nasenlöchern flog davon. »Oh«, seufzte sie, »wie im Märchenland.«
Verächtlich stöhnte Neville, und der Vater lächelte nachsichtig. Aber die Mutter, die ihr jeden Abend ein Märchen vorlas und für die Tochter ein Stickmustertuch angefertigt hatte (»Sei brav, süßes Mädchen, und lass andere klug sein«), umarmte sie. »Den ganzen Tag warst du so lieb.«
Sie stiegen Holzstufen hinauf, gingen über eine Brücke und fanden, was Mutter den »kleinen Zug« nannte. Darin saßen Leute mit Picknickkörben und Hunden und schrien einander an. Nicht weil sie böse waren, sondern weil sich komische Menschen so unterhielten. Davor hatte Vaters Bürokollege, der ihm St. Ives empfohlen hatte, die Familie gewarnt und behauptet, sie würden kein Wort verstehen. Marjorie verstand alles und war fasziniert. Laut sprachen ihre Mitreisenden über das Wetter, die Sardinen und die Logger im Norden. Marjorie kniete sich auf die Sitzbank und wisperte ihrer Mutter ins Ohr: »Wer sind denn die Locker im Norden?«
Besorgt schaute die Mutter den Vater an, der nicht besonders duldsam war, wenn Madge etwas falsch verstand. »Kleine Mädchen sollten die Gespräche Erwachsener nicht belauschen. Und Logger sind Fischerboote, Liebling. Hör nicht mehr zu.«
Aber Marjorie hörte sehr gern zu und ärgerte sich, weil viele Erwachsene, die sie kannte, im Flüsterton sprachen, als sollte sie ausgeschlossen werden. Da waren die komischen Leute anders. Sie verheimlichten ihr nichts, und sie musste gar nicht lauschen.
Mutter wandte sich zum Fenster. »Schau, Liebling, da ist St. Ives. Schön, nicht wahr?« Und Marjorie blickte hinaus, lachte, holte tief Atem und verliebte sich.
*
Nur zögernd hatten sie Zimmer im Zion Cottage bestellt. Die Nollas hatten noch nie Sommergäste beherbergt. Bisher waren die Bridges stets in Pensionen in Weston-super-Mare und Rhyl abgestiegen. Vaters Kollege hatte erklärt, in Cornwall seien »Privatzimmer mit Service« am günstigsten. Da kam man in den vollen Genuss der Atmosphäre und musste sich nicht auf die Ernährung der Einheimischen einstellen, die fast nur aus Fisch bestand. Die Zimmer kosteten sieben Pfund und sechs Penny pro Woche, man kaufte sein Essen selbst, und die Vermieterin kochte. Außerdem machte sie die Zimmer sauber und stellte Eimer, Schaufeln und Strandschuhe im Flur bereit. Der Kollege schrieb die Adresse auf, wo er letzten Sommer mit seiner Familie einen »rustikalen Urlaub« verbracht hatte. Aber Mrs. Warner entschied, Fremde wären das Geld nicht wert, und gab Alfred Bridges' Brief an die Nollas weiter. Sie hatten zwei schlechte Sardinenjahre hinter sich. Und obwohl Philip Nolla mit seinem Logger jeden Sommer in die Nordsee hinausfuhr, war das Einkommen niemals gesichert. Deshalb hatte Etta Nolla beschlossen, Feriengäste aufzunehmen. Allerdings würden sich die Besucher mit dem begnügen müssen, was sie ihnen bieten konnte.
Im Flur mit den Bodenbrettern aus Schiffsbauholz hingen Wäscheleinen. Das Wohnzimmer über dem Fischkeller knarrte wie eine Kajüte und war auch nicht viel größer. Über dem runden Tisch mit der Plüschdecke hing ein zierlicher Lüster, der schwankte und klirrte, wenn jemand atmete, und in Regalen, auf Fensterbrettern und dem Kaminsims hatten sich Kuriositäten aus einem langen Leben am Atlantik angesammelt. Muscheln, Schnitzereien aus Treibholz, Sepiafotos, Spitzendeckchen, polierte Krebszangen, Schiffsglocken – alles kämpfte um einen Platz. Lauter Staubfänger, wie Mutter flüsternd meinte. Aber wie sich bald herausstellte, wischte Mrs. Nolla nicht Staub. In Madges Augen war das Aladins Wunderhöhle.
Philip Nolla fischte gerade Heringe an der Northumberland-Küste. Da der Sardinenfang zurückging, fuhren die meisten St.-Ives-Logger in den Sommermonaten nordwärts. Vielleicht würde er rechtzeitig heimkehren, um die fremde Familie kennenzulernen, die gutes Geld für die Unterkunft in seinem Haus zahlte.
Schon nach kurzer Zeit merkten die Bridges, wie scharf sie unter die Lupe genommen wurden. Wenn sie Wohlgefallen erregten, durften sie im nächsten Sommer wiederkommen – wenn nicht, würden sie die Zimmer nicht einmal für die doppelte Summe mieten können. Etta wohnte im hinteren Teil des Cottages unter so primitiven Bedingungen, dass Marie zunächst erschrak und dann Bewunderung empfand. Da der Raum in den Felsen gehauen war, gab es kein Fenster. Nur die offene Tür zum Flur und die Falltür, durch die man über eine Leiter in den alten Fischkeller gelangte, spendeten Licht. An einer Wand stand ein Herd, an einer anderen ein langer Tisch unter Vorratsregalen. Unverderbliche Lebensmittel wurden in einer stickigen kleinen Speisekammer unterhalb der Treppe verwahrt, verderbliche im Fischkeller. Dort unten befanden sich auch die Toilette und eine Waschgelegenheit. Etta hatte elegante Nachttöpfe, Porzellanschüsseln und Krüge in den Schlafzimmern bereitgestellt. Mit seiner ersten Anordnung gewann Alfred Bridges sofort ihr Herz. »Neville, du trägst jeden Morgen das schmutzige Wasser hinunter und bringst frisches nach oben.«
Sichtlich dankbar verkündete sie: »In St. Ives gibt's mehrere Nollas. Ich bin Etta. Und mein Mann heißt Philip.«
Die kleine, drahtige Frau, von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet mit hohem Kragen und langen Ärmeln, hatte ihr graues Haar auf dem Oberkopf zu einem strammen Knoten festgesteckt. Von Natur aus war sie eine Stoikerin. Und sie mochte Männer lieber als Frauen. Alfred und Neville wurden angelächelt, Marie und Madge schmallippig geduldet, was in seufzende Nachsicht oder Ärger ausarten konnte, je nachdem, was die Situation gerade erforderte. Am ersten Abend traf Letzteres zu.
Weil Madge so ein braves kleines Mädchen war, durfte sie abends länger aufbleiben und am Familienspaziergang nach Porthmeor teilnehmen. Von Etta instruiert, wanderten sie die Virgin Street nach Barnoon hinauf und am oberen Rand des Friedhofs entlang. Die Aussicht war atemberaubend. Blutrot versank die Sonne im Meer. Madge wurde von ihrem Vater auf die Mauer gehoben und sah zum ersten Mal den Atlantik.
»Dort drüben liegt Amerika«, erklärte Alfred und zeigte zum Horizont.
Während sie hinschaute, schwirrte ihr eine große Fliege, trunken von Sommer und Sonne, direkt ins Auge. »Oh, das tut weh!«, schluchzte sie. »Es tut so weh!«
»Weil die Fliege aus Amerika kommt«, scherzte Neville.
»Sei bloß still, Neville!«, flehte Marie. »Mein armer Liebling! Was können wir denn tun, Alfred?«
»Sicher werden ihre Tränen die Fliege rauswaschen«, meinte er. »Heim ins Bett, das ist die beste Lösung.«
Als sie das Cottage betraten, tauchte Etta aus dem hinteren Raum auf und betupfte Madges Auge mit dem Zipfel eines nicht allzu sauberen Taschentuchs. Gellend begann das kleine Mädchen zu schreien. »Wäre sie doch gleich ins Bett gegangen!«, schimpfte sie und gab ihre Bemühungen auf. »Wenn ein Kind nach sechs noch wach ist, kommt nichts Gutes dabei raus.«
Angesichts dieses mangelnden Mitleids vergoss Madge neue Tränen, und Marie klagte: »O Etta, den ganzen Tag ist sie so brav gewesen! Welch ein Jammer!«
Da Etta mit ihrem Vornamen angeredet wurde, war sie etwas besänftigt. »Jetzt schläfst du in dem Rollbettchen, das ich für dich aufgestellt habe, mein Mädchen. Das sieht wie ein Kanu aus.«
Wie Alfred es prophezeit hatte, wurde die Fliege plötzlich von einer salzigen Tränenflut aus dem Auge geschwemmt. Madge lächelte schmerzlich und streckte der neuen Freundin die Arme entgegen. »Bitte, komm mit mir, Etta! Du bist eine richtig komische Frau.«
Damit wiederholte sie die Worte ihres Vaters. Doch das wusste Etta nicht.
»Kindermund«, murmelte sie und brachte Madge die Treppe hinauf. Da wussten sie, dass sie auch im nächsten Jahr willkommen sein würden.
*
Auf seltsame Weise vereinte Alfred Bridges moderne Anschauungen mit dem Gedankengut aus König Edwards Zeiten. Seine Frau verehrte er, aber Etta Nolla behandelte er wie einen Mann. Etta – und später Philip – wurden seine Spießgesellen und nahmen an den meisten Ausflügen teil. Nur an den Strand ging Etta nicht gern, weil sie den Sand hasste. Doch sie lernte bald, einen Kricketschläger zu halten und den Ball wegzuschlagen. Nach guten Picknickplätzen gefragt, lächelte sie grimmig. »Kommt drauf an, ob ihr Kricket spielen wollt. Wenn nicht, gibt's gleich hinter Zennor eine felsige kleine Bucht.«
»Mit Höhlen?«, fragte Neville eifrig.
»Wahrscheinlich. Da wurden Schmuggler geschnappt, als ich ein kleines Mädchen war.«
»Toll!«
»Wenn ihr Kricket spielen wollt, geht lieber nach Porthkidney. Der Strand liegt direkt unterhalb vom Golfplatz.«
Alfred dachte kurz nach. »Für ein richtiges Match haben wir zu wenig Spieler, Etta. Also schauen wir uns die Schmugglerhöhlen an.«
Neville stieß einen Freudenschrei aus, und Etta bemerkte ernsthaft: »Wenn Philip wieder da ist, haben wir zwei Teams, Mr. Bridges. Dann wären wir zu sechst. Wir könnten auch den kleinen Jim Maddern dazuholen. Und vielleicht Jem Gurnard. Je nachdem.«
Wovon das abhing, wussten alle. Ob die Bridges akzeptabel waren oder nicht. Vorerst schleppten sie den Picknickkorb den Klippenpfad entlang. Während sie die letzte Meile zurücklegten, durfte Madge auf den Schultern des Vaters sitzen. Vor sich sah sie Nevilles dunkelbraunen Kopf zwischen Farnpflanzen auf und ab hüpfen, gefolgt von Ettas Haarknoten. Und hinter ihr schwebte Mutters altmodischer Strohhut über den Sträuchern wie eine der zahlreichen Möwen. Immer wieder bejubelte Marie die Aussicht.
Seit ihrem ersten Abend und dem Angriff der Fliege misstraute Madge allen Aussichten. Aber jetzt stach ihr die majestätische Begegnung von Meer und Himmel viel intensiver ins Auge als die Fliege. Wie auf Vogelschwingen ritt sie auf den Schultern des Vaters. In den Klippen und im Meer erkannte sie die Welt, für die sie geschaffen war. Schon mit vier Jahren wusste sie bereits, dass alles Leben dem Wasser entstammte. Das spürte sie in Händen und Füßen und in ihren Atemzügen. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass sie ein Geschöpf war, mit ihrer Umgebung vereint. In diesem Moment glaubte sie sogar, sie könnte von den Schultern des Vaters fliegen, mit den Seehunden in das Meer tauchen oder ihre Fingerchen zwischen Wurzeln in die Erde graben. Stattdessen umfing sie den Kopf des Vaters mit ihren runden kleinen Armen, legte ihre Wange auf die kahle Stelle an seinem Oberkopf und brach in Tränen aus.
Ihre Eltern waren sehr besorgt.
»Was ist los, Madge?« Der Vater hob sie von seinen Schultern, stellte sie auf den Boden und neigte sich zu ihr hinab. »Sag mir, warum du weinst!«
»Das weiß ich nicht ...«
»Bitte, Alfred, lass mich mein armes Baby halten ...«
»Marie, sie muss eine Erklärung abgeben. Jetzt ist sie alt genug, um ein Problem in Worte zu fassen, das sie dermaßen bekümmert. Hör zu weinen auf, Madge, und denk nach. Nein, ich bin dir nicht böse, Liebes. Du sollst nur herausfinden, was dich bedrückt, damit ich dir helfen kann.«
»Das kann sie unmöglich verstehen, Alfred ...«
Aber Madge begriff, dass die Eltern ihretwegen streiten würden. Und so schluckte sie ihre Tränen hinunter und japste: »Die Welt – sie ist so schön, und das macht mich traurig.«
Ein paar Sekunden lang starrte Alfred dieses Kind an, das – bitte, lieber Gott – niemals einen Krieg erleben würde. Dann legte er sein Kinn auf das hellbraune Haar und schloss die Augen. Irgendwie hatte sie sein Wissen geerbt. Ebenso wie er sah sie den Schatten hinter dem Sonnenlicht. »Deshalb musst du nicht traurig sein, Madge«, erwiderte er in entschiedenem Ton. »Die Welt wird immer da sein, so sehr wir uns auch bemühen, sie zu zerstören.«
Da schlang Marie ihre Arme um alle beide. »Wie feinfühlig sie ist!«, flüsterte sie, von Herzen dankbar, weil Alfred so viel Verständnis für seine Tochter aufbrachte.
Madge trocknete ihr Gesicht am Leinenjackett ihres Vaters und hob den Kopf. »Sagt Etta nichts!«, flehte sie. »Bitte, erzählt ihr nicht, dass ich wieder geweint habe!«
Lächelnd versprachen sie ihr, nichts zu verraten. Marie ergriff ihre Hand und führte sie durch den schulterhohen Farn. »Wenn wir beide ein bisschen Respekt verdienen wollen, müssen wir uns sehr bemühen.«
Zum ersten Mal stellte sie Madge und sich selbst auf die gleiche Stufe weiblicher Wesen. Wenn Vater sich und Neville meinte, sagte er oft: »Wir Männer.« Aber Madge war stets ein süßes, sehr kleines Mädchen gewesen.
Das Picknick war ein großer Erfolg.
Auf den Kieseln am Strand lag eine Menge Treibholz, und Madge rannte mit ihrem Bruder hin und her, um Zweige für einen Scheiterhaufen zu sammeln. Neville versuchte sie zu erschrecken und forderte sie auf, eine tote Möwe zu suchen. »Für eine Feuerbestattung, Schwesterchen.«
Aber sie schüttelte den Kopf und erwiderte verschwörerisch: »Das ist ein Signalfeuer, Nev. Wie in deinem Comic-Heft. Wir sind Schiffbrüchige. Und nun müssen wir Tag und Nacht ein Feuer brennen lassen ...«
»Klar, das weiß ich, Madge! Immerhin ist's mein Comic.« Doch das Spiel begeisterte ihn genauso wie sie, und er überließ es Etta, das Feuer zu entzünden, während er mit seiner Schwester auf einen steilen Felsen kletterte und das Picknicktischtuch schwenkte.
Vor solchen Gefahren hätte Marie die Kinder gern gewarnt, aber Alfred hielt sie lächelnd zurück. »Sicher werden sie nichts tun, was ihre Fähigkeiten übersteigt. Neville braucht eine Gelegenheit, seinen Mut zu erproben. Auch für Madge ist das ein wichtiger Schritt. Endlich schlüpft sie aus ihrem Kokon.«
»Nun ja ... Trotz des Altersunterschieds sollten sie gute Freunde sein.«
»Wenn er vierundzwanzig und sie zwanzig ist, gibt's keinen Altersunterschied mehr«, betonte er. Und sie lächelte und glaubte ihm.
*
Als Philip Nolla aus dem Norden zurückkehrte, hatte Madge den Ruf eines ehrgeizigen Wildfangs erworben. Neville spürte die Konkurrenz ebenso wie die freundschaftliche Verbundenheit und trieb sie bis an ihre Grenzen. Bald konnte sie genauso gut wie er auf Klippen steigen und um Felsenteiche herumkriechen. Keines der beiden Kinder durfte sich zu tief ins Meer hineinwagen. Aber Madge fürchtete die gigantischen Brecher nicht, hüpfte wie ein Korken über sie hinweg, oder sie saß auf dem sandigen Meeresgrund und ließ harmlose Wellen über ihren Scheitel hinweggleiten. Sie bemerkte noch nicht, dass Neville hastig zum Strand watete, wenn eine hohe Woge seinen Kopf bedrohte. Bis jetzt war es ihm stets gelungen, seinen Rückzug mit schrillem Kriegsgeschrei zu tarnen. Madges Mut, der offensichtlich auf reiner Dummheit beruhte, ärgerte ihn maßlos.
Eines Nachmittags, gegen Ende der Ferien, besuchten sie wie üblich den Porthmeor-Strand. Die Kinder spielten im Meer, und Alfred und Marie saßen in Liegestühlen vor dem Badezelt aus Segeltuch, das sie für vierzehn Tage gemietet hatten. Der Picknickkorb – mit einem feuchten Tuch bedeckt, um den Inhalt kühl zu halten – diente Marie als Fußschemel. Um die Wahrheit zu gestehen, hätte sie zugeben müssen, dass sie Ettas Abneigung gegen den Sand teilte, der vor nichts haltmachte. Etta war nicht mitgekommen. An solchen Badeausflügen nahm sie nur selten teil. Und an diesem Tag erwartete sie die Rückkehr ihres Mannes, der drei Monate in der Nordsee verbracht hatte.
Hinter den Kindern brach sich eine Welle. Sie sah gewaltig aus. Aber Madge wusste, sie würde sich verflachen, bevor sie heranflutete. Daran hatte Neville noch nie geglaubt. Unbehaglich trat er den Rückzug an. »Beeil dich, Madge, da kommt sie!«
»Lauf nicht weg, Neville, das ist nur eine kleine Welle.«
»Natürlich lauf ich nicht weg, dumme Gans!«, stieß er wütend hervor. »Das ist ein Spiel. Weißt du's denn nicht? Wir wollen sehen, wer schneller ist. Dich holt die Welle immer ein. Jedes Mal verlierst du!«
Trotzdem blieb er stehen, und die Welle umspülte harmlos seine Taille. Die nächste schwoll unerbittlich an. Erwartungsvoll paddelte Madge mit Armen und Beinen. »Schon die siebte Welle!«, erklärte er nervös. »Vor der müssen wir weglaufen, Madge.«
Obwohl ihr Instinkt widersprach, versuchte sie an Land zu waten.
Neville, viel größer als seine Schwester, sprang vor der Welle zum Strand wie ein unbeholfener Vogel Strauß.
So sah Philip Nolla sie alle zum ersten Mal. Der Junge hüpfte aus der Brandung, das Mädchen verschwand plötzlich und beängstigend unter Wasser. Entweder gleichgültig oder ahnungslos saßen die Eltern weiter oben in Liegestühlen und tranken Tee aus Bakelit-Bechern.
Wie so viele Menschen, die vom Meer leben, konnte Philip nicht schwimmen. Und sein Respekt vor den Stimmungen und Launen des Ozeans grenzte an Furcht. Doch der intuitive Wunsch, das kleine Mädchen zu retten, war stärker. Er stürmte durch den trockenen Sand und den Schlamm und warf sich vollständig bekleidet in die nächste Welle. Sofort füllten sich seine schweren Stiefel mit Wasser, nasse Hosenbeine pressten sich kalt an die Knie und die Schenkel. Krampfhaft erschauerte er und watete weiter. Zu seiner Linken tauchte eine weiße Badekappe auf – und darunter ein kleines rundes Koboldgesicht mit Grübchen, das ihn glücklich anlächelte.
»Ist das nicht wundervoll?«, fragte Madge. »Lauter Bläschen, wie Brauselimonade!«
Er hörte ihr nicht zu. Stattdessen packte er sie und hob sie hoch. An ihrem gestrickten Badeanzug konnte er sie gut festhalten. Dann kämpfte er sich aus dem Wasser zum Strand, wo die Eltern und Neville standen, endlich alarmiert. Vorsichtig stellte Philip das kleine Mädchen auf den Boden. »Alles in Ordnung?«
»Ja.« Madge glaubte, es wäre ein Spiel gewesen. Entzückt musterte sie den durchnässten Neuankömmling. »Bist du Philip?«
»Der bin ich.« Halb mitleidig, halb missbilligend schaute er Alfred an. »Sie haben nicht gesehen, wie sie unterging. Nur gut, dass ich gerade rechtzeitig da war.« Dann wandte er sich zu Neville. »Lass deine Schwester nie wieder im Meer allein, junger Mann! Es ist deine Pflicht, auf sie aufzupassen.«
»Aber Mr. Nolla – das war nicht nötig«, entgegnete Marie. »Madge versinkt immer in diesen großen Wellen ...«
Rasch fiel ihr Alfred ins Wort. »Das war verdammt nett von Ihnen, Philip – so darf ich Sie doch nennen? Damit haben Sie eine Medaille verdient!«
Hochrot bis unter die Haarwurzeln beteuerte Neville: »Ich habe ihr gesagt, sie soll davonlaufen. Ehrlich. Aber sie ist so dumm.«
»Dann musst du auf deinen Bruder hören, mein Mädchen.«
Madge nickte, die Augen groß und rund. Erst jetzt erkannte sie, dass sie vor dem Ertrinken gerettet worden war, und erinnerte sich an einen Satz aus ihrem Märchenbuch. »Dafür bin ich dir ewig dankbar.«
Alle außer Philip, der nur ein ernsthaftes Lächeln zustande brachte, lachten. Rehabilitiert und inzwischen völlig hingerissen, rief Neville mannhaft: »Also, ich muss schon sagen, Sie sind eine Wucht, Philip.« Er schüttelte Philips Hand, und die Eltern folgten seinem Beispiel.
Als die Hand auch Madge gereicht wurde, griff sie danach und ließ sie nicht mehr los. Gemeinsam gingen sie zum Badezelt. »Etta hat mich hergeschickt«, erklärte Philip. »In einer halben Stunde steht der Tee auf dem Tisch.«
»Aber wir haben schon gepicknickt«, wandte Marie ein. »Mehr können wir nicht essen.«
»Seit dem Beginn des Sommers ist das meine erste Mahlzeit zu Hause. Und ich würde mich geehrt fühlen, wenn Sie mit mir essen.«
Sofort schlossen ihn alle ins Herz. Er war ganz anders als Etta, und Alfred erkannte die Qualitäten eines erstklassigen Sergeants – Verlässlichkeit, Unternehmungsgeist, Loyalität. Nach Maries Ansicht sah er biblisch aus. Immer wieder betonte Neville, Philip sei eine Wucht, und Madge bewunderte ihren Retter.
*
In diesen letzten drei Tagen lernten sie ihn gut kennen. Er führte sie auf der Forty-niner herum und zeigte ihnen, wie man die zwei großen Segel setzte. Dann beobachteten sie, wie er seine Netze ausbreitete, mit einer eingefetteten Spule flickte, die Schnur verknotete und mit dem Messer, das er aus seinem Stiefelschaft gezogen hatte, die Enden abschnitt. Begierig lauschten sie seinen Geschichten vom alten St. Ives. Er erinnerte sich noch gut an den Hurrikan im Jahr 1893. Damals hatten vier Dampfer in der Bucht Schiffbruch erlitten, und er war in einem Bootsmannsstuhl an einem Seil hinabgelassen worden, um die Verletzten zu versorgen. Im Jahr darauf war die Küste überschwemmt worden. Und kurz vor dem Krieg hatte ein Schneesturm die kleine Stadt unter sich begraben und von allen Nachbarn abgeschnitten.
»Wie war's hier im Krieg, Philip?«, fragte Neville.
»So wie überall. Zu wenig Lebensmittel und zu viel Gerede. Drüben in Zennor war eine deutsche Frau. Da gab's Ärger. Schließlich verschwand sie, und wir saßen den Krieg aus. Oder meinst du andere Kriege, Neville?«
»Andere Kriege?«, wiederholte Neville neugierig.
»Nun ja, die Türken sind hier gelandet und die Spanier. Und dieser Mr. Warbèck, der sich Richard IV. oder so ähnlich nannte. Immer wieder kamen Schmuggler zu uns ...«
Mit spannenden Berichten aus ferner Vergangenheit fesselte Philip die Aufmerksamkeit des Jungen. Aber er versuchte niemals, Madge auf diese Weise zu unterhalten. Wenn sie zusammen waren, fühlten sie sich einfach nur wohl. Manchmal redeten sie, oder sie schwiegen einträchtig.
Am letzten Ferientag saßen sie unterhalb des Old Man's Head. Von Philips Geschichten angeregt, bemühte sich Neville, auf den großen quadratischen Felsen hoch über der Landspitze zu steigen, der wie ein Schädel geformt war. Philip hielt ihn nicht zurück, was seine Eltern sicher getan hätten. Bei diesem hoffnungslosen Versuch verbrauchte Neville all seine Kräfte und war zufrieden.
Trotzdem hatte Madge Angst. »Wird ihm nichts passieren, Philip? Etta sagt, nur Erwachsene können auf den Old Man's Head klettern.«
»Natürlich schafft er's nicht, mein Mädchen. Aber es macht ihm Spaß, so was auszuprobieren. Wenn er größer ist, zeige ich ihm, wie man raufsteigt. Dahinten gibt's einen Weg.« Unter der breiten Krempe seines Strohhuts schaute er sie an. »Den werde ich dir auch mal zeigen, kleines Mädchen. Da kommt jeder hinauf.«
»Zuerst Neville«, erwiderte sie lächelnd.
Da berührte er ihre Schulter, als wollte er ihr gratulieren. »Aye. Erst Neville.«
Hinter ihnen sprang Neville zu Boden und suchte die Felswand nach einem verborgenen Halt für seine Zehen ab. Er hatte mehrere Männer auf den Old Man klettern sehen. Mit aller Macht wollte er es ihnen nachmachen.
»Morgen fahren wir nach Hause, Philip«, sagte Madge.
»Das weiß ich, mein Mädchen.«
»Wirst du uns vermissen?«
»Wirst du mich vermissen?«
»O ja, Philip.«
»Dann musst du mich nicht danach fragen. Aber wir beide müssen nicht lange traurig sein. Ein Teil von dir wird in St. Ives bleiben. Nächstes Jahr kommst du wieder, und es wird genauso sein wie jetzt.« Er schaute sich nach Neville um. »Im nächsten Jahr fahren wir auf der Forty-niner raus und beobachten die Seehunde.« Mit erhobener Stimme fügte Philip hinzu: »Und nächstes Jahr bringe ich dir bei, auf den Felsen zu klettern, Neville! Heute nicht. Kommt, ihr beiden. Zum Tee gibt's Makrelen.«
Ohne einen Widerspruch abzuwarten, stapfte er zur Wunschquelle am Porthmeor-Gipfel.
Sie beobachtete ihn eine Weile, dann zog sie ihr Taschentuch hervor und rannte ihm nach. »Da, Philip. Schieb's in deinen Ärmel.«
Verwirrt musterte er das zarte Batisttüchlein. »Viel zu klein für mich!«
»Dieser Teil von mir wird bei dir in St. Ives bleiben, Philip«, verkündete sie feierlich. »Wenn ich mir's zurückhole, bin ich schon fünf Jahre alt und ein großes Mädchen.«
Er faltete das Taschentuch sorgsam zusammen und steckte es ein. Dann ergriff er ihre Hand, und sie gingen davon. Nur zum Schein leistete Neville ein paar Sekunden lang Widerstand. Dann gab er die Felsenkletterei bis zum nächsten Jahr auf und rannte ihnen auf dem sandigen Weg nach.
3
1932
Wenn auch die nationale Koalition regierte, tröstete das Alfred Bridges nicht darüber hinweg, dass der Premierminister immer noch Ramsay MacDonald hieß. »Wie kann das eine nationale Regierung sein, wenn ein Kerl von der Labour-Partei an der Spitze steht?«, dozierte er am Frühstückstisch und schlug mit der Faust auf die Daily Mail. Der Lüster klirrte. Hastig legte seine Frau wieder den Deckel über den Speck und die Spiegeleier, bevor die Kinder ihre Teller füllen konnten.
Neville vermochte der Herausforderung nicht zu widerstehen. »Und wie würde die Alternative aussehen, Dad? Wenn Mr. Baldwin am Ruder stünde, wäre die Regierung wohl kaum nationaler.« Hilfe suchend schaute er seine Mutter an, erntete aber nur ein mahnendes Kopfschütteln. »Nun, Clem?«, wandte er sich an seinen vaterlosen Schulfreund Clement Briscoe, der die Ferien mit der Familie Bridges verbrachte.
Hin und her gerissen zwischen freundschaftlicher Loyalität und Diplomatie – immerhin bezahlte ihm Mr. Bridges den Urlaub –, räusperte sich Clem. Die zwölfjährige Madge, über ihre Jahre hinaus sensibel und immer noch mit einem Mitgefühl ausgestattet, das ihren Bruder manchmal ärgerte, mischte sich rasch ein. »Ist das so wichtig, Daddy? Letzte Woche sagtest du, ehe MacDonald zweifellos bewiesen habe, dass eine Labour-Regierung in diesem Land nicht funktionsfähig wäre ...«
Für Alfreds Geschmack besaß sie ein viel zu gutes Gedächtnis. Er schlug wieder auf die Zeitung, diesmal über das Marmeladeglas hinweg. »Mal sehen, wie lange er an der Macht bleibt. Höchstens ein Jahr.«
Sein Sohn nahm den Deckel von den Spiegeleiern und schob zwei besonders glitschige auf seinen Teller. Im Lauf der Jahre hatte seine Mutter Ettas Haushalt durch eigenes Geschirr und Besteck ergänzt und schließlich – sehr taktvoll – darauf bestanden, den Tisch selbst zu decken. Aber gegen Ettas Kochkunst war sie machtlos, und die Eier schwammen stets in einer undefinierbaren Flüssigkeit. »Daran zweifle ich, Dad.« Vor seinem Freund wollte Neville nicht klein beigeben. »Ich traue ihm vier Jahre zu. Was meinst du, Clem?«
Clem räusperte sich wieder, was Neville als Zustimmung interpretierte.
»Dann hat er bewiesen, dass er's schafft. Wir kriegen wieder eine Labour-Regierung, und diesmal ...«
»Moment mal, alter Junge.« Clem warf einen Blick auf seinen Gastgeber. »Denk an die gescheiterte Vertrauensfrage ...«
»Danke, Clement«, erwiderte Alfred und lächelte jovial. »Danke, dass du uns alle vor dem Kommunismus rettest. Aus dir spricht die Stimme der Vernunft, und die höre ich heutzutage sehr gern.«
Neville ließ das Messer fallen und packte Clems freie Hand. Rachsüchtig drückte er unter der Tischplatte den kleinen Finger zusammen. Aber Clem lachte nur, ebenso wie Alfred. Etta kam aus der hinteren Küche und fragte, ob sie frischen Tee aufbrühen sollte.
Nachdem Alfred die Zeitung zusammengefaltet hatte, drehte er sich auf dem Stuhl um. Er war ein Vorkriegsmann, wie er sich ausdrückte. Beim Frühstück trug er stets einen steifen Hemdkragen und eine Weste. Doch er war auch ein humorvoller Mann und an diesem Morgen besonders gut gelaunt. »Die Kanne ist noch fast voll, Etta. Bitte, setzen Sie sich und trinken Sie eine Tasse mit uns.«
Etta bedachte alle Anwesenden mit einem grimmigen Lächeln. Schon zum achten Mal verbrachten die Bridges ihre Ferien im Zion Cottage, als die einzigen Sommergäste der Nollas. Jedes Jahr erhöhte Alfred die Miete, und er überreichte ihr stets Geschenke. Die hätte sie von niemand anderem angenommen, und sie betrachtete alle – sogar Nevilles Freund – als ihre Familie. »Hoffentlich entschuldigen Sie mich, Mr. Bridges«, entgegnete sie, nahm ihm die Zeitung ab und legte sie auf die Fensterbank. »Ich trinke lieber Tee, der wie Tee schmeckt.«
Erwartungsvoll musterte Marie ihren Sohn und vermutete, er würde eine scherzhafte Bemerkung über Ettas »schwarzen Sirup« machen, wie er sich ausdrückte. Aber seine Aufmerksamkeit galt anderen Dingen. Sie stellte fest, dass die beiden Freunde unter Clems auseinandergefalteter Serviette versuchten, einander die kleinen Finger auszureißen. In Maries Augen brannten Tränen des Mitleids. Neville hatte ihr von den Kraftproben erzählt, die neue Jungen an der Schule ablegen mussten, und diese gehörte dazu. Einmal hatte sie eine haarsträubende Geschichte von einem prominenten ehemaligen Schüler gehört, der an einer Jahresabschlussfeier teilgenommen und voller Stolz seinen verkrümmten, bei einem grausamen Aufnahmeritual gebrochenen kleinen Finger präsentiert hatte.
»Was soll's heute sein, Mrs. Bridges?«, erkundigte sich Etta. »Warm oder kalt?«
Wie Marie wusste, war das kein Hinweis auf das Wetter. Vor dem kleinen Wohnzimmer wallten Nebelschwaden, die sich bald auflösen würden. Fragend wandte sie sich zu ihrem Mann. »Nun, mein Lieber? Was hast du für heute geplant?«
Nur Alfred machte Pläne. Er betrachtete die Pokergesichter der beiden Jungen, Madges leuchtende blaue Augen im gebräunten runden Gesicht, seine lächelnde schöne Frau und Etta, eine bereitwillige Spießgesellin. »Heute spielen wir Kricket in den Dünen«, verkündete er. »Wir nehmen einen großen Picknickkorb nach Porthkidney mit. Dort kampieren wir. Und nach dem Lunch beginnt unser Match.«
»Zwei gegen zwei?«, fragte Neville und lockerte seinen Klammergriff um Clems kleinen Finger.
»Sicher kommen Sie mit, Etta, nicht wahr? Und wir laden Jim Maddern ein. Gibt's sonst noch jemanden?«
»Rose Care ist wieder daheim«, erklärte Neville prompt. »Gestern hat sie Jim mit den Eseln geholfen.«
Missbilligend schaute Alfred seinen Sohn an. Rose Cares Name wurde manchmal im Sloop genannt. Angeblich besaß sie nur ganz wenig Unterwäsche. Wie viel mochte Neville wissen? Immerhin war er schon sechzehn, und im Internat redeten die Jungen über solche Dinge.
»Ja, sie ist wieder da, weil sie aus dem großen Haus in Hayle rausgeworfen wurde.« Etta ergriff die gefaltete Zeitung und knallte sie geschickt auf die Serviette zwischen den beiden Freunden. »Hört sofort mit dieser albernen Fingerhakelei auf! Drüben in Helston hat ein Bursche bei diesem verrückten Sport zwei Finger verloren. Eigentlich müssten es kluge, gebildete Jungs wie ihr besser wissen. Sorgt euch nicht um unsere Mitspieler. Gerade wurde Philip hinter den Five Points gesichtet. Der ist wie immer Torwächter.«
Neville und Madge jubelten – der Bruder, um den Vater von der Fingerhakelei abzulenken, und Madge, weil für sie St. Ives ohne Philip Nolla niemals vollkommen war.
*
Obwohl Alfred vor dem Lunch die Seitenwahl verloren hatte, setzte er sich zufrieden zwischen die Picknickutensilien und dachte, er müsste der glücklichste Mann auf Erden sein. Einen Teil seines Glücks verdankte er sich selbst. Gegen den Willen seiner Familie hatte er sofort nach dem Schulabschluss eine Stelle in der Technischen Abteilung der Great Western Railway angetreten, statt an einer respektablen Universität zu studieren. Jetzt war er der Assistent des Abteilungsleiters, mit gutem Gehalt und genug kostenlosen Erste-Klasse-Tickets, um seine Familie hierher, nach Schottland oder sogar Frankreich zu bringen. Auch die schöne Marie hatte er ohne den Segen seiner Familie geheiratet. Es war das Beste, was er je getan hatte. Sie war auf die Schule für Mädchen gegangen, gegenüber seiner eigenen, und er hatte sie in ihrer Uniform zwischen zweihundert Schülerinnen zunächst nicht bemerkt. Auf dem Abschlussball der sechsten Klasse brachte sie ihn dann mit ihrem Zitroneneis zu Fall, das vor seinen Füßen gelandet war. Als sie ihm auf die Beine half, die schönen dunklen Augen voller Zerknirschung, wusste er, dass er sie heiraten und sein restliches Leben mit ihr verbringen musste. Aber sie sollte später im Geschäft ihres Vaters, eines Juweliers aus Amsterdam, arbeiten, und die Bridges hielten sie nicht für eine passende Partie.
Damals, im Jahr 1908, war er achtzehn und sie sechzehn gewesen. 1912, bereits im Büro der Technischen Abteilung der Great Western in Bristol tätig, sah er Marie jeden Tag, obwohl sein Vater glaubte, sie würden sich nur sonntags treffen. Und im September 1914, als ihm eine Uniform angemessen wurde, arrangierte er eine standesamtliche Trauung, ehe er nach Frankreich fuhr. Seine Eltern rangen die Hände. Aber nachdem ihr Vater gestorben war, nahmen sie Marie auf und gewannen sie lieb, bevor auch sie den Tod fanden. In all den Jahren hatte Alfred stets das Richtige getan. Daran erinnerte er sich jetzt und lächelte.





























