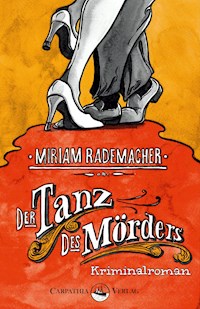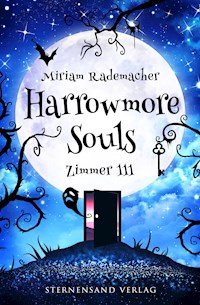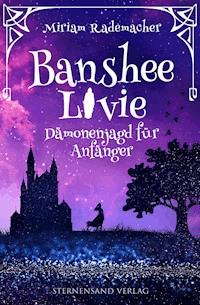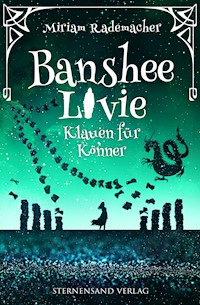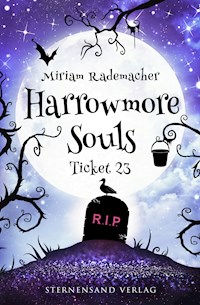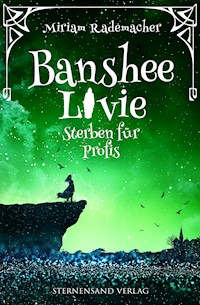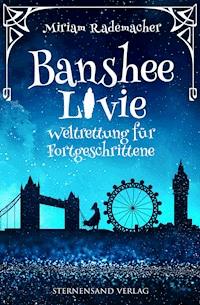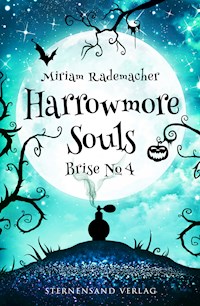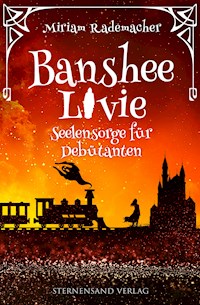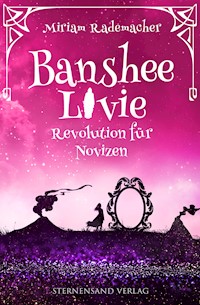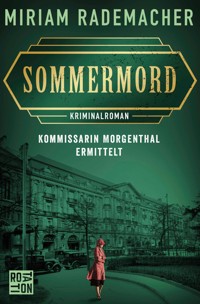
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer-Berlin-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mordopfer, dem der Tod prophezeit wurde, und eine junge Kommissarin, die vor nichts zurückschreckt ... Berlin, 1928: Billa Morgenthal, eine der ersten Frauen bei der Berliner Polizei, ermittelt in einem mysteriösen Mordfall. Der Arzt Wilhelm Gössling wird bei einem mitternächtlichen Spaziergang nicht weit von seinem Haus erschlagen. Der Täter kann fliehen, doch der Hauptverdächtige ist schnell gefunden: Leonard Reiter, ein vermeintlicher Hellseher, hat dem Arzt den nahenden Tod vorausgesagt. Hat er ihn ermordet, um seine Prophezeihung wahr zu machen? Ihr Vorgesetzter sieht Billa lieber hinter dem Schreibtisch, aber sie ist davon überzeugt, dass sie nur den Hellseher finden muss, um den Mord aufzuklären. Dann wird endlich auch der Chef ihre Fähigkeiten als Kriminalkommissarin erkennen. Als ein weiterer Mann im Umfeld des Arztes getötet wird, ist klar, dass die Berliner Polizei keine Zeit zu verlieren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Miriam Rademacher
Sommermord
Kommissarin Morgenthal ermittelt
Kriminalroman
Über dieses Buch
Ein Mordopfer, dem der Tod prophezeit wurde, und eine junge Kommissarin, die vor nichts zurückschreckt …
Berlin, 1928: Billa Morgenthal, eine der ersten Frauen bei der Berliner Polizei, ermittelt in einem mysteriösen Mordfall. Der Arzt Wilhelm Gössling wird bei einem mitternächtlichen Spaziergang nicht weit von seinem Haus erschlagen. Der Täter kann fliehen, doch der Hauptverdächtige ist schnell gefunden: Leonard Reiter, ein vermeintlicher Hellseher, hat dem Arzt zuvor den nahenden Tod vorausgesagt. Hat er mit dem Mord seine Prophezeihung nur wahr gemacht? Ihr Vorgesetzter sieht Billa lieber hinter dem Schreibtisch, aber sie ist davon überzeugt, dass sie nur den Hellseher finden muss, um den Mord aufzuklären. Dann wird endlich auch der Chef ihre Fähigkeiten als Kriminalkommissarin erkennen. Als ein weiterer Mann im Umfeld des Arztes getötet wird, ist klar, dass die Berliner Polizei keine Zeit zu verlieren hat.
Vita
Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie hat zahlreiche Fantasy-Romane, Krimis und Kinderbücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Jan Karsten
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Marie Carr/Arcangel Images; Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl
ISBN 978-3-644-01569-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Juni 1912
Frida fragte sich, was aus ihren Schuhen geworden war. Sie mussten irgendwo auf der Lichtung liegen, denn ohne Zweifel hatte sie zu Beginn dieses Sommertages Schuhe getragen. Jetzt aber spürte sie das warme Sommergras unter ihren nackten Zehen.
Noch immer war es oberflächlich betrachtet ein schöner Tag, noch immer glitzerte das Sonnenlicht auf den sanften Wellen des Falkenhagener Sees, doch für Frida hatte die schöne Umgebung ihren Zauber verloren. Nichts war so gekommen, wie sie es sich ausgemalt hatte. Der Ausflug war, nüchtern betrachtet, eine große Enttäuschung gewesen.
Doch mit Blick auf die zwei leeren Flaschen, die neben einem der als Bänke genutzten Baumstämme zurückgeblieben waren, konnte von einer nüchternen Betrachtung gar keine Rede sein. Und so schob Frida alles, was in den letzten Stunden geschehen war, dem Alkohol zu.
«Komm schon, Frida», hörte sie die einschmeichelnde Stimme des letzten verbliebenen Jungen an ihrer Seite. «Was ist denn schon dabei? Wir zwei passen doch wunderbar zusammen.»
Sie stieß seine Hand fort, die forsch ihren Oberschenkel hatte hinaufgleiten wollen. Von all der Auswahl, die sie noch kurz zuvor gehabt hatte, war ausgerechnet er übrig geblieben. Ihre Laune sank noch eine Spur tiefer, während sie seinem bettelnden Hundeblick auswich.
Zu Beginn, als sie noch mit dem hübschen Wilhelm allein im Gras gelegen hatte, war sie ihrem Ziel sehr nahe gewesen. Ein Junge aus gutem Haus, der einmal Arzt werden würde, war genau das, was sie sich für ihr Leben erträumte. Doch Wilhelm hatte zwischen zwei Küssen recht deutlich gemacht, was er von der Liebe zu einer einfachen Näherin hielt, und darauf gedrängt, diesen einen Nachmittag im Hier und Jetzt miteinander zu teilen und zu genießen, statt an die Zukunft zu denken. Da Frida immer an die Zukunft dachte, hatte sie augenblicklich jedes Interesse an ihm verloren.
Prompt waren kurz darauf, als hätte der Himmel sie ihr geschickt, seine fünf Freunde auf der Lichtung erschienen, und mit ihnen war eine wunderbare Feier in Schwung gekommen, in deren Verlauf es ihr gelungen war, seine kränkenden Worte zu vergessen. Warum sollte sie jemandem wie Wilhelm lange nachtrauern? Auch andere Mütter hatten hübsche und vor allem reiche Söhne. Oder zumindest solche, denen man anmerkte, dass sie einmal reich werden würden. Sie musste sich nur den richtigen heraussuchen.
«Ich werde zärtlich sein», flüsterte er ihr ins Ohr und schob erneut seine Hand unter ihren Rock.
Ihr Widerwille war plötzlich so groß, dass sie ihn gern in die Nase gebissen hätte, doch es gab andere, bessere Wege, einen Menschen zu verletzen, das hatte sie schon oft selbst erfahren müssen. Die letzte Lektion, erteilt vom lieben Wilhelm, der zwar die körperlichen Vorzüge einer jungen Näherin genießen, aber sie keinesfalls von Herzen lieben wollte, lag ja erst ein paar Stunden zurück. Jetzt war es an ihr, diesem aufdringlichen Exemplar heranreifender Männlichkeit eine eindeutige Absage zu erteilen. Er war es nicht wert, und genau das musste er nun lernen.
Frida rückte von ihm ab und holte tief Luft. «Wenn ich dich fragen würde, warum ich deinem Drängen nachgeben sollte, du hättest keine Antwort für mich. Und weißt du auch, warum?»
Er schüttelte den Kopf und schob sich wieder an sie heran. Der Alkohol musste auch seine Sinne vernebelt haben, sonst wäre ihm der barsche Unterton in ihrer Stimme aufgefallen.
Unbarmherzig begann sie nun mit der Auflistung ihrer Gründe, ihn absolut inakzeptabel zu finden. Manche waren rational und klar nachvollziehbar, manche waren vielleicht ein wenig gemein. Doch einmal angefangen, fiel es ihr schwer, ihre Tirade zu beenden. Und der Schmerz, den sie ihm mit ihren Worten zufügte, spiegelte sich so deutlich auf seinem Gesicht wider, dass es eine Wonne war. Frida verspürte diesen kleinen Funken Macht, den sie dank ihrer Schönheit über Jungen wie ihn hatte, und es tat ihr wohl, diese zu nutzen. Ganz besonders nach einem solch enttäuschenden Nachmittag.
Als sie mit ihm fertig war, sah er sie nicht einmal mehr an. Blass war er geworden und auch ein wenig zittrig. Doch Mitleid schien ihr jetzt fehl am Platz, sie tat gut daran, einfach das Weite zu suchen. Wenn sie nur gewusst hätte, was aus ihren Schuhen geworden war. Es half nichts, sie musste die Wiese Schritt für Schritt abgehen, dann würde sie irgendwann über ihr Eigentum stolpern.
Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, begann sie ihre Suche. Dabei summte Frida leise vor sich hin, als ob nichts geschehen wäre, und stellte sich vor, wie ihre Gleichgültigkeit ihm den Todesstoß versetzte. Gleichzeitig versuchte sie, sich selbst gut zuzureden. Sie war noch jung, irgendwann würde es ihr gelingen, den perfekten Ehemann zu ergattern. Dann würde die Näherin Frida Hollmann zur reichen Dame aufsteigen, ein Leben in Luxus führen und nie wieder an Rückschläge wie den heutigen auch nur denken.
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie er sich gar nicht weit von ihr entfernt nach etwas bückte, das im Gras lag. Ob er ihre Schuhe gefunden hatte? Frida marschierte schnurstracks auf ihn zu, doch das, was er nun aufhob, war kein Schuh. Es war das Gewehr, an das sie keinen Gedanken mehr verschwendet hatte, dessen Existenz ihr völlig entfallen war. Und die Mündung war direkt auf ihr Gesicht gerichtet.
Frida wollte etwas sagen, ihn bitten, das gefährliche Ding woandershin zu halten, doch da bemerkte sie den starren Blick seiner Augen, erkannte darin die Verletzungen, die ihre Worte ihm zugefügt haben mussten, und im selben Moment krümmte sich auch schon sein Finger am Abzug. Danach folgte ein Knall, so laut, dass Frida den tödlichen Schuss mehr hörte, als fühlte. Sie konnte nicht einmal mehr schreien. So endete ihr Leben also – im Sonnenschein, an einem wundervollen Sommertag am See.
Kapitel 1
1928, Berlin, Grunewald, Villa Breski
Ella Gössling gestand es sich nur ungern ein, aber überbackene Austern, Roastbeef und Ziegenkäse waren ganz offensichtlich keine Kombination, die ihr Magen zu schätzen wusste. So gelang es ihr schon seit einer Weile nicht mehr, die Party im Haus des Ehepaars Breski in vollen Zügen zu genießen, wie sie es sich eigentlich fest vorgenommen hatte.
Selten genug ließ ihr Ehemann Wilhelm sich dazu überreden, an einer Party teilzunehmen, meist sorgte er für ein rasches Verschwinden der Einladungen, indem er sie einfach ins Kaminfeuer warf, noch bevor Ella sie auch nur zu Gesicht bekommen hatte. Auf diese Weise war ihr sogar die Petersilienhochzeit ihrer Freundin Tutti durch die Lappen gegangen, und das hatte sie Wilhelm lange nicht verzeihen können.
Umso mehr hatte sich Ella auf diesen Abend bei den Breskis gefreut, die heute ihren Einzug in eine schmucke Villa in bester Lage mit Musik, Tanz und großem Buffet feierten. Ella kannte die Breskis zugegebenermaßen kaum. Paul Breski war ein Jugendfreund ihres Mannes, die beiden waren als Buben gemeinsam durch Spandau gestreift und hatten damals allerlei Unsinn getrieben, an den ihr Wilhelm, jetzt, wo er endlich die Praxis von dem alten Doktor Negrassus übernehmen würde, nicht mehr gern erinnert wurde. Seine Gattin, die sich Paul Breski erst vor etwa einem guten Jahr zugelegt hatte, war Ella ebenfalls fremd geblieben. Bei ihren wenigen Aufeinandertreffen hatten sich kaum Gemeinsamkeiten zwischen ihnen feststellen lassen. Evelyn Breski war eine oberflächliche Person, die kein anderes Gesprächsthema kannte als Frisuren und Mode. Doch die Breskis verstanden es zu feiern, was sicher auch an Pauls wunderbaren Kontakten zu guten Musikern lag. Dies war nicht überraschend, denn der Mann arbeitete immerhin im Vox-Haus am Potsdamer Platz, und seine Stimme war dank der steigenden Anzahl von Radiogeräten in Berlin inzwischen stadtbekannt.
«Bist du schon herumgeführt worden?», hörte sie unvermittelt Tuttis Stimme dicht neben ihrem Ohr rufen. Die Freundin drückte ihr unaufgefordert ein neues Champagnerglas in die Hand und spielte mit ihrer langen Perlenkette.
Wenn es um Äußerlichkeiten ging, war Tutti Ella stets ein Vorbild gewesen. Ihre Freundin trug meist die gewagtesten Kleider mit Trägern, die kaum mehr als Fäden zu bezeichnen waren, und Fransen am Saum, die bei jedem ihrer Tanzschritte lustig auf und ab flogen. Auch an diesem Abend steckte sie in einem blassrosa Traum, durchwirkt mit Silberfäden, und stahl allen anderen Damen, Evelyn Breski eingeschlossen, die Schau. Ellas eigenes, blondes Haar mochte recht kurz sein, ließ sich aber immer noch in weiche Locken legen, die ihr ein romantisches Aussehen verliehen. Aber Tuttis schwarzer Schopf war so kurz geschnitten, dass es ihr gerade noch gelang, eine einzelne Locke vor jedem Ohr zu formen, was sie sich bei Josephine Baker persönlich abgeschaut haben musste.
«Ich beneide diese Evelyn Breski bestimmt nicht um ihren dunkelroten Küchenboden. Jeder Krümel wird ihr von diesen extravaganten Fliesen entgegenleuchten. Aber hast du diese Badewanne im ersten Stock gesehen? Dafür würde ich morden.» Tutti zog an ihrer Zigarette, versuchte, lässig den Rauch aus dem Mundwinkel zu stoßen, bekam aber einen Hustenanfall.
«Warum hörst du nicht endlich damit auf?» Ella wedelte den blauen Dunst beiseite und rümpfte die Nase. «Jeder weiß, dass du den Geschmack von Zigaretten widerlich findest. Trotzdem mutest du dir und allen Menschen in deiner Umgebung diesen Geruch zu.»
«Es mag widerlich sein, steht mir aber ganz hervorragend.» Sie schwenkte kokett ihre brennende Zigarette und verstreute einen feinen Ascheregen auf dem Parkett. «Wo steckt eigentlich dein Mann? Will er nicht mit dir tanzen?»
«Solange nur Charleston und Foxtrott gespielt werden, ganz sicher nicht.» Ella seufzte. «Vielleicht, wenn irgendwann ein Walzer erklingt. Wilhelm ist in allen Dingen ein wenig altmodisch, wie du sehr wohl weißt.»
Tutti zog eine Braue hoch. «Bitte die Musiker doch einmal um den Sportpalastwalzer. Jetzt, wo Breskis Karriere so gewaltig an Fahrt aufnimmt und er immer öfter im Radio über die großen Veranstaltungen berichtet, etwa den Boxkampf in ein paar Tagen, darf ein Pfeifkonzert im Dreivierteltakt an diesem Abend doch nicht fehlen.»
Ella, die nicht wusste, was sie darauf erwidern sollte, blieb ein Kommentar erspart, als Tutti angesichts der nun von Kellnern hereingetragenen Süßspeisen wie Glumstorte und Liegnitzer Bombe in laute Begeisterung ausbrach.
Ella, die Torte üblicherweise durchaus zu schätzen wusste, trieb der Gedanke an den mächtigen Quark im Gebäck heute den Schweiß auf die Stirn. Sie hatte sich am Buffet ganz eindeutig übernommen.
Mit einem Mal wurde ihr bewusst, wie laut es im großen Saal der Villa Breski gerade zuging und wie verraucht die Luft hier drinnen nicht nur dank Tuttis glühender Zigarettenspitze war.
«Ich brauche etwas frische Luft», murmelte sie, entschuldigte sich bei Tutti, die bereits über die Liegnitzer Bombe herfiel, und bahnte sich an den tanzenden Gästen vorbei einen Weg in Richtung Ausgang. Erleichtert stellte sie fest, dass die Haustür offen stand und draußen, im Garten der Villa, Fackeln brannten, die das Gelände zu dieser späten Stunde in festliches Licht tauchten. Trotzdem schien sich niemand bei den Rabatten aufzuhalten, als Ella zwischen zwei protzigen Säulen aus Sandstein hindurchtrat, auf den Gehwegplatten stehen blieb und tief die Luft des Juliabends in sich einsog. Gleich fühlte sie sich besser. Das Völlegefühl verflog, nur eine Minute später nippte sie an ihrem Champagner und überlegte, ob sie es wagen sollte, den Hausherrn zu einem Charleston auf die Tanzfläche zu bitten. Darauf zu warten, dass Wilhelm sich ihrer erbarmte, hatte wenig Aussicht auf Erfolg.
Da ließ ein Geräusch über ihr sie aufhorchen. Es klang, als sei ein Fenster oder eine Tür geöffnet worden, und da sich direkt über dem Eingang der Villa ein ausladender Balkon befand, der von den zwei Sandsteinsäulen hinter ihr gestützt wurde, war dies auch gut möglich. Vermutlich führte die stolze Evelyn Breski gerade weiteren Gästen die Vorzüge ihres neuen Heimes vor. Die Villa war tatsächlich ein Schmuckstück.
Während Tutti sich von der großen Badewanne beeindruckt gezeigt hatte, war es bei Ella besagter Balkon gewesen, der sie beim Spaziergang durch die oberen Räume hatte neidisch werden lassen. Halbrund, ausladend, mit einer hüfthohen, aus Sandstein gefertigten Brüstung war es ein romantischer und intimer Ort, auch gerade deshalb, weil er nur über das Schlafzimmer der Breskis zu erreichen war.
Ella sah nach oben und versuchte, sich vorzustellen, wie sie selbst dort oben stand, gleich neben einer der mit Fuchsien bepflanzten Blumenschalen auf der Balustrade. Sie seufzte und verdrängte den Wunschgedanken. Eine Villa im Grunewald, und sei es auch nur zur Miete, lag für sie und Wilhelm noch in weiter Ferne. Vorerst durfte sie zufrieden sein, eine hübsche Wohnung mit stuckverzierter Wohnzimmerdecke in Charlottenburg ihr Zuhause nennen zu dürfen. Und das war, wenn man die Wohnsituation in Berlin bedachte, gewiss nicht das Schlechteste. Die hastig hochgezogenen neuen Bauten der Stadtplaner hatten bei Weitem nicht ausgereicht, um dem ständigen Strom derer, die es in die Hauptstadt trieb, Unterkunft zu gewähren. Noch immer wussten viele Menschen, denen man täglich auf den Straßen begegnete, nicht, wo sie die Nacht verbringen sollten. Betten wurden sogar stundenweise vermietet.
Ellas Gedankengang wurde unterbrochen, als Wilhelm durch die offene Vordertür ins Freie trat, in der einen Hand eine Zigarre, in der anderen ein gut gefülltes Likörglas. Seine Miene hellte sich bei ihrem Anblick auf. Er schien ehrlich erfreut, sie hier draußen vorzufinden.
«Ist es nicht ein ekelhaft lauter Abend?» Er stellte sich neben sie und bot ihr seinen Likör an, den sie mit einem vielsagenden Blick auf ihr Champagnerglas dankend ablehnte. «Die Pianistin ist betrunken, die Zigarren sind erschöpft, und die Herren der Schöpfung streiten seit einer geschlagenen Stunde über politische Themen. Ich weiß schon, warum ich Partys wie diese üblicherweise meide.»
«Über was würdest du dich denn gern unterhalten?», wollte Ella wissen und registrierte beiläufig ein erneutes Geräusch über ihren Köpfen. Wer immer den Balkon vorhin betreten hatte, musste sich noch immer dort aufhalten. Zu sehen war bei ihrem ersten Blick hinauf allerdings niemand gewesen. So schaute sie jetzt ein weiteres Mal zur Balustrade hoch, konnte jedoch noch immer keine Person im Halbdunkel ausmachen. Allerdings überkam sie das unbestimmte Gefühl, etwas müsste sich dort oben in den letzten Minuten verändert haben. Oder spielten ihr das flackernde Licht der Fackeln und die daraus resultierenden Schatten einen Streich?
«Sport ist ein gutes Thema, würde ich behaupten», ließ sich Wilhelm vernehmen, klemmte sich die Zigarre zwischen die Lippen und richtete sich mit der freien Hand das noch verbliebene Haupthaar. «Mit Literatur kann man im Prinzip auch nichts falsch machen.»
«Literatur?», wiederholte Ella und lächelte. «Literatur wie die von Tucholsky beispielsweise?»
«Ich denke, es gibt bessere Beispiele, Liebes.» Ihr Mann hob die Augenbrauen. «Rheinsberg ginge ja noch an, aber seine Weltanschauung ist mir ein Gräuel. Wie wäre es, wenn wir beide uns in die eigenen vier Wände zurückziehen, und ich lese dir noch ein wenig aus den Werken deutscher Dichtkunst vor?»
Jetzt hob auch Ella die Brauen und deutete auf Wilhelms Armbanduhr. «Es ist noch nicht einmal elf durch. Würde es nicht unhöflich wirken, sich jetzt schon zu verabschieden? Dein Freund Breski könnte denken, es hätte dir bei ihm nicht gefallen.»
«Aber es hat mir ja auch nicht gefallen!», bestätigte Wilhelm. «Überhaupt weiß ich gar nicht mehr, warum wir die Breskis noch treffen. Ich habe ihm eigentlich nichts mehr zu sagen. Die Zeit beim Radio hat aus ihm einen überheblichen Aufschneider gemacht.»
Wieder hörte Ella ein Geräusch, das vom Balkon herrühren musste, und sah hinauf. Genau wie bei allen Gelegenheiten zuvor war keine Menschenseele zu entdecken. Doch dafür stand ihr jetzt klar vor Augen, welche nicht unwesentliche Veränderung ihr kurz zuvor aufgefallen war, sich aber da noch nicht benennen ließ: Der linke der mit vielen roten Fuchsien bepflanzten imposanten Blumenkübel hatte auf rätselhafte Weise und ohne ersichtlichen Grund eine Wanderung entlang der Brüstung unternommen und stand jetzt genau über ihnen. Just in diesem Augenblick schwankten die roten Blüten bedenklich und das ganze Behältnis neigte sich dem Erdboden entgegen.
Ella stieß einen entsetzten Schrei aus, versetzte Wilhelm einen heftigen Stoß, der diesen zur Seite taumeln ließ, und sprang selbst nach vorn. Sie kam ungünstig auf. Der Absatz ihres linken Schuhs gab von einem hässlichen Knacken begleitet nach, und Ella stürzte auf die Gehwegplatten. Hart prallten ihre Knie auf Stein, während sie hinter sich den Aufprall der Keramikschale vernahm, die dieses Ereignis noch viel schlechter verkraftete als Ellas Knie. Blumenerde spritzte an ihr vorbei, Fuchsien flogen durch die Luft, und sie hörte ihren Mann laut fluchen. Letzteres verriet ihr, dass er wenigstens noch am Leben war.
Vorsichtig, nicht wissend, ob sie ernsthafte Verletzungen davongetragen hatte, setzte Ella sich auf und betrachtete ihre Beine. Die silbernen Tanzschuhe, kaum getragen, konnte ein Schuster vielleicht noch retten, wenn er den Bruch im Absatz zu richten verstand. Doch für ihre Seidenstrümpfe kam jede Hilfe zu spät. Blut sickerte aus einer Schürfwunde auf ihrem Knie durch das feine Material.
Wilhelm, der ebenfalls am Boden saß, stand auf und reichte ihr eine helfende Hand «Wir haben unverschämtes Glück gehabt», sagte er geschockt. «Das hätte unser Tod sein können.»
In diesem Moment erblickte Ella ihre Freundin Tutti, die tänzelnd in den Garten hinauskam.
«Du solltest unbedingt eine der Bomben versuchen, sie sind himmlisch.» Tutti, einen Dessertteller in der einen und die erhobene Gabel in der anderen Hand, hielt inne und deutete verwirrt auf die am Boden liegenden Scherben. «Habe ich irgendetwas verpasst?»
«Das könnte man so sagen», bestätigte Ella. «Ich vermute, soeben das Opfer eines Mordanschlags geworden zu sein. Zum Glück schlug er fehl.»
«Mord?» Tutti ließ die Gabel sinken und sah sie überrascht an.
«Entweder das, oder Blumenkübel bewegen sich neuerdings von selbst», sagte Ella und blickte hinauf zum dunklen Balkon, an dessen Balustrade nach wie vor niemand zu sehen war. Mit einem Mal hatte der bisher so unschuldige Abend eine bedrohliche Wende genommen.
Kapitel 2
Prenzlauer Berg, Wohnung von Euprosina Zieginski
«Frohes neues Jahr, Frau Zieginski», rief Leonard, als er aus der Kammer trat und unvermittelt seiner Vermieterin gegenüberstand.
«Das heißt Guten Morgen, du Einfaltspinsel», entgegnete die korpulente Frau im verschossenen Kittel, über dem sie zusätzlich eine kaum kleidsamere Schürze trug. «Heute ist der 12. Juli 1928, wie kommt man denn da auf die Idee, jemandem ein frohes neues Jahr zu wünschen?»
«Weil ich heute ganz neu anfange. Was vorher war, spielt nun keine Rolle mehr.» Leonard rieb sich die Hände und wagte einen Blick in den Garderobenspiegel, den die Witwe Zieginski vermutlich gerade wegen seiner verzerrenden Eigenschaften besonders zu schätzen wusste. Er zauberte jedem, der hineinblickte und eine ungefähre Körpergröße von einsfünfundsiebzig aufwies, eine schlanke Taille. Weniger günstig wirkte er sich auf das Abbild deutlich kleinerer Zeitgenossen aus, denen er schlimmstenfalls den Kopfumfang eines Kohlrabis andichtete. «Da Sie das Datum des heutigen Tages so gut kennen, werden Sie wohl schon die Zeitung gelesen haben. Ob ich wohl einen Blick hineinwerfen könnte?»
«Nee, dat kannste nicht, Jungchen.» Seine Vermieterin, die sich nur selten bemühte, hochdeutsch zu sprechen, verfiel wie so oft ins Berlinerische, bevor sie sich nach kurzem Räuspern wieder gefangen hatte. «Die Berliner Volkszeitung habe ich natürlich zuerst dem Schreiner Scholle im zweiten Stock gebracht, der bezahlt schließlich dafür. Hat er sie ausgelesen, geht sie weiter an seinen Nachbarn und dann zurück zu mir. Vor dem späten Nachmittag gibt es hier keine Zeitung für dich, und bis dahin bist du ja wohl wieder weg, denn dann braucht der kleene Bäckerlehrling dein Bett.»
«Die Berliner Volkszeitung?» Leonard runzelte die Stirn, über der er erst kurz zuvor sein dunkelbraunes Haar glattgestrichen hatte. Noch immer musterte er sein Spiegelbild, das ihm wie immer durchaus ansprechend erschien. Ein schlanker junger Mann mit ausdrucksstarken Brauen über hellen Augen. Die Kleidung hätte gepflegter sein können. Doch für jemanden, der sich selbst den Schlafplatz für die halbe Nacht nur so gerade eben leisten konnte, sah er noch recht manierlich aus. Und ohnehin würde nun bald alles anders werden. Heute war der erste Tag seines neuen Lebens.
«Liest denn in diesem Haus niemand das Berliner Tageblatt?»
«Ist es nicht egal, wo die Nachrichten herkommen?» Sie stützte sich auf ihren Schrubber. «Tatsachen verändern sich doch nicht.»
«Oh doch», widersprach Leonard und beendete seine Musterung. «Ganz besonders in Berlin. – Da fällt mir ein: War die Post heute schon da?»
«Das war sie.» Die Witwe Zieginski nickte, was ihren grauen Haarknoten leicht ins Wanken brachte. «Und darüber sollten wir beide uns auch noch einmal unterhalten. Du hast hier ein Bett gemietet und nicht meine Adresse. Wie kommt ett, dass ich heute zwee Briefe für Leonard Reiter bekommen habe?»
Er schenkte ihr ein entschuldigendes Lächeln. «Ich wäre bereit, Ihnen monatlich die freundliche Summe von einem halben Groschen zukommen zu lassen, wenn Sie auch meinen Briefen für ein paar Stunden am Tag Unterschlupf gewähren würden.»
«Einen halben Groschen? Jungchen, ich mag dich, aber ich muss gucken, wo ich bleibe», gab die Witwe zu bedenken. «Außerdem macht mich das doch zu irgendetwas, wenn ich deine Post entgegennehme. Zu einer Art Angestellten, könnte man sagen.»
«Also gut, einigen wir uns auf einen Groschen für meine neue Angestellte.» Leonard streckte ihr auffordernd die Hand entgegen. «Wo sind denn die Briefe?»
«Kannste mich im Voraus bezahlen? Dat Jeld für den Strom wird schon wieder knapp.» Sie stand, noch immer auf den Schrubber gestützt, vor ihm, und Leonard hielt jede Wette, dass seine Benachrichtigungen in den Taschen ihrer Schürze steckten.
«Ich bin selbst etwas klamm, zudem haben Sie Ihren Portiersposten doch gerade erst angetreten.»
«Meinen wat?» Sie sah ihn verständnislos an.
Leonard seufzte. «Liebe Frau Zieginski, ich muss Ihren Groschen erst einmal verdienen. Und dazu brauche ich die Briefe. Ich habe nämlich eine Annonce aufgegeben, in der ich meine Dienste anbiete. Das, was Sie mir vorenthalten wollen, werden die Antwortschreiben meiner zukünftigen Auftraggeber sein.»
«Du hast das Geld für eine Annonce im Berliner Tageblatt, aber keinen Groschen für meinen Lohn?» Sie hob die Brauen, welche kaum weniger buschig waren als seine eigenen. «Wo ist denn überhaupt dein Hut geblieben, Junge?»
«Im Pfandhaus», gestand Leonard. «Im Sommer braucht ohnehin niemand einen Hut, und bis zum Herbst werde ich ihn wieder ausgelöst haben. Immer vorausgesetzt, Sie entlassen meine Briefe aus der Geiselhaft.»
«Na, dann will ick mal nich so sein. Einem aufstrebenden, jungen Mann muss man doch unter de Arme greifen.» Sie zwinkerte ihm zu und griff in ihre Schürzentasche, woraufhin sie ihm zwei braune Umschläge übergab. «Was für Dienste bietest du denn an? Hoffentlich geht es nicht um etwas Illegales oder Unanständiges? Du wirst dich doch nicht mit den Ringbrüdern eingelassen haben?»
Leonard schüttelte den Kopf. Mit dem organisierten Verbrechen hatte er nichts zu schaffen, und so sollte es nach Möglichkeit auch bleiben. Er hing zu sehr an seinem Leben und seinem guten Aussehen, um beides leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Die Umschläge in seine eigene Jackentasche schiebend, schritt er zur Haustür. «Wir sehen uns heute Nacht, Frau Zieginski.»
«Aber nicht vor zwei Uhr, Jungchen», rief diese ihm nach. «Vorher liegt doch der Bäckerjunge in deinem Bett.»
«Nicht mehr lange», rief Leonard zurück. Es war seine erste Prophezeiung des heutigen Tages und mit etwas Glück nicht seine letzte. Denn ab heute war er der beste Hellseher von Berlin und gedachte, spätestens am Ende des Monats auch der berühmteste zu sein. Zwei leichtgläubige Personen hatte seine Annonce immerhin schon auf den Plan gerufen, und sicher würden noch einige weitere folgen.
Während er durch die Straßen flanierte, seinen Hut vermisste, der ihm ein so weltgewandtes Äußeres verliehen hatte, öffnete er den ersten Umschlag. Ein schwacher Geruch, der an Seife erinnerte, stieg ihm in die Nase. Der gleiche Duft, der neuerdings den Laken seines gemieteten Bettes anhaftete.
Als er vor einigen Nächten zum ersten Mal in die warme Kuhle des Schlafburschen geschlüpft war, der vor ihm in demselben Bett in Zieginskis Kammer nächtigte, hatte ihn für den Rest der Nacht ein durchdringender Schweißgeruch umhüllt. Doch nun schien eine Veränderung mit dem ihm im Grunde fremden Bäckerlehrling vorgegangen zu sein, und Leonard tippte als Ursache messerscharf auf die Macht der Liebe. Immer vorausgesetzt, der Bäckerlehrling war so schlau gewesen, sich nicht ein Mädchen aufzuhalsen, das noch schlechter gestellt war als er selbst, würde er vermutlich bald das Bett wechseln. Und dies bedeutete für Leonard, zukünftig etwas eher schlafen gehen zu können. Immer vorausgesetzt, er verdiente genug Geld, um sich das Bett bei Euprosina Zieginski auch weiterhin leisten zu können. Er besah sich seine Post genauer. Im Falle der Nachricht in seiner Hand deutete der am Papier haftende Duft seiner Meinung nach auf eine Dame fortgeschrittenen Alters hin.
«Wäre sie jung und hübsch, hätte sie Rosenduft statt Lavendel benutzt», dachte er für sich und faltete den Bogen auseinander. «Oh ja, es gehört nicht viel dazu, ein Hellseher zu sein. Man muss nur hinsehen, hinhören und manchmal auch das Näschen benutzen.»
Genaues Hinhören und Hinsehen gehörte schon Zeit seines Lebens zu Leonards Tugenden, denn sein Vater war ein Mann mit gefährlichen Stimmungsschwankungen gewesen. Der locker sitzenden Hand seines Erzeugers zu entkommen, bedurfte ein großes Maß an Feingefühl und Vorausschau. Leonard besaß beides, und die Jahre im Elternhaus hatten seine Sinne geschärft. Der Gedanke, daraus ein Geschäft zu machen, war ihm gekommen, als einige Tage zuvor der Wind eine ausgelesene Ausgabe einer Tageszeitung vor seine Füße geweht hatte. Im Anzeigenteil stieß er auf die Nachricht einer Wahrsagerin, die ihre Dienste anbot. Zwar lag die große Zeit des Spiritismus schon ein paar Jahre zurück, doch die Naiven starben ja bekanntlich nicht aus. Und was sprach dagegen, sich einmal auf diesem Gebiet zu versuchen? Jede Arbeit, die Geld und irgendeine Art von Ansehen versprach, war Leonard recht, ein halbwegs ehrlicher Betrug schien aber vertretbarer als echte Verbrechen. Er würde seinen Kunden etwas für ihr Geld bieten, und zwar genau das, was sie von ihm hören wollten. Dank ihm würden sie nach Inanspruchnahme seiner Dienste glücklicher sein als zuvor, dafür konnte man schon eine Kleinigkeit verlangen.
Gleich dieser erste Brief jedoch stellte ihn vor Probleme. Die Verfasserin suchte eher ein Medium als einen Hellseher und wünschte, mit ihrer verstorbenen Katze im Jenseits in Kontakt treten zu können. Leonard stellte sich kurz vor, wie er der Dame um die geschwollenen Beine strich, dabei leise Schnurrgeräusche von sich gab und gelegentlich miaute. Nein, dieser Auftrag kam nicht infrage. So verzweifelt war er noch lange nicht. Eher würde er seinen Hut abschreiben, als sich von der Briefeschreiberin hinter den Ohren kraulen zu lassen.
Er öffnete den zweiten Brief, einen schlichten Umschlag, in dessen obere Ecke eine erblühte Rose gepresst worden war. Ganz offensichtlich stammte auch dieses Schreiben von einer Frau. Leonard ging davon aus, es in seinem neuen Beruf weit häufiger mit dem weiblichen Geschlecht zu tun zu bekommen als mit den Herren der Schöpfung, und es störte ihn überhaupt nicht.
Sehr geehrter Herr Reiter,
besuchen Sie mich nach Erhalt dieser Nachricht unter beigefügter Adresse. Es gilt, einer gequälten Seele Ruhe zu schenken, und dafür scheinen Sie genau der richtige Mann zu sein.
Höflichst
Tutti Riehl
Leonard zog augenblicklich die Brauen hoch. Er ging davon aus, dass ‹Tutti› nirgendwo auf der Welt ein Taufname sein konnte. Die Dame unterschrieb mit ihrem Spitznamen, womöglich, weil man bei ihrer Geburt eine Erbtante fröhlich stimmen wollte und diese ihr einen ganz abscheulichen Vornamen vermacht hatte. Obwohl er sich schwer etwas Schlimmeres vorstellen konnte, als den Namen seiner Vermieterin, Euprosina Zieginski, vermutete er, dass Tutti unter ihrem richtigen Namen litt. Dies war die erste wichtige Information, die der Brief ihm über das Offensichtliche hinaus gab. Die Adresse wies ihm den Weg nach Charlottenburg, und zwar in eine Straße, wo die Betten sicher niemals stundenweise vermietet wurden. Das ließ hoffen. Die Schrift der Fremden stellte kein unsicheres Gekrakel dar, sondern lief in runden und ausladenden Buchstaben wie selbstverständlich über das Papier. Keinesfalls ein unsicherer Charakter, trotz des ungeliebten Namens, das spürte er.
Während Leonard darüber nachdachte, wie er es am besten angehen wollte, bemerkte er, dass seine Füße längst die Treppen zur U-Bahn hinunterstiegen. Er befand sich auf dem Weg nach Charlottenburg zu seinem ersten Auftrag.
Nicht weit entfernt vom Café Kögel fand er sein Ziel, bewunderte die weiß getünchte Fassade des Mehrparteienhauses, trat durch die nur angelehnte Tür und schellte gleich links im ersten Stock bei Riehl. Wenige Minuten später wurde ihm geöffnet.
«Herr Reiter?» Die junge Frau wartete seine Antwort gar nicht erst ab, sondern zog ihn sogleich in den Flur hinein und schloss die Tür.
Für Leonard stand außer Frage, dass er Tutti Riehl gegenüberstand, einer jungen selbstbewussten Frau mit langen Beinen, die sie offensichtlich gern zeigte, obwohl es noch mitten am Nachmittag war und das laubfroschgrüne Charlestonkleid ein wenig unpassend wirkte. Ihr Haar, so kurz, dass es keiner Spange oder Kamm mehr Halt gegeben hätte, schimmerte im Licht eines mit Kristall behängten Kronleuchters hinter ihr wie lackiert. Die Dame passte wunderbar in die helle und saubere Umgebung. Die Familie Riehl war ohne Frage wohlhabend, und Leonards Herz tat einen erfreuten Hüpfer. «Ich bin so froh über Ihren Besuch, es muss einfach etwas geschehen. Die arme Ella macht sich selbst ganz verrückt mit ihren fixen Ideen. Nicht mehr lang, und sie wird sich weigern, die Wohnung überhaupt noch zu verlassen.»
Sie traten in einen Salon, dessen Mobiliar nicht ganz der neusten Mode entsprach, aber äußerst gut erhalten war, und Leonard antwortete: «Vertrauen Sie mir. Gemeinsam wird es uns gelingen, Ella ihre Angst zu nehmen.»
«Woher wissen Sie von Ellas Angstzuständen?» Verblüffung zeichnete sich im Gesicht der jungen Frau ab, während Leonard beiläufig an ein Bücherregal herantrat und ein Exemplar herauszog, welches sich gegenüber den anderen durch starke Gebrauchsspuren auszeichnete. Scheinbar beiläufig blätterte er durch die ersten Seiten, stellte es zurück und verfuhr mit einem weiteren Buch auf die gleiche Weise. Dass diese unbekannte Ella eine ängstliche Person sein musste, hatte er aus Tuttis eigenen Worten geschlossen, aber das würde er ihr nicht verraten.
«Sie erinnern sich, einen Hellseher angefordert zu haben?» Er stellte auch das zweite Werk zurück an seinen Platz und nahm auf dem Sessel gegenüber dem Sofa Platz, der für Besucher bereitgestellt schien. «Da sollte es Sie nicht wundern, wenn ich mehr über die Angelegenheit weiß, als Sie vermuten können.»
«Das ist ganz und gar erstaunlich.» Tutti Riehl lief mit hektischen kleinen Schritten auf ein Tischchen zu, wo eine Karaffe und Likörgläser auf ihren Einsatz warteten. «Wie machen Sie das?»
Als sie ihm ein gefülltes Glas reichte, griff er nach ihrer schmalen Hand, hielt sie fest und schloss die Augen. Leonard ließ Zeit verstreichen, bevor er die schlanken Finger freigab, ihr einen tiefen Blick aus seinen hellen Augen schenkte und sagte: «Es ist eine Gabe, Auguste. Ich wurde damit geboren.»
«Tutti, bitte», verbesserte sie ihn und sank, ein wenig blass geworden, auf das mit edlem Stoff bezogene Sofa. «Ich gebe zu, Ihr Talent ist schon ein wenig unheimlich. Außer meinem Mann und meinen Eltern kennt niemand meinen wirklichen Namen.»
Leonard lächelte. Er hätte sie natürlich darauf hinweisen können, dass eben jene Eltern den Märchenband im Bücherregal der lieben Auguste zum neunten Wiegenfest im Jahre 1910 geschenkt und mit einer Widmung versehen hatten. Doch dies hätte den umwerfenden Effekt seines Taschenspielertricks geschmälert.
«Trotz meines offensichtlichen Talents sind die Informationen über meine Mitmenschen oft unvollständig», räumte Leonard ein. «Wenn Sie mir also ein wenig von Ella und dem Moment erzählen würden, da sie ihr Selbstvertrauen verlor, würde es meine Arbeit erleichtern.»
Tutti nickte eifrig. «Darüber hinaus muss ich Sie natürlich in meinen wunderbaren Plan einweihen. – Oh!» Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. «Oder kennen Sie den auch schon?»
Er lächelte sie nachsichtig an und genoss den Schauer, der sie zu überlaufen schien. Leonard nutzte den Moment ihrer Bewunderung, um weitere Eindrücke zu sammeln, entdeckte die bereitgestellten Sektschalen auf der Fensterbank und wagte einen weiteren Versuch, seinen Ruf zu festigen. «Also, wie viel Zeit bleibt uns, bis die Gäste eintreffen?»
«Herr Reiter.» Tutti Riehl strahlte über das ganze Gesicht, klatschte in die Hände und sah zur Zimmerdecke empor. «Jetzt weiß ich, dass alles wieder gut wird.»
Kapitel 3
Charlottenburg, Dreizimmerwohnung der Riehls
Als gegen sieben Uhr abends die Türglocke der Riehls läutete, war Leonard vollständig im Bilde und bereit für seinen ersten großen Auftritt in der besseren Gesellschaft. Bei Likör und Makronentörtchen war ihm von Tutti weit mehr erzählt worden, als er benötigte, um diesen Abend ohne grobe Schnitzer zu überstehen. Er kannte die Namen aller geladenen Gäste und hatte nun eine recht genaue Vorstellung von der armen Ella Gössling. Jener Frau, die sich seit dem fast tödlichen Zwischenfall in der Villa eines Radiosprechers immer weiter in die Angst hineingesteigert hatte, von einem Unbekannten bedroht zu werden. Der Radiosprecher war von Tutti Riehl ebenfalls geladen worden, hatte aber kurzfristig abgesagt, was Leonard sehr schade fand. Ein persönlicher Kontakt zu einem Mann vom Funk hätte sich für seine Karriere als hilfreich erweisen können.
Auch Ellas Gatte Wilhelm, der nun bald eine eigene Arztpraxis führen würde, war ihm detailliert beschrieben worden. Leonard war davon überzeugt, mit dem introvertierten Bücherwurm an diesem Abend gut zurechtzukommen. Wesentlich besser vermutlich, als mit Theo Riehl, dem Hausherrn, der eine Stunde vor dem geplanten Eintreffen der Gesellschaft heimgekehrt war und Leonard kaum eines Blickes gewürdigt hatte. Aber ein einzelner Zweifler am Tisch stellte kein Problem dar, davon war Leonard überzeugt. Dies würde seine erste Vorstellung werden, und er wusste, er musste glänzen. Eigentlich konnte schon gar nichts mehr schiefgehen, da Tutti ihm bereits aus der Hand fraß.
Gleich bei den ersten beiden Gästen, die von der Gastgeberin in den Salon geführt wurden, handelte es sich der Beschreibung nach um das Ehepaar Gössling. Und Leonard musste seine zuvor getätigte Einschätzung korrigieren, denn der Allgemeinmediziner wirkte auf den ersten Blick keinesfalls so auf ihn, wie er es aus Tuttis Worten geschlossen hatte. Der Bücherwurm beäugte ihn schon misstrauisch, bevor sie einander auch nur vorgestellt wurden, wirkte angespannt und nervös. Leonard fragte sich, ob dies ebenfalls auf das Erlebnis mit dem Blumentopf zurückzuführen war oder ob seitdem weitere Ereignisse stattgefunden hatten, die Wilhelm Gössling um seinen Seelenfrieden brachten.
«Darf ich euch Leonard Reiter vorstellen?» Tutti eilte an seine Seite und führte ihn zu den Gösslings. Derweil läutete es zum zweiten Mal, und Leonard hörte mit halbem Ohr, wie der Hausherr weitere Gäste einließ. Gleichzeitig beobachtete er Ellas Gesicht, während seine hellseherischen Fähigkeiten von der Gastgeberin in den höchsten Tönen gelobt wurden.
Schon bald pflichtete Leonard Tutti insgeheim bei: Ella Gösslings Bewegungen wirkten fahrig, ihre Hände befanden sich in ständiger Bewegung, und der Hals wollte zwischen hochgezogenen Schultern verschwinden. Darüber hinaus schien es ihr nicht leicht zu fallen, still zu stehen. Sie zappelte herum wie ein Backfisch und hielt immer wieder inne, nur um kurz darauf erneut ihren Händen und Füßen ein Eigenleben zu gestatten. Auch in ihrem Fall war es für Leonard schwer vorstellbar, dass diese Unruhe auf nur einen einzigen, auch schon Tage zurückliegenden Vorfall zurückzuführen war. Irgendetwas ging bei den Gösslings vor sich, und Leonard wünschte sich, noch mehr darüber zu erfahren. Jede noch so kleine Information würde ihm die Arbeit erleichtern.
«Sie sind also ein berühmter Hellseher?», ließ sich nun Ellas Gatte vernehmen. «Wie kommt es, dass ich noch nie von Ihnen gehört habe?»
«Um berühmt zu sein, ist es nicht zwangsläufig vonnöten, täglich in der Presse erwähnt zu werden. Obwohl es natürlich von Vorteil wäre.» Leonard lächelte höflich und ließ sich von Tutti eine Sektschale reichen. Er gedachte allerdings nicht, davon zu trinken. Das Glas diente ihm lediglich als Requisite, sollte ihn gesellig und locker erscheinen lassen. Tatsächlich durfte seine Aufmerksamkeit in den nächsten Stunden nicht erlahmen.
«Wie sonst definiert sich Ruhm, wenn nicht über Zeitungsmeldungen und Ähnliches?» Wilhelm Gössling klang amüsiert, aber auch spöttisch.
«Man kennt mich.» Erwiderte Leonard leichthin. «Wer eines Hellsehers bedarf, kommt schwerlich an mir vorbei. Zumindest hier in Berlin.»
«In Berlin?» Der Allgemeinmediziner schien sich zu amüsieren. «Ihrer Aussprache nach sind Sie in dieser Stadt ein Fremder, Herr Reiter. Alles, was Sie von sich geben, klingt sehr danach, als hätte ein Ostwind Sie herbeigeweht.»
«Ich stamme aus Königsberg.» Jetzt war es Leonard, der einen überheblichen Ton anschlug. «Doch meine Heimatstadt hat keine Verwendung für einen zweiten brillanten Hellseher, daher überlasse ich dieses Feld meinem Vater. Das Talent liegt bei uns in der Familie.»
«Und Sie sind gekommen, um sich der Berliner anzunehmen, wie großzügig. Jetzt fühlen wir uns doch alle gleich viel besser.» Der Mann wandte sich demonstrativ von Leonard ab und dem Gastgeber zu, von dem er sich eine Zigarre reichen ließ.
Leonard spürte Zorn in sich aufsteigen. Leute wie Wilhelm Gössling, die andere geringer schätzten und keine Gelegenheit ausließen, dies auch zur Schau zu tragen, reizten ihn bis aufs Blut. Doch er zwang sich, seine Konzentration auf dessen Frau Ella zu lenken, denn ihretwegen war er schließlich hier. Und ihr unhöflicher Gatte hatte ihm soeben einen Gesprächsaufhänger offeriert, den er zu nutzen gedachte.
«Ich wünschte, es würde Ihnen besser gehen.» Er schenkte Ella einen fürsorglichen Blick. «Sie sind blass, Frau Gössling. Etwas beunruhigt Sie. Ein Schatten hat sich auf Ihre Seele gelegt. Dabei fühle ich, dass Sie eigentlich glücklich sein sollten.»
«Sollte ich das?» Sie sah ihn unsicher an. Ihre hellen Augen sahen zu ihm auf, und Leonard bemerkte ihre zarte Schönheit, die an der Seite ihres unsympathischen Gatten kaum zur Geltung kam.
Er stellte das Sektglas beiseite und hielt der Frau die ausgestreckte Hand entgegen. Zuerst begriff Ella Gössling diese Geste nicht. Dann zögerte sie kurz, und schließlich legte sie ihre Hand in seine. Er umschloss diese augenblicklich mit den Fingern und hielt sie fest.
«Sie stehen erst am Anfang», murmelte er und fühlte die erbsengroßen Schwielen in ihrer Handfläche. «Vieles erscheint Ihnen noch mühsam, der Weg zu einem sorglosen Leben ist noch weit und voller Plagen. Aber es dauert nicht mehr lang.» Er strich über den sorgfältig eingecremten Handrücken. «Gerade klopft der Wohlstand an Ihre Türe und bringt Ihnen auch ein ganz persönliches Glück. Ein Junge wird es wohl werden. Zunächst. Aber im Schatten steht ein kleines Mädchen, und es wartet darauf, geboren zu werden.»
«Zwei Kinder?» Über ihr Gesicht huschte ein zaghaftes Lächeln und vertrieb die sich darauf abzeichnenden Sorgen. «Wilhelm wollte damit warten, bis wir sie uns leisten können.»
«Das können Sie bereits.» Er ließ ihre Hand los. «Noch länger zu warten, nutzt niemandem. Es ist an der Zeit. Schauen Sie zuversichtlich nach vorn, und alles wird gut werden.»
«Wirklich?» Ihre Unterlippe begann zu zittern, und sie wickelte sich fester in die Stola aus Häkelgarn. «Ach, was wäre das schön.»
Befriedigt griff Leonard wieder nach seinem Glas. Die erste Hürde war genommen, und er spürte so etwas wie Erleichterung. Jetzt gönnte er sich erstmals einen Schluck des perlenden Getränks.
Ein Blick auf Ella Gösslings nun wesentlich entspannter wirkende Haltung belegte seinen Erfolg. Eigentlich war es fast zu einfach gewesen. Im Grunde wollten auch die modernen Frauen von heute alle das Gleiche: Sicherheit und Kinder. Er hatte ihr beides in Aussicht gestellt und ihr damit Seelenfrieden geschenkt. Auf manche Klischees war eben Verlass.
Zufrieden beobachtete er in den kommenden Minuten, wie sich die Körpersprache von Ella Gössling weiter veränderte, sie gelöster und glücklicher aussah, sogar einmal laut über einen eher schlechten Witz des Hausherrn lachte. Tutti Riehl warf ihm bewundernde und dankbare Blicke zu, während sich der kleine Salon weiter mit Gästen füllte. Inzwischen zählte Leonard etwa ein Dutzend Gesichter. Es schien sich bei den Anwesenden fast ausschließlich um junge, finanziell gut gestellte Paare zu handeln, und allen wurde er als berühmter Hellseher vorgestellt. Die Reaktionen darauf waren höchst unterschiedlich und bewegten sich zwischen Neugier und offener Ablehnung. Letztere trat vor allem im Gesicht des Wilhelm Gössling zutage, der nun mit seiner lächelnden Gattin tuschelte. Offensichtlich ging es bei dem Gespräch um ihn, den Hellseher, denn der immer zorniger werdende Blick des Mannes ruhte ununterbrochen auf seiner Person. Leonard versuchte, es gelassen zu nehmen. Wenn Wilhelm die Aussicht auf die baldige Geburt eines Stammhalters weniger erfreute, so war dies nicht unbedingt ein Problem. Ella Gössling glaubte seinen Worten, und darauf kam es an.
Inzwischen wurden Käseplatten herumgereicht und fanden reichlich Zuspruch. Auch Leonard genoss nun in vollen Zügen, Gast dieser Party zu sein. Er sah seinen Auftrag als erfüllt an. Und es traf ihn doch ein wenig überraschend, als Tutti plötzlich gegen ihr Glas schlug und so die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog.
«Liebe Freunde», begann sie. «Ich habe euch allen bereits unseren Gast, Leonard Reiter, vorgestellt, der über einen hervorragenden Ruf als Hellseher verfügt, und auch mich heute bereits mehrfach von seinem Können überzeugt hat. Versäumt also nicht die Gelegenheit, ihm die Hand zu reichen. Er weiß mehr über euer Leben als ihr selbst.»
Leonard ließ sich nicht anmerken, überrumpelt worden zu sein, nickte ihr freundlich zu, und ließ in seinem Kopf noch einmal alle Phrasen Revue passieren, auf die er womöglich in den kommenden Stunden würde zurückgreifen müssen. Er vermutete, dass Tuttis Angebot zunächst zögerlich, mit steigendem Alkoholpegel der Anwesenden aber immer begeisterter angenommen werden würde. Wenn er es geschickt anstellte, konnten dieser Einladung viele weitere folgen. Seine Karriere käme in Schwung.
«Ein Scharlatan aus dem Osten will mir erzählen, wann ich Vater zu werden habe. Das ist ja lächerlich», vernahm er in diesem Moment die laute Stimme von Wilhelm Gössling. «Die Wahrsagerei ist ausgemachter Blödsinn, und alle, die etwas anderes zu behaupten wagen, sind in meinen Augen Narren.»
Leonard verzog keine Miene, während es um ihn herum deutlich stiller wurde. Ihm war offensichtlich der Fehdehandschuh hingeworfen worden, und man erwartete eine Reaktion seinerseits. Doch er war fest entschlossen, sich nicht provozieren zu lassen.
«Reich doch du unserem Gast die Hand, Wilhelm. Dann werden wir ja erfahren, was dir ins Haus steht. Oder hast du Angst?» Tutti sah den Ehemann ihrer Freundin herausfordernd an.
Ella Gössling selbst war still geworden. Sie hielt sich im Hintergrund und schien betrübt darüber, dass die Worte, die sie als freudige Botschaft empfunden hatte, bei Wilhelm eine ganz andere Wirkung entfalteten.
«Ich und Angst vor einem Hochstapler? So weit kommt es noch.» Der Mediziner ließ so viel Verachtung wie möglich in seiner Stimme mitschwingen. Dann legte er seine Zigarre in einem bereitstehenden Aschenbecher ab und ging einige Schritte auf Leonard zu, blieb aber schließlich mitten im Raum stehen und streckte bereitwillig seine rechte Hand aus. «Nun? Sind Sie bereit für die große Blamage?»
Leonard fiel es zunehmend schwerer, ruhig und gelassen zu bleiben. Wäre ihm dieser Kerl in einer dunklen Gasse begegnet, er hätte ihm eins verpasst, und er konnte sich gut vorstellen, dass andere Zeitgenossen ganz genauso empfanden. War der Beinahe-Zusammenstoß mit dem Blumenschmuck doch ein Anschlag auf das Leben von Gössling gewesen?
Denkbar schien es durchaus, und es war zudem eine der wenigen Informationen, die ihm über den Mann zur Verfügung standen. Wollte er heute Abend weiterhin überzeugen, würde er darauf wohl oder übel zurückgreifen müssen.
Leonard tat einen übertrieben schweren Atemzug, setzte sich in Bewegung und blieb vor Wilhelm Gössling stehen. Wortlos ergriff er die knochige, sich vom vielen Waschen spröde anfühlende Hand des Arztes und schloss die Augen. Um sie herum war es mittlerweile totenstill geworden. Gespannt verfolgte die Abendgesellschaft, was in ihrer Mitte geschah.
Leonard ließ sich Zeit. Er versuchte zu erspüren, was in seinem Gegenüber vorging. Nervosität war Gössling jetzt weniger anzumerken als zu dem Zeitpunkt, da er den Salon betrat. Er schien sich in seine Wut und Empörung hineingeflüchtet zu haben, gerade weil sie ihm lieber war als die Gefühle, die ihn zu Beginn des Abends beherrscht hatten.
Ruhig und besonnen sprach Leonard sein erstes Wort: «Nein.» Nun öffnete er die Augen. «In Ihrer Zukunft sehe ich keine Kinder. Weder Jungen noch Mädchen.»
«Wie ungewöhnlich.» Gösslings Augen wurden schmal. «Wo Sie doch so dreist waren, meiner Gattin das Gegenteil zu erzählen. Wollen Sie ihr damit etwa Untreue unterstellen?»
Leonard ging nicht auf ihn ein. Noch immer hielt er die Hand des Arztes und fuhr unbarmherzig fort: «Ich sehe Feinde, die aus dem Nebel treten. Jemand trachtet Ihnen nach dem Leben. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Sonst werden Sie kaum alt genug werden, um irgendeinem Kind ein Vater zu sein.»