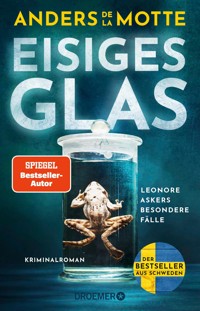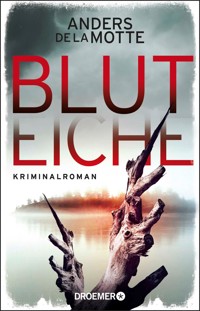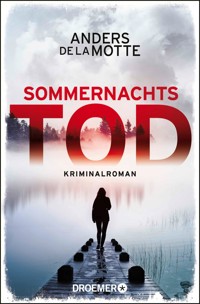
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kind verschwindet, ein Dorf schweigt - ein fesselnder Kriminalroman von Schwedens peisgekröntem Autor Anders de la Motte Ein Schatten scheint über einem Dorf in Südschweden zu liegen, seit dort vor 20 Jahren der kleine Billy Lindh spurlos verschwand. Die Mutter des Jungen nahm sich daraufhin das Leben, ein Verdächtiger, dem aber nichts nachgewiesen werden konnte, tauchte unter und ließ Frau und Kinder im Stich. Nun kehrt Billys Schwester, die Therapeutin Vera Lindh, in ihren Heimatort zurück: Ihr neuer Patient Isak hat ihr eine alarmierende Geschichte über einen verschwundenen Jungen erzählt, und Vera will endlich wissen, was damals wirklich geschehen ist. Längst nicht jedem im Dorf gefallen ihre hartnäckigen Fragen. Und wie vertrauenswürdig ist eigentlich Isak? »Ein absolut brillanter Krimi! So scharfsinnig und einfühlsam, und gleichzeitig so unendlich spannend.« Kristina Ohlsson »Ein packender Krimi mit atmosphärischem Setting, starken Figuren und spannender Story! Mit ›Sommernachtstod‹ hat Anders de la Motte bewiesen, dass er einer der begabtesten Krimi-Autoren Schwedens ist!« Erik Axl Sund »Ein meisterhafter Kriminalroman [...]. Man kann ihn nicht weglegen, die Handlung ist beeindruckend, die Auflösung vollkommen überraschend.« Tara
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anders de la Motte
Sommernachtstod
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Marie-Sophie Kasten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Kind verschwindet, ein Dorf schweigt - ein fesselnder Kriminalroman von Schwedens peisgekröntem Autor Anders de la Motte.
Ein Schatten scheint über einem Dorf in Südschweden zu liegen, seit dort vor zwanzig Jahren der kleine Billy Lindh spurlos verschwand. Die Mutter des Jungen nahm sich daraufhin das Leben, ein Verdächtiger, dem aber nichts nachgewiesen werden konnte, tauchte unter und ließ Frau und Kinder im Stich.
Nun kehrt Billys Schwester, die Therapeutin Vera Lindh, in ihren Heimatort zurück: Ihr neuer Patient Isak hat ihr eine alarmierende Geschichte über einen verschwundenen Jungen erzählt, und Vera will endlich wissen, was damals wirklich geschehen ist. Längst nicht jedem im Dorf gefallen ihre hartnäckigen Fragen. Und wie vertrauenswürdig ist eigentlich Isak?
»Ein meisterhafter Kriminalroman […]. Man kann ihn nicht weglegen, die Handlung ist beeindruckend, die Auflösung vollkommen überraschend.« Tara
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Epilog
Für meinen Vater
Für alles, was du mir beizubringen versucht hast
I stood in the disenchanted field
Amid the stubble and the stones,
Amazed, while a small worm lisped to me
The song of my marrow-bones.
Blue poured into summer blue,
A hawk broke from his cloudless tower,
The roof of the silo blazed, and I knew
That part of my life was over.
Already the iron door of the north
Clangs open: birds, leaves, snows
Order their populations forth,
And a cruel wind blows.
Aus »End of summer« von Stanley Kunitz
Prolog
Sommer 1983
Das Kaninchen hockte im hohen Gras. Sein Fell war vom Tau, der sich soeben zur Dämmerung in den Garten gesellt hatte, feucht und glänzend.
Eigentlich sollte er reingehen. Mama mochte es nicht, wenn er allein draußen war, schon gar nicht, wenn es dunkel wurde. Aber schließlich war er schon groß, in ein paar Wochen wäre er fünf, und er liebte die Dämmerstunde. Bald würden die Nachttiere hervorkommen, Igel würden vorsichtig unter den großen Büschen hervorlugen und in kleinen, lustigen Schlangenlinien durch das Gras tapsen. Fledermäuse würden zwischen den hohen Bäumen umherflattern, und von der Kastanienallee auf der anderen Seite des Wohnhauses konnte er schon die ersten Eulen rufen hören.
Vor allem aber wollte er die Kaninchen sehen. Ein eigenes Kaninchen stand ganz oben auf seiner Wunschliste. Ein junges, weiches Kaninchen, genauso eines wie dasjenige, das dort drüben im Gras saß. Das kleine Tier sah ihn an, es rümpfte ein wenig die Nase, als ob es sich unsicher wäre, was seinen Geruch anging. Ob er gefährlich oder ungefährlich war. Er ging ein paar vorsichtige Schritte auf das Tier zu. Das Kaninchen blieb hocken, es wirkte unentschlossen.
Er wartete schon seit ein paar Monaten sehnsüchtig auf seinen Geburtstag. Von Mattias wünschte er sich einen Drachen. Er hatte gesehen, wie sein großer Bruder in Papas Werkstatt stundenlang an einem Drachen gebaut hatte. Wie er sorgfältig die Stäbe für das Gerüst abgemessen, Schnüre zwischen den Enden gespannt und alles mit einem glänzenden, dichten Stoff verkleidet hatte, geklaut aus einer der Schubladen oben auf dem Dachboden. Dort hingen Kleider, die einmal ihrer Großmutter gehört hatten und von denen sich die Mutter noch nicht hatte trennen können.
Er hatte diesen Sommer mehrmals zugeschaut, wenn Mattias und seine Freunde ihre selbstgebauten Drachen um die Wette fliegen ließen. Mattias’ Drachen flog jedes Mal am höchsten. Er schwebte ruhig über den Feldern wie ein Milan.
Das Kaninchen drüben im Gras sah ihn weiter an, und er ging noch ein paar Schritte vor. Als das Tier den Kopf hob, blieb er stehen. Eigentlich würde er am liebsten losrennen. Auf das Kaninchen zustürzen und sich daraufwerfen, es packen. Aber Onkel Harald sagte immer, dass ein guter Jäger nicht zu eifrig sein durfte, deshalb blieb er stehen, stand ganz ruhig da und dachte an seine Wunschliste.
Von seiner großen Schwester wünschte er sich ein rotes Auto, wie er es unten in der Stadt im Laden gesehen hatte. Das Auto hatte Flammen auf den Seiten, und wenn man es nach hinten zog und dann losließ, fuhr es ganz von selbst. Das Auto war bestimmt teuer, aber Vera würde es ihm trotzdem kaufen. Papa würde ihr das Geld dafür geben. Wenn sie darum bäte. Er wusste nicht genau, ob sie ihm die Sache mit den Habichteiern noch übel nahm, an die er am liebsten gar nicht denken wollte. Mattias hatte ihm verziehen, aber bei Vera wusste er nie so genau.
Das junge Kaninchen senkte den Kopf und begann an einem Grashalm zu mümmeln. Die Schnurrhaare bewegten sich dabei so niedlich, dass er kurz davor war, Onkel Haralds Regeln zu brechen. Aber er musste noch ein wenig ausharren. Den Augenblick abwarten, in dem das Kaninchen sich entspannte und nicht mehr zu ihm herübersah.
Von Mama und Papa wünschte er sich ein Fahrrad. Er hatte schon angefangen, auf Mattias’ altem Rad zu üben, obwohl er das eigentlich nicht allein durfte. Neulich war er gestürzt und hatte sich das Knie aufgeschlagen. Nicht schlimm, aber doch so, dass es geblutet hatte. Er hatte geweint und war in den Holzschuppen gekrochen, um sich zu verstecken. Onkel Harald hatte ihn gefunden und mit ihm geschimpft: »Was wird deine Mama sagen? Weißt du nicht, dass sie sich Sorgen macht?«
Doch, das wusste er. Mama machte sich fast dauernd Sorgen um ihn. »Weil du meine kleine Maus bist«, sagte sie dann. »Weil ich den Gedanken nicht ertrage, dass dir etwas passieren könnte.« Deshalb hatte er sich versteckt und nicht gewagt, ins Haus zu gehen. Nachdem er mit Schimpfen fertig war, hatte Onkel Harald ein Pflaster auf sein Knie geklebt und der Mutter gesagt, er sei auf dem Kiesweg zwischen Scheune und Wohnhaus hingefallen. Kein Wunder, wenn man in Holzpantoffeln herumrennt. Er hatte nicht seinetwegen gelogen, sondern wegen Mama. Damit sie sich keine Sorgen machte. Seitdem durfte er keine Holzpantoffeln mehr tragen wie Mattias und Vera. Er fand das ungerecht.
Plötzlich bewegte sich das kleine Kaninchen. Es machte ein paar Hopser in seine Richtung, auf der Jagd nach höherem Gras. Anstatt auf das Tier zuzulaufen, blieb er ganz still stehen. Er wartete ab, genau wie Onkel Harald es gesagt hatte.
Onkel Harald war der beste Jäger in der Gegend, das wussten alle. In seinem Heizkeller hingen fast immer tote Tiere von der Decke. Fasanen, Rehe, Hasen, mit leerem Blick und steifem Körper. Onkel Harald hatte grobe Hände. Er roch nach Tabak, Öl, Hund und noch etwas anderem, von dem er nicht wusste, was es war. Aber vermutlich etwas Gefährliches. Viele Leute hatten Angst vor Onkel Harald. Vera und Mattias fürchteten sich auf jeden Fall vor ihm, obwohl Vera sich nichts anmerken lassen wollte. Manchmal widersprach sie ihm, aber man hörte, dass ihre Stimme dabei ein bisschen zitterte. Mattias sagte dagegen nichts, sah nur zu Boden und tat, was vom ihm verlangt wurde. Holte Onkel Haralds Pfeife oder fütterte seine Hunde. Die Hunde waren keine, mit denen man spielen konnte. Sie lebten draußen in großen Zwingern und fuhren auf der Ladefläche mit anstatt im Auto. Raues Fell, wachsam, ängstlicher Blick, mit dem sie jede kleinste Bewegung Onkel Haralds verfolgten. Diese Woche war er mit Papa und Mattias im Schwimmbad gewesen. Hatte mit in der Sauna gesessen und dem Gerede der Erwachsenen zugehört. Als Onkel Harald kam, rutschten alle zur Seite, sogar Papa. Sie gaben ihm den besten Platz in der Mitte und sahen ihn genauso an wie die Hunde.
Die Einzige, die keine Angst vor Onkel Harald hatte, war Mama. Mama hatte vor niemandem Angst, außer vielleicht vor Gott. Manchmal stritten sie und Onkel Harald. Er hatte gehört, wie sie einander Dinge sagten. Schwierige Wörter, die er nicht richtig verstand, außer dass sie nicht nett waren.
Trotzdem hoffte er am allermeisten auf Onkel Haralds Geburtstagsgeschenk. Ein kleines Kaninchen, das nur ihm gehören sollte, hatte der Onkel ihm versprochen. Vielleicht genauso eins wie das, welches nur wenige Meter von ihm entfernt saß. Wenn er das fangen könnte, hätte er zwei. Und Onkel Harald wäre stolz auf ihn. Stolz darauf, dass er ein richtiger Jäger war.
Er hatte jetzt lange genug gewartet, also machte er vorsichtig einen großen Schritt. Das Kaninchen knabberte weiter an den hohen Grashalmen und merkte nicht, dass er näher kam. Er machte noch einen Schritt, streckte langsam die Hände aus. Es könnte klappen.
»Billy, Zeit zum Reinkommen!«
Das Kaninchen hob den Kopf und schien auf die Stimme zu horchen, die vom Wohnhaus kam. Dann drehte es sich um und sprang davon.
Er spürte, wie die Enttäuschung ihm die Brust zuschnürte. Aber dann blieb das Kaninchen stehen und sah sich zu ihm um, fast als wunderte es sich, wo er geblieben war. Er zögerte. Mama würde unruhig werden, wenn er nicht käme. Die Schreie der Eulen wurden jetzt lauter, die Außenbeleuchtung war angegangen, wodurch sich die Schatten drüben im Garten verdichteten. Das Kaninchen sah ihn immer noch an. »Kommst du?«, schien es zu fragen.
Er machte ein paar Schritte, dann noch einige.
»Billy«, rief Mama. »Billy, komm jetzt rein!«
Die Jagd war nun im vollen Gange. Das Kaninchen sprang vor ihm her, und wenn er richtig Glück hatte, würde es ihn zu seinem Bau führen. Einen Ort voller kleiner Kaninchen mit großen Augen und weichem Pelz. Kaninchen, die er mit nach Hause nehmen könnte. Die in dem Käfig wohnen könnten, den Onkel Harald ihm versprochen hatte.
»Billy!« Mamas Rufe verloren sich in der Ferne. Das Kaninchen hoppelte weiter vor ihm her, und obwohl er seine besten Laufschuhe anhatte, könnte es ihm bestimmt ohne Weiteres entkommen. Vielleicht wollte das Kaninchen, dass er es fing? Es in die Arme nahm, es zu seinem machte.
Er verfolgte es durch die Reihen knorriger alter Obstbäume. Dann weiter zwischen den wild wuchernden Sträuchern hindurch. Eigentlich mochte er diesen hinteren Teil des Gartens nicht. Diesen Sommer hatte sein Freund Isak auf dem Boden unter den dichten Zweigen einen Kiefer gefunden, einen weißen Knochen mit vier gelblichen Backenzähnen. Onkel Harald hatte erzählt, dass Opa dort Sachen vergraben hatte. Solche, die er für immer los sein wollte. Dass der Kieferknochen bestimmt von einem Schwein stamme und dass man manche Sachen richtig tief begraben müsse, wenn die Füchse sie nicht finden sollten.
Er hatte in seinem Leben erst einmal einen Fuchs gesehen. Nämlich als Onkel Harald, Papa und die anderen Männer im Herbst ihre Jagdbeute auf dem Hof ausgelegt hatten. Schmale Augen, glänzendes rotes Fell und spitze Zähne, die unter der blutbefleckten Schnauze hervorblitzten. Die Hunde hatten einen Bogen um ihn gemacht. Sie hatten unruhig, beinahe ängstlich gewirkt. Füchse muss man schießen, wann immer man die Chance hat, hatte Onkel Harald gesagt. Es war die Pflicht eines jeden Jägers, bei den wenigen Gelegenheiten, die sich boten. Denn Füchse waren listig, genau wie im Märchen. Sie wussten, wie man sich bewegt, ohne Spuren zu hinterlassen.
»Sie haben fantastische Nasen«, sagte er. »Und Füchse lieben den Geruch von Kaninchen und kleinen Jungs. Also, bleib innerhalb der Umzäunung, Billy!«
Dann hatte Onkel Harald gelacht, dieses dröhnende Lachen, das zwar herzlich, aber zugleich auch gefährlich klang, und nach einer Weile hatte Billy mitgelacht. Aber er hatte trotzdem an die Füchse denken müssen, die im Garten tief in der Erde nach Skeletten gruben. Manchmal hatte er sogar nachts von ihnen geträumt. Scharfe Zähne, Pfoten, die in der Erde scharrten, blanke, feuchte Schnauzen, die Witterung aufnahmen. Die in der Nähe des Wohnhauses einen kleinen Jungen witterten.
Seitdem hatte er diesen Teil des Gartens gemieden und kein bisschen protestiert, als Isak den Schweinekiefer mitnehmen wollte, obwohl er eigentlich ihm zugestanden hätte.
Aber jetzt gerade konnten ihn weder Skelette noch Füchse abhalten. Das Kaninchen umrundete die Stämme der trockenen Sträucher, und er verfolgte es immer weiter ins Dickicht hinein. Ein tief sitzender Ast verfing sich im Ärmel seines Pullovers und zwang ihn, ein paar Sekunden stehen zu bleiben. Als er sich befreit hatte, war das Kaninchen verschwunden.
Er zögerte einen Moment, überlegte, umzukehren und zum Haus zurückzulaufen. Aber er war noch immer im Jagdfieber. Das verlieh ihm den Mut weiterzugehen. Tiefer ins Gestrüpp hinein. Wie ein echter Jäger.
Noch mehr Äste reckten sich ihm entgegen, tasteten mit stacheligen Fingern nach seinen Kleidern. Irgendwo dort vorn im Dunkeln glaubte er einen kleinen weißen Schwanz zu sehen, der sich bewegte. Vielleicht war er jetzt beim Bau? Der Gedanke daran ließ ihn schneller werden, und er wäre beinahe in den hohen Zaun gerannt, an dem der Garten endete.
Er blieb abrupt stehen. Nur wenige Meter hinter dem Maschendrahtzaun wuchs dicht der Futtermais. Noch war es lange hin bis zur Ernte. Erst wenn er getrocknet und ganz gelb geworden war, hatte Papa gesagt.
Im Blattwerk zirpten die Grillen, verwoben ihre Melodien zu einem kreischenden Klangteppich, der fast seine Gedanken übertönte. Das Kaninchen befand sich auf der anderen Seite. Es saß genau vor der grünen Wand aus Maispflanzen und beobachtete ihn. Wartete auf ihn.
Der Zaun war hoch. Vielleicht sogar höher als Onkel Harald und in jedem Fall zu hoch für Billy, um hinüberzuklettern. Die Jagd war zu Ende. Er würde nie diesen Kaninchenbau sehen. Trotzdem fühlte er sich ein wenig erleichtert. Er war noch nie allein so weit in den Garten vorgedrungen. Von der Abendsonne sah man nur noch einen schwachen Streifen am Himmel, und die Schatten zwischen dem Gestrüpp hatten sich, wie er jetzt erst bemerkte, in eine kompakte Finsternis verwandelt.
Er beschloss nach Hause zu gehen und wollte sich gerade umdrehen, als er etwas entdeckte. Eine Furche unter dem Zaun, wo ein kleiner Junge ganz gut hindurchkriechen konnte. Er sah zu dem Kaninchen hinüber. Es saß noch an derselben Stelle.
Ein Windstoß fuhr durch das Maisfeld, blies dann durch die rostigen Maschen des Drahtzauns und in die dunklen Büsche hinter ihm. Er sah sich um, kniete sich hin und legte sich dann auf den Bauch. Er schob sich vorsichtig unter dem braunen Maschendraht hindurch, stand auf und wischte sich die Erde von Knien und Handflächen. Sein ganzer Körper kribbelte vor Aufregung. Er war jetzt draußen, außerhalb des Gartens, zum ersten Mal allein. Das würde er am Montag Isak erzählen. Vielleicht auch Mattias und Vera. Er würde erzählen, wie mutig er war, dass er ein eigenes Kaninchen gefangen hatte, aber dass sie nichts Mama sagen durften.
Es raschelte im Mais, und zuerst dachte er, es wäre wieder der Wind. Da sah er den weißen Schwanz zwischen den hohen Pflanzen verschwinden. Das Kaninchen hoppelte jetzt nicht mehr, es rannte ganz schnell. Die Ohren lagen eng zurückgelegt am Kopf, die Erde spritzte um die Pfoten auf. Erst als das Kaninchen außer Sichtweite war, begriff er, was passiert war: dass die empfindliche Nase des Kaninchens einen anderen Duft als seinen aufgefangen hatte. Von jemandem, der sich leicht unter dem Zaun hindurchgraben konnte. Jemandem mit rotem Fell und spitzen Zähnen, der den Kaninchengeruch liebte. Und den Geruch kleiner Jungen …
Sein Herz schlug wie wild, es raste wie das Herz eines erschreckten Kaninchens. Die Maispflanzen türmten sich vor ihm auf wie dunkle, wehende Riesen und drängten ihn zurück an den Zaun. Tränen stiegen in ihm auf. Aus den Augenwinkeln sah er eine Bewegung, etwas Rotes. Er drehte sich um und bemerkte im selben Moment, dass die Grillen verstummt waren.
Mama!, konnte er gerade noch denken. Mama …
Liebling
Hier beginnt unsere Geschichte. Deine und meine Erzählung. Ich habe versucht zu widerstehen, habe versucht, Dich von mir fernzuhalten und mich nicht fallen zu lassen, aber jetzt lasse ich los, Liebling, und vertraue darauf, dass Du mich auffängst. Tust Du das? Oder werden wir beide stürzen?
Das hoffe ich nicht. Ich will so gerne daran glauben, dass unsere Geschichte ein Happy End hat.
1
Sie ist ein Herbstmensch, das war sie schon immer. Oder fast immer. Früher einmal hat sie sich gewünscht, dass der Sommer niemals zu Ende gehen würde. Dass das Licht, die Wärme und der hohe, blaue Himmel für immer blieben. Aber das ist schon lange her. An einem anderen Ort, in einem anderen Leben.
Die Wanduhr zeigt an, dass es noch elf Minuten bis zum Beginn der Sitzung sind. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Ruud und sie haben zusammen Brötchen geschmiert und Kaffee in die Pumpkannen gefüllt. Sie haben die Stühle in einem ordentlichen Kreis auf dem grauen Teppichboden aufgestellt, zwölf abgewetzte Metallklappstühle – wahrscheinlich ein paar mehr als nötig, aber zugleich nicht so viele, dass es im Kreis leer aussieht –, und auf jeden Sitz eine Packung billiger Papiertaschentücher gelegt.
Als alles fertig war, hat Ruud die Flügeltür draußen im Foyer aufgeschlossen und zwei Teilnehmer hereingelassen, die früh dran waren und die den Geruch nach regennassem, warmem Asphalt mitbrachten. Von allen Stadtgerüchen mag sie diesen am liebsten. Vielleicht weil er etwas Reinigendes an sich hat. Einen Neuanfang. Und genau das soll dieser Tag sein.
Der erste Teilnehmer, den Ruud hereingelassen hat, ist ein Mann zwischen dreißig und vierzig, genau wie sie. Er hat tätowierte Arme, zerknitterte Kleider und einen Kopf, der im Vergleich zum Körper ein bisschen zu groß wirkt. Wahrscheinlich liegt das am Bart. Der ist wirr und ungepflegt, und außerdem hat der Mann matte, blutunterlaufene Augen, womit er heute nicht der Einzige sein wird.
Der andere Teilnehmer ist eine ältere, grauhaarige Frau, die fast so alt wie Ruud ist. Sie trägt ihr Haar in einem langen geflochtenen Zopf auf dem Rücken. Ihre Augen hinter den Brillengläsern schauen zwar freundlicher als die des tätowierten Bärtigen, aber ihre Blicke ähneln sich.
Ruud lotst sie behutsam zum Kaffeetisch, und sie will gerade zu ihnen gehen und sich vorstellen, als es sie überwältigt: das Gefühl, einen großen Fehler gemacht zu haben und dass das alles hier fürchterlich schiefgehen wird.
Verdammt!
Sie stürzt hinaus in die Küche und landet gerade noch rechtzeitig auf einem Stuhl, bevor ihre Beine nachgeben. Sie legt das Gesicht in die Hände, den Kopf zwischen die Knie, atmet tief durch.
Ein
Aus
Eiiin
Auuus
Das Gemurmel von Ruuds höflichem Small Talk sickert durch die Schwingtür. Es windet sich um ihr Hirn und vermischt sich mit dem rhythmischen Pochen ihrer Schläfen.
»Bist du mit dem Bus hergekommen?«, poch, poch, »Ah, mit der U-Bahn«, poch, poch, »Und du bist wie immer mit dem Auto gefahren, Lars? Hast du gleich einen Parkplatz gefunden? Ja, hier im Viertel muss man ein bisschen aufpassen, wo man seinen Wagen parkt, die verteilen hier fleißig Strafzettel.« Poch, poch, poch.
Jetzt hört sie noch andere Geräusche, neu eingetroffene Teilnehmer, die über den faserigen Teppichboden schlurfen, stehen bleiben, kurz zur Neonröhre hochblinzeln, bevor Ruud sie bemerkt und sie mit einem Lockruf in die Runde aufnimmt, dem nur wenige Menschen widerstehen können: »Hier gibt’s Kaffee und belegte Brötchen.«
Schleppende, zögerliche Schritte, das Klacken von Plastikbechern, die voneinander gelöst werden, gefolgt vom Zischen der Pumpkanne. Ihre Atmung beruhigt sich langsam, aber sie traut sich noch nicht aufzustehen. Sie schaut auf den Fliesenboden. Der Blick schweift über eine Fuge, die von Fett und Schmutz graubeige verfärbt ist. Alles hier drin ist ranzig, sogar die Luft. Der seit dreißig Jahren bestehende Essensdunst hinterlässt einen salzigen, klebrigen Geschmack im Rachen.
Der Geräuschpegel draußen steigt, er hallt durch den großen Raum. Bus, U-Bahn, Parkplatz? Bisschen Regen schadet nichts. Gut für die Wiesen. Sonst hatten wir doch einen fantastischen Sommer, findet ihr nicht? Fast wie am Mittelmeer. Habt ihr Pläne fürs Wochenende?
Sie ärgert sich. Bereut, dass sie nicht die Abfindung genommen hat, die man ihr angeboten hatte, und abgehauen ist. Jeder vernünftige Mensch hätte das gemacht. Hätte alles hinter sich gelassen und anderswo neu angefangen. Egal wo. In einer neuen Stadt, einer neuen Gegend, vielleicht sogar einem neuen Land?
Noch ist es nicht zu spät.
Der Hinterausgang liegt genau vor ihr. Sie hat den Schlüssel in der Tasche. Draußen vor der Tür sind eine Treppe und ein paar Mülltonnen, dann gelangt man zur Straße. Es würde nur ein paar Minuten dauern, sich hinauszuschleichen. Aber sie hat das Papier unterschrieben, sie hat ihnen beteuert, dass sie eine zweite Chance verdient. Und sie hat sich selbst davon überzeugt, dass es ihre letzte ist.
Das Gemurmel draußen im Saal wird immer lauter. Die Pumpkanne zischt. Das Geräusch nimmt zu, je weniger in der Kanne ist. Die Gespräche geraten ins Stocken.
Jaja. Man kann sich wirklich nicht über das Wetter beklagen, das stimmt …
Sie richtet sich auf, schielt zur Hintertür. Schließt die Augen. Mit den Fingern greift sie nach ihrem rechten Unterarm, die Nägel kratzen über den weißen Blusenstoff und schieben den Ärmel bis zum Ellenbogen hoch. In einer Minute könnte sie draußen auf dem regennassen Asphalt stehen. In Freiheit. Abhauen.
Da geht die Schwingtür auf. Es ist Ruud. Er hockt sich neben sie, berührt sie am Knie.
»Alles in Ordnung, Veronica?«
Seine große Hand ist warm und trägt deutliche Altersflecke. Wie alt ist er eigentlich? Vermutlich eher um die siebzig als um die sechzig. Er arbeitet seit zwanzig Jahren hier, er hat alles gesehen und gehört, was man so an Schicksalen sehen und hören kann. Warum macht er das? Es gibt umsonst Kaffee, hat sie ihn sagen hören, und das Lachen, das dann folgt, erspart ihm meist weitere Fragen. Ein guter Trick. Den sollte sie auch mal ausprobieren.
Sie schaut zu ihm auf, zwingt sich zu einem Lächeln. Dann krempelt sie die Hemdsärmel wieder bis zu den Handgelenken herunter. Ruud glaubt, dass sie Angst hat, und in gewisser Weise hat er recht. Sie hat Todesangst. Panik. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit.
»Jaja. Ich wollte mich nur ein bisschen sammeln. Die Routine noch mal durchgehen«, sagt sie und klopft sacht auf den Notizblock in ihrem Schoß.
»Gut.« Ruud streckt ihr die Hand entgegen, hilft ihr auf die Beine. »Wann hast du das letzte Mal gearbeitet? Vor drei Monaten?«
Obwohl sie schon seit einer Woche miteinander zu tun haben, tut er immer noch so, als würde er nicht jedes kleinste Detail der Abmachung kennen. Als ob er nicht derjenige wäre, der kontrollieren soll, dass sie sich daran hält.
Und wie immer spielt sie mit.
»Vor zwei Monaten, zwei Wochen und vier Tagen. Nicht, dass ich mitzähle.«
Ruud lacht. »Klingt auch gar nicht danach. Du wirst sehen, dass es hier keinen großen Unterschied zu deinem alten Arbeitsplatz gibt.«
Er führt sie in den Saal hinaus und löst den vorsichtigen Griff um ihren Ellenbogen, kurz bevor die Teilnehmer sich zu ihnen umdrehen.
Neun Leute, ein paar mehr, als sie an einem Freitagnachmittag erwartet hätte. Ausweichende Blicke, schiefes Lächeln, kurzes Nicken zur Begrüßung. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit hängt wie eine klebrige Schicht über dem Raum, breitet sich bis in die dunklen Ecken aus, in die das Licht der Neonröhren nicht mehr ganz vordringt, und verdrängt den Sauerstoff.
Sie zwingt sich noch einmal zu einem Lächeln, setzt sich auf einen Stuhl und schlägt den Notizblock auf. Das Herz klopft ihr bis zum Hals, sie verspürt ein leichtes Unwohlsein. Sie fühlt Ruuds Blick von seinem Platz an der Wand aus, aber sie schaut nicht zu ihm hinüber. Stattdessen versucht sie zu vergessen, warum er hier ist.
Sie holt tief Luft, spürt in sich hinein und fühlt sofort das Eis.
»Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Veronica Lindh, ich bin Gesprächstherapeutin mit Schwerpunkt Trauerbewältigung. Ich habe vier Jahre lang im Bürgerzentrum Nord gearbeitet, aber ab heute helfe ich hier in Söderort mit.«
Sie wundert sich, wie sicher ihre Stimme klingt. Irgendwie fremd, als ob Veronica Lindhs Stimme nicht ihre eigene wäre, was ja in gewisser Weise auch stimmt.
»Diese Selbsthilfegruppe ist für alle, die wie wir jemanden verloren haben, der uns nahestand, jemanden, den wir geliebt haben.«
Alle Blicke sind auf sie gerichtet. Ihr Herz klopft gegen das Eis direkt unter ihrem Brustbein. Sie stellt sich vor, dass es bei jedem Herzschlag ein bisschen nachgibt. Schlag für Schlag, bis sich ein Loch öffnet und man darunter einen Streifen schwarzen Wassers erahnen kann.
»Als ich vierzehn war, habe ich meine Mutter verloren. Eines Abends füllte sie die Taschen ihres Wintermantels mit Steinen und lief auf einen zugefrorenen See hinaus.«
Jetzt darf sie nicht zögern. Nicht aufstehen, nicht auf den Boden schauen. Sie atmet noch einmal tief ein. Langsam breitet sich die Kälte in ihrer Brust aus.
»Auf der anderen Seite des Sees stand ein Mann. Er hat gesagt, dass sie einfach geradeaus gelaufen ist, obwohl man das Eis deutlich knacken hörte. Als er nach ihr rief, hielt sie inne, blieb mitten auf dem Eis stehen und schaute ihn an. Dann war sie plötzlich weg.«
Sie schiebt den Gedanken an das Loch im Eis beiseite. Sie stellt sich vor, wie sich das Eis wieder schließt, über ihrer Mutter und über dem Riss in ihrer Brust. Wie es sich in einen harten Panzer verwandelt.
Sie räuspert sich, greift vorsichtig nach dem Notizblock. Niemand merkt, dass ihre Hände zittern, nicht einmal Ruud.
»Meine Mutter hat uns verlassen«, sagt sie. »Sie hat meinen Vater, meinen großen Bruder und mich verlassen, und wir waren gezwungen, damit klarzukommen. Es hat Jahre gedauert, bis ich nicht mehr wütend auf sie war. Bis ich nicht mehr dieselben Fragen gestellt habe, die ihr euch jetzt stellt.«
Sie schluckt ein paarmal und spürt, wie sich ihr Blut mit etwas deutlich Angenehmerem füllt als kaltem Seewasser. Sie hat es geschafft. Sie hat sich geopfert, und jetzt ist es Zeit für ihre ersehnte Belohnung. Sie zählt still bis zehn und wendet sich dann an die Teilnehmerin, die ihr am nächsten sitzt. Es ist die grauhaarige Frau mit dem Zopf.
»Bitte.«
Sie nickt der Frau zu, hört, wie sie Luft holt. Eine andere Geschichte, neu und doch wohlbekannt.
Tochter, Krebs, ist nicht einmal dreißig geworden.
Sie setzt ihre mitfühlende Miene auf, kritzelt Wörter auf ihren Block. Der Stift bewegt sich schnell, verwandelt Trauer in Tinte. Die Grauhaarige weint. Leise fließen die Tränen, während sich die Geschichte entfaltet, halten an der Unterkante der Brille kurz inne, bevor sie über die Wangen der Frau rollen. Immer mehr Worte.
Ungerecht, hatte noch das ganze Leben vor sich. Vermisse sie so.
Als die Grauhaarige fertig ist, nimmt sie die Brille ab und putzt sie mit einem dieser billigen Papiertaschentücher. Dann faltet sie es langsam zusammen und stopft es vorsichtig in ihre Handtasche, als ob die Tränen aus Glas wären und sie sie mit nach Hause nehmen wollte, um sie wie kleine Sorgenperlen in eine Vitrine zu legen.
Bei diesem Gedanken ist Veronica kurz unkonzentriert, und die nächste Person hat bereits angefangen zu sprechen. Lars, der Mann mit dem Bart. Viele Worte, harte Stimme. Sie beeilt sich mitzuschreiben, saugt auch seine Erzählung mit dem Stift auf.
Frau, Verkehrsunfall, betrunkener Autofahrer, Hirnschaden, schlechte medizinische Versorgung, nie wiederhergestellt.
Hier gibt es keine Tränen. Nur Wut. Verbitterung. Sie notiert es auf ihrem Block. Ihre Hand bewegt sich jetzt leichter über das Papier.
Hass, Rachegelüste, will Schaden zufügen. Auge um Auge … Sie sollen ihre Strafe bekommen, alle. Der Säufer, die Ärzte, alle!
Lars verstummt und holt tief Luft. Zuerst sieht er erleichtert aus, dann beschämt. Er murmelt etwas, was Veronica nicht versteht, und sieht auf seine Hände. Sie sind grob, schwielig, die Risse in der Haut sind so tief, dass sich Schmutz und Öl nicht mehr wegwaschen lassen. Papas Hände. Und die von Onkel Harald. Ihre eigenen Hände sind glatt und weich, mit langen Fingern, die am besten um einen Stift passen. Schreibende Hände. Mamas Hände. Sie schiebt den Gedanken beiseite und nickt dem nächsten Teilnehmer zu, mit seiner Geschichte zu beginnen.
Das Wort wird im Uhrzeigersinn weitergegeben. Gefolgt von Schluchzen, Tränen und dem Rascheln von Taschentüchern. Ihr Stift kritzelt über das Papier, immer schneller, genau wie der Pulsschlag, der die Belohnungshormone durch den Körper pumpt.
Tragödie, unsere Familie kommt nie darüber weg. Niemals.
Drüben an der Wand bewegt sich der Minutenzeiger mechanisch über die vergilbte Uhr. Alle fünf Minuten bleibt die Nadel ein paar Sekunden hängen, bevor sie mit einem lauten Klicken freikommt.
Als alle Geschichten erzählt sind, steht dieses eine Wort, das alle wiederholen, ganz unten in Großbuchstaben auf der letzten Seite. Die Frage, die im Raum hängt und die niemand von ihnen beantworten kann, egal wie oft sie ihre Geschichte erzählen.
Warum?
Veronica unterstreicht es und fährt die Buchstaben und das Fragezeichen immer wieder nach, bis der Stift durch das Papier drückt. Sie hört nicht auf, bis der Minutenzeiger der Wanduhr ein letztes Mal klickt und die Stunde vorbei ist.
Die Erleichterung ist riesig und vermischt sich mit den Endorphinen, die bereits ihr Hirn überschwemmt haben. Ihre linke Hand sucht wieder den rechten Unterarm, streicht ein wenig zerstreut über den Stoff der Bluse und die lange Narbe, die sich darunter verbirgt.
Ist es schon vorbei?, fragt sie sich. Und dann: Wann bekomme ich mehr?
2
Sommer 1983
Eigentlich war es ein guter Regen. Kein Gewitterregen, der die reife Saat niederdrückte, sondern ein sanfter, leiser Regen, der die Erde behutsam wässerte und bei Sonnenaufgang aufhören würde, sodass Ähren und Blätter bis zum Mittagessen trocknen könnten. Dreschregen nannten die Bauern in der Gegend so etwas. Ein guter Regen also, und in jeder anderen Sommernacht hätten Polizeichef Krister Månsson und die Männer um ihn herum auf dem Hof Backagård ihn begrüßt.
Er schob seine Uniformmütze zurück und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Obwohl er schon vor einiger Zeit seine Krawatte gelockert hatte, klebte ihm das Uniformhemd im Nacken.
Es war nicht seine erste Suche, redete er sich ein. Zumindest hatte er es schon einmal geübt, als er vor einigen Jahren eine Weiterbildung besucht hatte. Die Knackpunkte waren die Planung, die Organisation und die Leitung. Es ging darum, methodisch jede denkbare Alternative durchzukauen, bis man denjenigen fand, nach dem man suchte. Aber in Regen und Dunkelheit war das wesentlich leichter gesagt als getan.
Einige Männer hatten die Zündung ihrer Fahrzeuge eingeschaltet gelassen und die Autos auf dem Platz vor Nilssons Wohnhaus in einem Kreis um ihn herum geparkt. Die Scheinwerfer beleuchteten die wachsende Schar an Leuten, verwandelten sie in Schattenfiguren mit deutlich angestrahlten Beinen und Unterleibern und geisterhaften Gesichtern, deren Züge man kaum auseinanderhalten konnte. Das war allerdings auch nicht nötig. Alle erkannten einander. Alle kannten sich.
Månsson spürte ihre Blicke. Er zupfte ein wenig an seiner zerknitterten, etwas zu eng sitzenden Uniformjacke, die kurz davor war, vor dem Regen zu kapitulieren, schob die Mütze wieder an ihren Platz und hob die Hand.
»Hört mal her!«
Weder sein Rufen noch seine Handbewegung brachten das Stimmengewirr um ihn herum zum Schweigen. Er überlegte, ob er auf die Ladefläche des Pick-ups steigen sollte, der neben ihm stand, sah aber ein, dass die Metallkante zu hoch und zu rutschig und dass dies nicht der richtige Moment war, um seine Würde aufs Spiel zu setzen. Stattdessen versuchte er, lauter zu sprechen und autoritärer zu klingen.
»Alle mal herhören!« Das Ergebnis war nur minimal besser.
»Jetzt haltet doch mal die Klappe, verdammt. Månsson hat was zu sagen. Die Zeit läuft uns davon, während ihr rumsteht und Mist redet.«
Die scharfe Stimme kam von einem hoch aufgeschossenen Mann, der sich hinter Månsson mit Leichtigkeit auf die Ladefläche geschwungen hatte. Harald Aronsson, der Onkel des Jungen. Das Gerede verstummte sofort, und die Schar um Månsson und das Auto rückte zusammen.
Er räusperte sich, nickte Aronsson anerkennend zu, ohne eine Reaktion zu erhalten.
»Die meisten von euch haben schon gehört, was passiert ist, und ich kann verstehen, dass ihr endlich mit der Suche anfangen wollt«, begann er. »Aber damit wir alle den gleichen Informationsstand haben, gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen.«
Er machte eine kurze Pause, damit diejenigen, die zuletzt gekommen waren, nah genug herantreten konnten.
»Wir suchen also nach dem kleinen Billy Nilsson, fast fünf Jahre alt. Er wurde zuletzt kurz nach acht von seiner Mutter gesehen, was bedeutet, dass er jetzt circa …«
Månsson blickte auf seine Armbanduhr. Eine viereckige Digitaluhr, die Malin ihm zum zwanzigsten Hochzeitstag geschenkt hatte. Der einzige der vier hervorstehenden Metallknöpfe, mit dem er zurechtkam, brachte das kleine Ziffernblatt zum Leuchten, was ihm in der Dunkelheit sehr gelegen kam.
»… fünf Stunden weg ist. Die Familie hat im Garten gesucht, im Haus, in der Scheune und im Stall … also im Kuhstall«, präzisierte er schnell, »bevor sie gegen elf Uhr Alarm schlug. Kurz vor Mitternacht begann im Garten die Suche mit dem Polizeihund.«
Er wies mit der Hand auf das Wohnhaus am hinteren Ende des Vorplatzes, woraufhin zu seiner Zufriedenheit die meisten den Kopf in diese Richtung wandten.
»Der Hund hat Witterung aufgenommen bis zu einem Loch im Zaun, Richtung Maisfeld, ganz am hinteren Ende des Gartens. Danach hat er die Spur leider verloren, wahrscheinlich wegen des Regens oder weil Billys Eltern und Geschwister schon dort waren.«
Er ließ die Hand sinken und wartete, bis ihn wieder alle anschauten.
»Es sieht also so aus, als ob der Junge unter dem Zaun durchgekrochen wäre und sich zwischen den Maispflanzen verirrt hätte. Wie ihr alle wisst, steht der Mais mannshoch, es ist also leicht, sich dort draußen auf dem Feld zu verlaufen, noch dazu im Dunkeln. Hier brauchen wir daher eure Hilfe. Wir werden vier Suchtrupps bilden …«
Als Månsson seine Zusammenfassung beendet hatte, sah er erleichtert, dass alle auf dem Hof gehorsam seinen Instruktionen folgten. Sie teilten sich schnell in Gruppen auf und verließen den Hof teils zu Fuß, teils mit ihren Fahrzeugen, wobei jede Gruppe von einem seiner uniformierten Polizisten angeführt wurde.
Alle wollten so schnell wie möglich anfangen. Die meisten hatten eigene Kinder und konnten sich problemlos in die Hölle versetzen, durch die Familie Nilsson gerade gehen musste. Aber es hatte auch mit der kollektiven Erleichterung zu tun, die das gesamte Dorf verspüren würde, wenn man den kleinen Billy zu seiner Mutter zurückbrächte, durchnässt, frierend und ängstlich – aber unbeschadet. Denn so würde es natürlich kommen. Alle gingen davon aus, und manche genossen vielleicht sogar die Spannung, dachte Månsson. Sie freuten sich geradezu darauf, dass sie derjenige sein könnten, der den Jungen fand. Die Person, die Billy Nilsson entdeckte, müsste nie mehr die eigene Zeche zahlen, weder unten im Dorfkrug noch beim Volksfest, dafür würde Harald Aronsson schon sorgen.
Månsson war jetzt seit vier Jahren Polizeichef in Reftinge. Er war mit seiner Familie hierhergezogen, als er die Nachtschichten, die Besoffenen und die Psychos in Norrköping leid war. Als er genug davon hatte, in seiner Karriere dauernd von jüngeren und eifrigeren Polizisten überholt zu werden. In Reftinge, am Rande des schonischen Flachlands, war er das alles los. Hier war er der Chef von zwölf Polizisten und zwei zivil angestellten Damen, die das Telefon beantworteten, Anzeigen aufnahmen und Waffenscheine ausstellten.
Er war selbst in einem ähnlichen Dorf in Östergötland aufgewachsen und wusste, wie die Dinge auf dem Land liefen, was sicher einer der Gründe dafür war, dass er den Job bekommen hatte. Seiner Erfahrung nach arbeiteten die Leute auf dem Land hart und standen füreinander ein. Meistens hielten sie sich an die Zehn Gebote, was bedeutete, dass die Verbrechensstatistik von Reftinge hauptsächlich Einbrüche, Wilderei, Trunkenheit am Steuer und unerlaubtes Fahren umfasste. Was die beiden letzten Punkte anging, wusste er, dass seine Leute gerne ein Auge zudrückten. Es gab sozusagen eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den Anwohnern und der Ordnungsmacht, die lange vor seiner Zeit getroffen worden war. Draußen auf dem Land brauchte man einfach sein Auto. Ohne Fahrzeug gab es keinen Job, ohne Job kein Essen auf dem Tisch. Und er wollte nicht derjenige sein, der einer Familie ihre Einkünfte und ihr Essen wegnahm. Ein Zugereister zu sein war schwer genug, nicht nur für ihn, sondern auch für Malin und die Kinder. Es dauerte, bis man sich einlebte und akzeptiert wurde, noch dazu, wenn man einen anderen Dialekt sprach.
Er hatte wirklich sein Bestes getan. Er hatte sich daran gewöhnt, dass sein Name anders ausgesprochen wurde – Månnsenn statt Måånsson. Er trank nicht mehr Kaffee von Gevalia, sondern von der lokalen Rösterei Skånerost und sprach nicht mehr von Imbiss, sondern von der Brotzeit. Er hatte sich, seine Kinder und Malin im Fußballverein angemeldet und ging pünktlich jeden Donnerstagabend um sieben in die Sauna, um sich zu den Dorfbewohnern zu gesellen. Die Mühe hatte sich gelohnt. In der letzten Saison war Malin zur stellvertretenden Kassenwartin des Vereins ernannt worden und er selbst zum Trainer der U14-Jungenmannschaft. Zu Beginn des Frühlings hatte man ihm außerdem einen Begehungsschein in einem der größeren Jagdreviere angeboten. Er freute sich auf den Herbst. Sehnte sich geradezu danach.
Bis dahin würde sich die Stimmung vermutlich ein wenig aufheizen, besonders jetzt, gegen Ende der Erntesaison, wenn die Männer erschöpft und leicht reizbar waren. Schlägereien, Trunkenheit und Sachbeschädigung, schlimmstenfalls sogar die eine oder andere Körperverletzung. Mehr passierte normalerweise nicht. Tatsache war, dass es in seiner vierjährigen Amtszeit als Polizeichef bis heute Abend nie einen Fall gegeben hatte, der einen größeren Einsatz von ihm verlangt hätte, und das war ihm gerade recht. Er hielt sich lieber im Hintergrund. Trank gerne in Ruhe seinen Morgenkaffee und las dabei die Lokalzeitung, die Wochenzeitschrift Land und das Jagdmagazin. Ging zu Treffen mit dem Unternehmerverband, dem Roten Kreuz und der Gemeindeverwaltung. Zündete beim Elternabend einen Joint an, damit alle Eltern wussten, wie es roch, falls es einem unternehmungslustigen Jugendlichen gelingen sollte, von einer Dänemark-Tour Haschisch mitzubringen. Hielt den alljährlichen Fahrrad- und Verkehrssicherheitstag an den kommunalen Schulen ab. Das war die Art von Polizeiarbeit, die er bevorzugt machte. Das, was er gut konnte.
Dass inzwischen alle Blicke auf ihn gerichtet waren, wurde ihm in dem Moment bewusst, als die herbeigerufenen Heimwehr-Soldaten nach und nach den Hof füllten. Die Einsicht formte sich zu einem sauren Kloß in seinem Magen, der im Takt mit der wachsenden Zahl an Leuten um ihn herum größer wurde. Alle schauten ihn an, vertrauten darauf, dass er ihnen helfen würde, dem Albtraum der Familie Nilsson ein Ende zu bereiten.
Månsson richtete den Blick auf das große Wohnhaus, in dem jetzt jede einzelne Lampe zu brennen schien. In einem der Fenster entdeckte er zwei Umrisse, ein Mädchen und einen Jungen im gleichen Alter wie seine eignen Kinder. Er suchte in seiner Erinnerung nach den Namen von Billys großen Geschwistern. Dass ihr Vater Ebbe hieß, wusste er schon lange. Ebbe Nilsson war ein sanfter und ausgeglichener Mann, der nicht viel Aufhebens um seine Person machte, einer von denen, die in der Sauna schweigend auf einer der unteren Bänke saßen, während andere das Wort führten. Sein Schwager, Harald Aronsson, zum Beispiel.
Und die Mutter der Kinder, Magdalena Nilsson, geborene Aronsson, kannten natürlich alle. Die allererste Schönheitskönigin der Gegend, deren schwarz-weiße Krönungsfotografie immer noch im Foyer der Gemeindeverwaltung hing, obwohl das Bild inzwischen über zwanzig Jahre alt war. Das lag sicher ebenso an Magdalenas Schönheit wie an ihrem Nachnamen. Die Familie Aronsson hatte hier in der Gegend viel zu sagen, was die jetzige Situation nicht gerade einfacher machte.
Månsson suchte noch immer angestrengt nach den Namen der Kinder dort oben am Fenster, aber er kam einfach nicht darauf, wie sie hießen. Ohne richtig zu wissen, warum, hob er die Hand und winkte, aber keines der beiden Kinder machte Anstalten zurückzuwinken. Sie standen nur ganz still dort am Fenster und beobachteten ihn, warteten darauf, dass er ihren kleinen Bruder fand und alles wiedergutmachte.
3
Veronica hält sich im Grunde für einen guten Menschen. Sie trennt ihren Müll, bezahlt pünktlich ihre Rechnungen und spendet ab und zu einen Groschen für irgendeinen guten Zweck.
In die Kirche ist sie allerdings seit Jahren nicht mehr gegangen. Sie mag die Erinnerungen nicht, die Kirchen in ihr auslösen. Dieselben Erinnerungen, die dafür verantwortlich sind, dass sie ihren Vater nur etwa einmal im Monat anruft. Sie schiebt das Gespräch immer so lange auf, bis sich das schlechte Gewissen nicht mehr ignorieren lässt. Es vergehen immer mindestens acht Klingeltöne, bis er abhebt. Dann folgen ein Klicken, wenn er den Hörer abnimmt, und einige Sekunden Schweigen, in denen sie beide gegen jede Vernunft hoffen, eine andere Stimme am anderen Ende zu hören. Schließlich die Enttäuschung, wenn die Realität sie einholt, eine Enttäuschung, die keiner von ihnen richtig verbergen und die kein Small Talk der Welt überwinden kann.
Sie war seit Jahren nicht mehr zu Hause in Reftinge, weder zu Geburtstagen noch Taufen oder Beerdigungen, obwohl sie natürlich hätte hinfahren sollen. Sie weiß, dass es die Leute dort bemerken, dass sie darüber reden.
Das ärgert sie, und es ärgert sie auch, dass sie Reftinge immer noch als ihr Zuhause ansieht, obwohl sie vor über fünfzehn Jahren von dort weggezogen ist.
Ruud und sie stehen draußen auf der breiten Treppe des Bürgerhauses, einem grauen Sechzigerjahrekasten. Es hat aufgehört zu regnen, und die Wärme, die in Asphalt, Metall und Beton um sie herum angestaut war, hat dafür gesorgt, dass schon fast alles wieder trocken ist. Der frische Duft von vorhin ist verschwunden und einem Geruch nach abgestandenem Müll, Essen und Abgasen gewichen. Dem typischen Sommeratem der Stadt. Sie schließt für ein paar Sekunden die Augen, genießt das Gefühl von Zufriedenheit, das langsam abklingt.
»Danke für heute, und bis nächste Woche?« Die Verabschiedung der Grauhaarigen ist eine Feststellung, die zugleich nach einer Frage klingt. Als ob die Frau sich nicht ganz sicher sei, dass es zu weiteren Treffen kommt.
Veronica nickt, schüttelt der Frau die Hand. Sie ist zerbrechlich und knochig wie ein Küken.
»Bis nächste Woche.«
Die Grauhaarige geht die vier Stufen hinunter, dreht sich halb um und winkt unschlüssig. Dann presst sie die Handtasche mit den Sorgenperlen an die Brust und läuft weiter auf den Gehweg zu.
Sie stehen schweigend da und sehen der Frau nach, die Richtung U-Bahn geht.
»Wie lief es deiner Meinung nach?«, fragt Ruud, ohne den Blick abzuwenden.
Sie zuckt mit den Achseln. »Okay.« Die Antwort ist fast genauso wahr wie gelogen.
»Mhmmm.« Er angelt nach einer Dose Kautabak und schiebt sich eine Prise unter die Oberlippe, wo er sie mit der Zungenspitze zurechtdrückt. »Du hast nicht viele Fragen gestellt.«
Sie zuckt wieder mit den Achseln.
»Ich wollte den Rhythmus nicht unterbrechen.« Sie schielt zu ihm hinüber und bereut ihren schroffen Tonfall. Ein bisschen Selbstkritik wäre wohl angebracht. Immerhin ist sie diejenige, die beurteilt werden soll. »Aber ich schätze natürlich deine Meinung«, fügt sie hinzu.
Er zieht eine Grimasse, aber vielleicht rückt er auch nur den Tabak zurecht.
»Wenn du Fragen stellst, trauen sich die anderen auch, es zu tun«, sagt er. »Es ist wichtig, ein Gespräch in der Gruppe in Gang zu setzen, nicht nur Monologe. Alle sollen sich beteiligen. Das ist die Idee der Gruppentherapie.« Er wendet sich ihr zu und lächelt schief. »Wobei du das natürlich selbst weißt. Du bist nur ein bisschen eingerostet. Noch ein paar Gespräche, dann läuft wieder alles wie geschmiert.«
Sie nickt, wobei sie es vermeidet, ihn anzusehen, damit er nicht merkt, wie erleichtert sie ist. Die Grauhaarige ist nicht mehr zu sehen, sie ist irgendwo zwischen den Häusern verschwunden wie ein verschrecktes Mäuschen.
»Das mit deiner Mutter«, sagt er leise. »Ich wusste nicht, dass einer gesehen hat, wie sie …«
»Einer der Pfleger war draußen und hat nach ihr gesucht.« Veronica wundert sich darüber, wie fest ihre Stimme klingt. Dass sie es schafft, ihm zu antworten, und gleichzeitig zu verstehen gibt, dass sie keine weiteren Fragen möchte.
Ruud lässt sich aber nicht davon abhalten. »Eine furchtbare Geschichte …«
Es ist klar, dass er sie dazu bringen will, mehr zu erzählen, sich ihm anzuvertrauen, obwohl sie sich erst seit einer Woche kennen. Aber sie hat heute keine Lust mehr auf eine weitere Herausforderung, weder von Ruud noch von sonst jemandem. Stattdessen sieht sie weiterhin die Straße hinunter. Nach einer Weile versteht er den Wink, dreht sich um und spuckt zwischen den Zähnen hindurch auf den Boden.
Sie stehen eine Weile schweigend da, während die Schatten zwischen den Häusern länger werden. Von der Schnellstraße, einige Blocks weiter, hört man den Nachmittagsverkehr.
»Du schaffst das, Veronica«, sagt Ruud leise. »Was im Frühling passiert ist, war einfach ein vorübergehendes Problem, eine Hürde, über die du hinwegkommen musstest. Entspann dich und konzentriere dich auf die Arbeit, dann ist bald alles wieder ganz normal.«
Sie antwortet noch immer nicht. In gewisser Weise ist sie froh darüber, dass das Versteckspiel der letzten Woche ein Ende hat. Dass er endlich aufhört, so zu tun, als wisse er nicht, warum sie hierher versetzt wurde. Trotzdem will sie nicht mit ihm über die Sache reden. Sie hat die Geschichte in den letzten Monaten gedanklich schon hundertmal hin- und hergewendet.
Warum, meinst du, hast du so reagiert, wie du es getan hast, Veronica? Wie kannst du vermeiden, dass sich eine solche Situation wiederholt? Welches Gefühl verknüpfst du mit deinem Verhalten?
Ein Motorrad biegt genau vor ihnen in die Straße ein. Der Motor knattert dumpf. Der Fahrer trägt Jeans und eine braune Lederjacke. Der Helm ist mattschwarz, das dunkle Visier heruntergelassen. Das Fahrzeug gleitet langsam an ihnen vorüber, hat kaum Schritttempo. Gerade als er an ihnen vorbeifährt, dreht der Fahrer den Kopf und sieht sie an.
Sie ist kein Model, was immer man sich auch darunter vorstellen mag. Aber sie ist durchtrainiert, hat lange Beine und einen Zug um Mund und Augen, den sie von ihrer Mutter geerbt hat und der deutlicher hervortritt, wenn sie sich schminkt und das Haar offen trägt. Einen verletzlichen Zug, wie eine Andeutung, dass sie ein bisschen defekt ist. Erstaunlich viele Männer finden das attraktiv. Als sie jünger war, hat sie das ausgenutzt. Aber das ist lange her, war in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Jetzt verzieht sie ihren Mund nicht mehr und geht mit erhobenem Kopf. Sie spricht sanft, aber bestimmt und sieht den Leuten in die Augen. Trotzdem braucht es noch immer überraschend wenig, um einen Mann anzumachen. Eine Geste, eine Kopfbewegung, manchmal nur einen Blick.
Der Mann auf dem Motorrad schaut immer noch zu ihr herüber, er scheint ihr zuzunicken, als ob sie sich kennen würden. Ruud hat offenbar den gleichen Eindruck.
»Jemand, den du kennst?« Er versucht, ruhig zu klingen, aber sie hört Verstimmung heraus.
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf, um sowohl sich selbst als auch ihn zu überzeugen, aber aus irgendeinem Grund hat ihr Herz wieder angefangen, schneller zu schlagen.
Sie folgt dem Rücken des Mannes mit dem Blick, sieht ihn die Straße entlangfahren. Plötzlich gibt er Gas. Der Motorenlärm lässt sie zusammenzucken. Er hallt zwischen den Gebäuden wider und klingt wie das Gebrüll eines wilden Tieres.
Der Lärm lässt nach, während das Motorrad sich schnell entfernt.
»Vielleicht jemand, der sich erst noch Mut machen muss? Der sehen wollte, wie gefährlich du aussiehst, bevor er sich in die Gruppe traut.« Ruud stupst sie mit dem Ellenbogen an und grinst.
Sie gibt den Stups zurück, spürt, wie sich die Anspannung legt, und lächelt ihn dankbar an.
»Wenn du mir hilfst abzuschließen, fahre ich dich anschließend nach Hause«, sagt er. »Einverstanden?«
»Einverstanden.«
Er dreht sich um und geht auf die Tür zu. Sie bleibt noch ein paar Sekunden stehen, sieht in die Richtung, in die das Motorrad verschwunden ist. Das Motorengeräusch lässt sich immer noch wie ein entferntes Brummen erahnen.
4
Sommer 1983
Månsson hatte sein provisorisches Hauptquartier auf der erhöht liegenden Terrasse an der Rückseite des Hauses errichtet. Von dort aus konnte er das Wenige, das in der Dunkelheit vom Garten zu sehen war, überblicken und zwischendurch das gespenstische Rufen der Suchtrupps auf den umliegenden Feldern hören.
Bi-lly!
Biii-llyy!
Er hatte eine große Karte auf dem Gartentisch ausgebreitet und eine Sturmlampe bringen lassen, die er an der Markise über seinem Kopf aufgehängt hatte. Der Polizeifunk war auf den vereinbarten Sender eingestellt, und wenn die Suchmannschaften an den festgelegten Stationen vorbeikamen, markierte er sie auf der Karte. Wie erwartet machten es der hoch stehende Mais, die Dunkelheit und der Regen den zu Ketten formierten Suchenden schwer, sich zu orientieren, und die Polizisten, die die Suchtrupps dirigierten, mussten immer wieder stehen bleiben, um den Kurs zu ändern oder ein verlorenes Mitglied der Gruppe einzusammeln.
Hinter ihm ging vorsichtig die Terrassentür auf, und Ebbe Nilsson kam heraus. Er hielt ein Tablett mit einer Thermoskanne, ein paar Tassen und einer Platte mit belegten Broten in den Händen, das er auf die Ecke des Tisches stellte, die nicht von der Karte bedeckt war.
»Ich dachte, du könntest vielleicht etwas Wärmendes vertragen.«
Månsson nahm dankbar eine Kaffeetasse entgegen und bekam einen Moment lang ein schlechtes Gewissen. Ebbe Nilssons kleiner Junge war verschwunden, die ganze Familie stand unter Schock, trotzdem hatte sich dieser Mann die Zeit genommen, für ihn Kaffee zu kochen. Und sogar für etwas zu essen gesorgt. Er beobachtete Nilsson verstohlen, während er in eines der Wurstbrote biss.
Der Blick des Mannes war ausdruckslos, das Gesicht weiß und zerfurcht. Die Schatten und das blasse Licht der Sturmlampe verstärkten den vergrämten Eindruck. Aber er hielt sich aufrecht und wirkte einigermaßen gefasst.
»Wie läuft es?«, fragte er.
Månsson machte eine Handbewegung Richtung Garten und Maisfeld. »Wir arbeiten dran. Die Dunkelheit und der Regen machen uns zu schaffen, aber wir finden ihn bestimmt, du wirst sehen.« Der letzte Satz platzte aus ihm heraus, bevor er ihn zurückhalten konnte. Natürlich wusste er es besser. Er war lange genug Polizist, um zu wissen, dass man nichts versprechen durfte, was man nicht in der Hand hatte. Dennoch hatte er es beinahe getan. Aus Mitleid, redete er sich selbst ein, aber er hatte den Verdacht, dass das nicht die ganze Wahrheit war.
Das Funkgerät knackte, er drehte sich danach um. Keine Nachricht, nur ein kurzes statisches Rauschen, das gleich wieder aufhörte. Månsson schluckte den letzten Bissen Brot hinunter.
»Wie geht es Magdalena?« Er nickte leicht Richtung Obergeschoss.
»Sie schläft«, sagte Nilsson schroff. Offenbar bemerkte er es selbst, denn er änderte sofort den Tonfall. »Sie war so aufgeregt, dass sie ein Beruhigungsmittel genommen hat. Und weil sie so durcheinander war, hat sie aus Versehen die doppelte Dosis genommen, deshalb schläft sie jetzt tief und fest. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie von alldem eine Weile nichts mitbekommt. Billy ist ihr Ein und …« Nilssons Stimme brach, und der Rest des Satzes ging im Geräusch des Regens unter, der auf die Markise trommelte.
»Und die anderen Kinder?«, fragte Månsson und machte sich im selben Moment klar, dass die Frage mehrdeutig war. Aber Nilsson wählte die richtige Deutung.
»Mattias und Vera sind ins Bett gegangen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie schlafen. Wenn sie nicht wären, wäre ich auch da draußen.« Er zeigte auf das Maisfeld, wo immer wieder das Licht einer Taschenlampe aufleuchtete.
Einer der Suchtrupps musste zum Hof zurückgekommen sein. Månsson sah auf der Karte nach und seufzte, als er feststellte, dass die Mannschaft B dabei war, ein Gebiet entlang des Gartenzauns zu durchkämmen, wo man heute Nacht schon einmal gesucht hatte. Er griff nach dem Funkgerät, aber blieb mit dem Apparat in der Hand stehen. Nilsson stand mit hängenden Schultern da, sein Blick wanderte über den Boden, und sein Mund stand halb offen, als wollte er etwas sagen. Aber es kam kein Laut. Der Mann sah auf einmal vollkommen niedergeschlagen aus, als würde er jeden Moment zusammenbrechen.
Månsson räusperte sich. Er überlegte, was er sagen könnte.
»Du wirst vor allem hier gebraucht, Ebbe«, sagte er. Und nach kurzem Zögern klopfte er dem Mann etwas unbeholfen auf die Schulter.
»Jeder von uns kann suchen, aber du musst dich um Magdalena und die Kinder kümmern. Außerdem muss ja jemand hier sein, wenn wir Billy finden.«
Schon wieder hatte er mehr versprochen, als er sollte, aber seine Worte und Gesten schienen zumindest eine gewisse Wirkung zu haben. Ebbe Nilsson schloss den Mund und nickte langsam.
Das Funkgerät raschelte wieder.
»Månsson, bist du da?«
»Ich höre«, erwiderte er.
»Hier Berglund, Mannschaft B. Der Hundeführer hat draußen auf dem Feld etwas gefunden, vom Loch im Zaun aus ungefähr zwanzig Meter geradeaus.«
»Was denn?« Månsson hielt die Luft an. Er sah zu Ebbe Nilsson. Der Mann richtete sich auf und schien wieder etwas zu Kräften zu kommen.
Das Funkgerät knackte ein paarmal und zerriss Berglunds Stimme.
»…uh«, war das Einzige, was man hören konnte.
»Bitte wiederholen!«, sagte Månsson, beugte sich über die Karte und versuchte herauszufinden, wo sich die genannte Stelle befand. »Was habt ihr gefunden, Berglund?«
Das Gerät knackte wieder.
»Einen kleinen blau-weißen Schuh.«
5
Ruud bringt seinen Volvo vor ihrem Haus zum Stehen. Der Geruch des gelben Duftbaums, der unter dem Rückspiegel hängt, ist so stark, dass es in der Nase brennt. Ruud löst den Sicherheitsgurt, und einen Moment lang glaubt sie, er habe vor, sich auf eine Tasse Kaffee zu ihr einzuladen.
Sie will gerade eine schlechte Ausrede hervorstammeln, da kramt er in seiner Hosentasche herum und fischt etwas mühsam seine Tabakdose heraus, bevor er sich wieder anschnallt.
»Wir sehen uns am Montag«, sagt er. »Arbeitsfrühstück um neun Uhr.«
»In Ordnung.«
Noch bevor er sich eine Prise Tabak in den Mund geschoben hat, ist sie ausgestiegen. Sie bleibt mit der Hand an der Wagentür stehen.
»Danke.«
»Kein Problem. Das war kein großer Umweg.«
Sie will noch etwas hinzufügen, da zwinkert er ihr aufmunternd zu.
»Nächste Woche wird es leichter, Veronica. Das verspreche ich dir.«
Ihre Wohnung könnte jedem gehören. Vierzig Quadratmeter, eingerichtet mit einer Mischung aus Flohmarktfundstücken und Ikea-Möbeln. Küche und Wohnzimmer auf der rechten Seite, Schlafzimmer links. Praktisch, sauber und zweckmäßig. Keine Familienfotos, Bilder oder Gemälde. Auch keine Duftkerzen, Buddhas, getrockneten Blumen oder Kühlschrankmagnete mit Sinnsprüchen wie »Carpe diem« oder »Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens«.
Erstaunlich unpersönlich hatte ein am Hals tätowierter Blödmann, den sie vor langer Zeit einmal gedatet hatte, lange vor Leon, die Wohnung genannt. Er war ein Ihr-müsst-mich-nehmen-wie-ich-bin-Typ. Die Art von Mensch, die sich für authentischer als alle anderen hält, bloß weil ihr etwas so Simples wie Manieren fehlt. Außerdem fickte der Tätowierte ungefähr so, wie man es erwartete. Egozentriert und talentfrei, worauf sie ihn aufmerksam machte, als sie sich von ihm trennte.
Er vertrug ihre Kritik nicht sehr gut. Ihr klappriger alter Wagen hat an der Fahrertür lange Kratzspuren von seinem Schlüssel, aber inzwischen sind sie durch den vielen Rost beinahe mit dem Lack verschmolzen. Sie sind nur noch eine diffuse Erinnerung an einen alten Fehlgriff.
Die Luft in der Wohnung ist warm und stickig. Sie knöpft ihre Bluse am Hals auf, öffnet ein Wohnzimmerfenster und lehnt sich ein Stück hinaus. Durch die Blätter des Baums vor ihrem Haus sieht sie Ruuds Volvo langsam davonfahren.
Draußen ist es nur ein paar Grad kühler als im Zimmer, und die Luft steht genauso still. Sie öffnet auch noch das andere Fenster und dann das schmale Fenster, das vom Schlafzimmer auf den Garten hinausgeht, in dem vergeblichen Versuch, einen Durchzug zu schaffen.
Die Kühlschranklampe flackert beunruhigend. Wahrscheinlich gibt sie so langsam ihren Geist auf, noch ein Punkt auf ihrer To-do-Liste. Im Kühlschrank befinden sich eine halbe Flasche Mineralwasser, ein paar Tüten Soja und ein altes Fertiggericht mit unbekanntem Verfallsdatum. Sie steht einen Moment lang vor der geöffneten Kühlschranktür und genießt die Kühle, bevor sie die Flasche herausholt. Das Mineralwasser ist abgestanden und schmeckt etwas salzig.
Ein vorübergehendes Problem.
Ruud meint es gut. Sowohl er als auch die Personalabteilung glauben genau zu wissen, wer sie ist und was gut für sie ist. In Wirklichkeit haben sie keine Ahnung.
Warum lässt sie sich dann ihre Bevormundung gefallen? Warum akzeptiert sie alle Bedingungen der Vereinbarung, die die Gewerkschaft für sie ausgehandelt hat, anstatt einfach zu gehen?
Gute Frage, zumal heute Abend, aber die Antwort ist und bleibt dieselbe. Weil sie sich entschlossen hat, nicht mehr zu fliehen, sobald etwas schwierig wird. Das klingt gut, reif und verantwortungsbewusst. Aber der Hauptgrund, warum sie bleibt und auf alle ihre Forderungen eingeht, ist wesentlich weniger edel.
Sie schielt zum Telefon, das auf der Küchenanrichte steht. Das Lämpchen leuchtet beharrlich rot. Keine neue Nachricht. Sie hat nichts anderes erwartet, trotzdem macht sie dieses weit geöffnete rote Auge irgendwie niedergeschlagen. Der Kick der Gesprächstherapie ist jetzt weg, sie fühlt sich schwer und traurig. Einen Moment lang spielt sie mit dem Gedanken, den Hörer abzuheben. Die verbotene Nummer zu wählen, nur um Leons Stimme zu hören. Natürlich macht sie es nicht. Sie ist kein Idiot und wird wütend auf sich selbst, wenn sie daran denkt, dass sie sich trotz dieser Einsicht nicht mehr traut, ein Handy zu besitzen, weil sich SMS fast von allein schreiben und verschicken.
Sie geht ins Bad. Ihre Kleider türmen sich zu einem Haufen auf dem Boden: die langärmlige weiße Bluse, die sie wie eine Nonne aussehen lässt, die schwarze Hose, die Baumwollunterhosen, die sie bei H&M im Fünferpack kauft. Billige, einfache Sachen, ungefähr genauso unpersönlich wie ihre Wohnung.
Das Wasser ist lauwarm, sogar wenn man es ganz kalt stellt. Sie lässt es über ihren Körper rinnen, über die zackige rote Narbe, die fast ihren gesamten rechten Unterarm entlangläuft. In ein paar Jahren wird auch die verblichen sein, verschmolzen, genau wie die Kratzer an ihrer Autotür. Sich zu einer diffusen Erinnerung an einen alten Fehlgriff verwandelt haben.
Hinterher fühlt sie sich besser, so als ob das Wasser die düsteren Gedanken weggespült hätte. Sie wickelt sich in den weißen Frotteebademantel, den sie und Leon aus dem kleinen, gemütlichen Hotel in Trosa haben mitgehen lassen, als er ihr zum ersten Mal sagte, dass er sie liebte, nimmt ihre Zigaretten und einen Aschenbecher und setzt sich an das geöffnete Fenster, das auf die Straße hinausgeht. Eigentlich hat sie aufgehört zu rauchen. Das ist Teil ihres selbst erdachten Behandlungsplans. Keine Rauschmittel, weder Tabak noch Alkohol. Vor allem Letzteres nicht.
Auf der Straße sind inzwischen die Laternen eingeschaltet. Man kann Insekten erkennen, die darum herumschwärmen. Einen Augenblick lang erinnert sie sich an die Nachtfalter, die zu Hause manchmal durch die Terrassentür hereinflogen und mit raschelnden Flügeln Runde um Runde um die Küchenlampe tanzten. Dann denkt sie an den unruhigen Gesichtsausdruck der Mutter, den dieser Tanz hervorrief.
Die Erinnerung überrascht sie, sie zündet sich eine Zigarette an und bläst den Rauch in die Sommernacht. Sie versucht, an etwas anderes zu denken. Damit die Gedanken sie nicht aufs Eis führen.