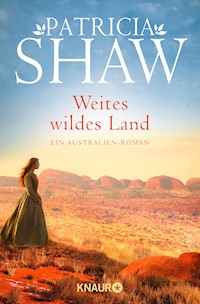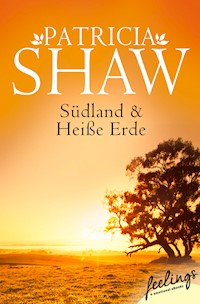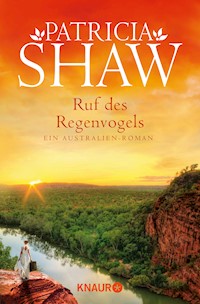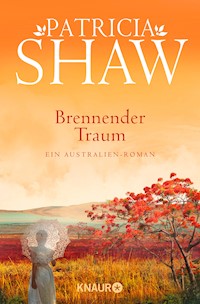9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Buchanan-Saga
- Sprache: Deutsch
Spannend, dramatisch und emotional: Der Australien-Roman "Sonnenfeuer" ist der Auftakt der großen Buchanan-Saga von Bestseller-Autorin Patricia Shaw um eine junge Aborigine auf der Suche nach ihren Wurzeln, zwei verfeindete Brüder und das wilde Australien in Zeiten des Goldrausches. Australien um 1850: Zwei mutige Frauen begeben sich auf die Suche nach ihrem Platz im Leben: Perfy Middleton, die Tochter englischer Sträflinge, will durch die Ehe mit dem reichen Farmer Darcy Buchanan einem Dasein als Dienstmädchen entgehen. Doch als Darcy noch vor der Hochzeit ums Leben kommt, ist Perfy auf der Farm nicht mehr gut gelitten. Perfys Freundin und Begleiterin, die Aborigine Diamond, die als Kind von Seeleuten vor der Küste Australiens verschleppt worden war, hofft derweil noch immer, eines Tages ihre Familie wiederzufinden. Für beide Frauen beginnt der Weg durch ein wildes, geheimnisvolles Land, das mit Gold lockt und auf viele Arten tötet. Der fesselnde erste Band von Bestseller-Autorin Patricia Shaws Buchanan-Saga über Familie, Liebe und Intrigen vor der grandiosen Kulisse Australiens. Entdecken Sie auch den zweiten Band der Buchanan-Saga: "Der Traum der Schlange". »Patricia Shaw versteht es, auf faszinierende Weise das Land und das Leben der Einwanderer auf der Südhalbkugel darzustellen.« Elbe-Elster Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Patricia Shaw
Sonnenfeuer
Ein Australien-Roman
Aus dem Englischen von Heide Horn, Barbara Steckhan und Robert Weiß
Knaur e-books
Über dieses Buch
Zwei mutige Frauen auf der Suche nach ihrem Platz im Leben: Perfy Middleton, die Tochter englischer Sträflinge, will durch die Ehe mit dem reichen Farmer Darcy Buchanan einem Dasein als Dienstmädchen entgehen. Doch als Darcy noch vor der Hochzeit ums Leben kommt, ist Perfy auf der Farm nicht mehr gut gelitten.
Perfys Freundin und Begleiterin, die Aborigine Diamond, die als Kind von Seeleuten vor der Küste Australiens verschleppt worden war, hofft derweil noch immer, eines Tages ihre Familie wiederzufinden.
Für beide Frauen beginnt der Weg durch ein wildes, geheimnisvolles Land, das mit Gold lockt und auf viele Arten tötet.
Inhaltsübersicht
Prolog
Der große Fluss brauste und glitzerte im Sonnenlicht. Über gewaltige Granitfelsen stürzte er von den geheimnisvollen Höhen des Irukandji-Territoriums und ergoss sich in die ausgedörrten Weiten des Landesinneren. Dort floss er gen Westen durch das Gebiet des grausamen Stammes der Merkin.
Die Eingeborenen waren stolz auf diesen Fluss. Sie nannten ihn den Goldenen Fluss, denn wenn er nach den Wolkenbrüchen im Sommer wieder ruhig dahinfloss, war er wunderschön anzusehen: Überall entlang des Flussbettes und auf dem Grund der Gesteinsbecken, der tiefen Schluchten, der Felsspalten und der ausgetrockneten Flussläufe und Wasserlöcher in der Ebene funkelten die gelben Kiesel im Sonnenlicht. Sie glitzerten und schimmerten, als habe jemand ein Schmuckstück ins Wasser geworfen, lagen verstreut an den sandigen Ufern und blinkten aus der kristallklaren Tiefe empor. Hoch droben in ihrer felsenbewehrten Festung, im Quellgebiet des Flusses, konnten die Sippen der Irukandji das sich gen Westen endlos dehnende Land überblicken. Doch der Westen bedeutete ihnen nichts. Sie wandten sich lieber nach Osten zur Morgensonne und bewunderten das tiefe Blau des Ozeans und die Wellen, die sich weit draußen am Korallenriff brachen. Die Bergbäche speisten einen zweiten Fluss, der sich direkt ins Meer ergoss. Man nannte ihn den Grünen Fluss, da ihm das Dickicht, das seine Ufer säumte, eine grünliche Färbung verlieh, bevor er in die geschützte Bucht mündete. Die Irukandji wussten nicht, dass ein weißer Seefahrer bereits ein Jahrhundert vor der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, die Bucht nach seinem Schiff benannt hatte: Endeavour. Die Irukandji stiegen neben den Wasserfällen herab, um im flachen Wasser des Meeres zu fischen, denn dort war es weniger gefährlich als am Grünen Fluss, in dem es von Krokodilen wimmelte. Damals mussten die Irukandji niemanden fürchten außer den Krokodilen. Seit vielen Jahrhunderten waren sie für ihre Grausamkeit bekannt, und niemand wagte es, ohne Erlaubnis in ihr Gebiet einzudringen.
Doch nun drohte Gefahr. Von Zeit zu Zeit hatten sie seltsame Wesen von großen Schiffen aus an Land kommen sehen, die Wasser von ihren Quellen schöpften. Bis jetzt hatten sie diese Wesen nur heimlich beobachtet und ungehindert ziehen lassen, so sicher waren sie sich, ihr Stammesgebiet, wenn nötig, verteidigen zu können. Jedoch hatten Boten und Händler von anderen mächtigen Stämmen die beunruhigende Nachricht überbracht, dass diese Fremden durch Stammesgebiete nach Süden vordrangen und, obwohl sie nicht wie Krieger aussahen, böse und gefährlich waren.
Häuptling Tajatella beriet sich mit den Ältesten, und dem Volk der Irukandji wurde verkündet, dass die stolzen Bergstämme diese Bedrohung nicht hinnehmen würden.
»Unsere Geduld ist am Ende!« rief Tajatella aus, und seine Krieger stampften zum Zeichen ihrer Zustimmung mit den Füßen, während ihr Kriegsgesang über die Hügel hallte. »Tötet die bösen Wesen! Treibt sie zurück ins Meer!«
Teil 1
1
Als der Schoner White Rose gemächlich südwärts durch die Whitsunday Passage glitt, konnte Kapitän Otto Beckmann den Rauch der Eingeborenenfeuer über den Hügeln sehen, doch er machte sich keine weiteren Gedanken darüber. Für die Schiffe stellten die Aborigines, die überall an der Küste von Queensland lebten, keine Bedrohung dar.
Der deutsche Seemann wunderte sich, warum sich die Engländer ausgerechnet in solch einer Wildnis wie Somerset niedergelassen hatten; an der Spitze von Cape York und umgeben von undurchdringlichem Dschungel, wo es von Horden schwarzer Wilder wimmelte. Handelskähne und andere vorbeifahrende Schiffe stellten die einzige Verbindung zwischen den Siedlern und der Außenwelt dar – Schiffe wie die White Rose.
Beim bloßen Gedanken an die Eingeborenen schauderte er und bekreuzigte sich. Im Meer zu ertrinken war ein sauberer Tod, aber bei der Vorstellung, von blutrünstigen Wilden in Stücke gehackt zu werden, lief es ihm kalt den Rücken hinunter! Bei Gott! Diese Leute mussten verrückt sein dortzubleiben. Allerdings schien sich John Jardine, der frühere Friedensrichter von Rockhampton und jetzige Vertreter der Krone in Somerset, an alledem nicht weiter zu stören.
Er hatte sich in den Kopf gesetzt, seine Siedlung in ein zweites Singapur zu verwandeln. Unterstützt von einigen mürrischen Marinesoldaten, einem Militärarzt und einem Häuflein unerschrockener Siedler, baute er gerade eine Stadt auf. Er hatte bereits eine Kaserne, ein Krankenhaus und einen herrlichen Amtssitz errichten lassen, von dem aus man eine liebliche Meerenge überblicken konnte, die als Albany Pass bekannt war. Im Augenblick markierte er Straßen auf dem gerodeten Gebiet und überwachte die Landzuteilung an seine künftigen Bürger.
»Sie sollten ein Stück Land kaufen, Beckmann«, hatte Jardine gesagt. »Ein hervorragendes Stück Land mit einer hübschen Aussicht würde Sie nur zwanzig Pfund kosten. Das ist doch fast geschenkt!«
Fast geschenkt? Beckmann glaubte trotz der Zuversicht dieses zähen und findigen Mannes nicht daran, dass diese winzige Siedlung überleben würde, aber er konnte es sich nicht leisten, Jardine vor den Kopf zu stoßen. Somerset war ein günstig gelegener Hafen. Die Handelsschifffahrt zwischen Batavia und Brisbane warf zwar viel Geld ab, war aber gefährlich, vor allem in der Gegend der Meerenge von Torres. Mordende asiatische Piraten lauerten den Schiffen auf, die zwischen den Riffen nur langsam vorwärtskamen, und die schiffbrüchigen Seeleute auf einsamen Inseln waren den wilden Schwarzen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, wenn sie nicht auf den glühend heißen Korallenatollen verdursteten. Jardine hatte schon vielen Seeleuten das Leben gerettet, indem er mit seinem eigenen Schiff in See gestochen war, um mit seinen Soldaten die Angreifer zurückzuschlagen. Er war wirklich ein außergewöhnlicher Zeitgenosse. Das Wichtigste war jedoch, dass es in Somerset frisches, sauberes Wasser gab.
»Vielen Dank, Sir, es ist in der Tat fast geschenkt«, hatte Beckmann erwidert, »aber ich besitze ein Haus in Brisbane.«
»Es drängt nicht. Sie haben ja genug Zeit, darüber nachzudenken. Übrigens habe ich gehört, dass Ihre Frau dieses Mal auch an Bord der White Rose ist. Sie müssen sie heute zum Abendessen mit zu uns an Land bringen.«
»Leider ist das nicht möglich. Mrs. Beckmann ist in Batavia erkrankt.«
»Batavia? Ein schmutziges Nest. Möchten Sie, dass unser Arzt nach ihr sieht?«
»Nein, vielen Dank. Sie ist bereits über den Berg, fühlt sich allerdings immer noch nicht ganz wohl und möchte das Schiff nicht verlassen.«
Jardine sah ihn eine Zeit lang verständnislos an und grinste schließlich. »Ich verstehe. Durchfall, nicht wahr? Sehr peinlich für eine Dame. Ist für jeden von uns peinlich. Mehl und Wasser, ein Geheimrezept. Das stopft. Aber dieses verdammte Wasser aus Batavia sollten Sie ins Meer kippen. Tierkadaver in den Brunnen sind dort nichts Ungewöhnliches. Sie sollten trotzdem zum Abendessen kommen, Käpt’n. Sie können in meinem Haus übernachten. Wir bekommen nicht oft Besuch, also lassen Sie uns feiern.«
Feiern! Beckmann hatte jetzt noch Kopfschmerzen, wenn er an Jardines Gelage in der letzten Woche dachte. Gussie war enttäuscht gewesen, hatte aber nicht gewagt, an Land zu gehen. Arme Gussie, diese Seereise war schrecklich für sie. Da ihr Ehemann so viel Zeit auf See verbrachte, war es ihr in Brisbane zu einsam geworden. Sie war gutmütig und eine ausgezeichnete Hausfrau, der es allerdings nicht leichtfiel, Freundschaften zu schließen. Die ungehobelten Nachbarn, unter ihnen viele entlassene Sträflinge, jagten ihr Angst ein. Außerdem vermisste sie ihren Sohn. Frederick hatte vorgehabt, mit ihnen nach Australien auszuwandern, aber seine Frau hatte in letzter Minute ihre Meinung geändert. Gussie vermisste ihre Familie und ihr Leben in Hamburg, das in geruhsamen Bahnen verlaufen war. Sie war so teilnahmslos und verzagt geworden, dass Otto ihr schließlich erlaubt hatte, ihn auf dieser Reise zu begleiten. Zwar hatte er zu bedenken gegeben, dass sie leicht seekrank wurde, aber in ihrer Freude hatte sie alle Einwände in den Wind geschlagen.
Nun litt sie schon seit Beginn der Fahrt an Seekrankheit, und als sie in Batavia an Land gingen, machte ihr das feuchtheiße Klima zu schaffen; ihre Nase rebellierte gegen den Gestank der Abfälle im Hafenbecken, der sich mit dem widerwärtig süßlichen Duft exotischer Pflanzen vermischte, und schließlich war sie von einer Tropenkrankheit befallen worden, die sie so geschwächt hatte, dass sie zurück an Bord getragen werden musste. Beckmann seufzte. Und dann die Abendeinladung bei diesem Engländer! Nach Jardines Geschichten über zahllose Überfälle der Aborigines auf die Siedlung – Yardigans und Goomokodeens, wie er ohne erkennbare Gemütsregung feststellte – hatte Otto schlecht geschlafen. Die Eingeborenen tanzten wie grimmige Kobolde vor seinem inneren Auge, und die Schreie der Nachttiere im Busch klangen ihm unheilverkündend in den Ohren. Er wünschte sich zurück auf sein Schiff. Rum, Wein, Portwein – seit Jahren hatte er nicht mehr so viel getrunken. Bei Morgengrauen, er lag immer noch schweißgebadet auf seinem Bett, sah er auf einmal, dass sich in einer dunklen Zimmerecke etwas regte. Angestrengt versuchte er etwas zu erkennen und sprang dann plötzlich auf. Als die riesige Schlange ihren Schlafplatz verließ, packte Otto seine Kleider und floh nackt ins Freie.
Am nächsten Morgen war er schlecht gelaunt, befahl der an Land gegangenen Mannschaft mürrisch, sich sofort an Bord zu begeben, und rief dem Ersten Maat, Bart Swallow, zu, dass sie mit der ersten Flut auslaufen würden. Eilig verabschiedete er sich von seinem Gastgeber und jagte die White Rose erleichtert gen Süden. Der frische Wind kühlte sein gerötetes, erhitztes Gesicht.
Und nun, eine Woche später, stand er am Steuerruder und wusste, dass er übereilt abgereist war, obwohl er das niemals zugegeben hätte.
»Sagen Sie das noch einmal, Mr. Swallow!«, brüllte er.
»Wir haben fast kein Wasser mehr, Sir.«
»Und warum haben wir fast kein Wasser mehr?« Vor Wut wollte ihm die Zunge kaum gehorchen.
»In Somerset hat es eine Verwechslung gegeben, Sir. Die Männer haben die Fässer mit dem Wasser aus Batavia ausgeleert und nur eines neu gefüllt. Sie wollten die restlichen Fässer am nächsten Morgen auffüllen, aber das wurde übersehen.«
»Übersehen! Was für ein ausgemachter Unsinn! Übersehen! Übersehen wir das Ablegen? Das Segelsetzen? Ich wette, Sie haben noch niemals den Rum übersehen, oder?«
»Es tut mir leid, Sir.«
Um sie herum auf dem Deck hatten die Männer ihre Arbeit liegen lassen, um zuzuhören; sie warfen sich Blicke zu und grinsten hämisch, als der Kapitän den Ersten Maat zusammenstauchte. Doch auch sie bekamen ihr Fett ab.
»Hört mir jetzt gut zu, ihr faulen Säcke. Ihr lacht. Ihr denkt, mit einem Wasserfass kommen wir leicht bis zum nächsten Hafen. Was seid ihr bloß für Idioten!« Verärgert deutete Beckmann auf das glatte, saphirblaue Wasser. »Ihr denkt, das hier sei ein ungefährlicher, sicherer Seeweg, aber unter uns lauern Riffe, die meinem Schiff den Bauch aufschlitzen könnten. Gott verhüte, dass so etwas geschieht, aber wenn wir auf ein Riff laufen, verdursten wir. Ich werde nicht weitersegeln, wenn wir nicht genug Wasser haben. Habt ihr mich verstanden?«
»Ja, Käpt’n«, raunten die Männer.
»Ich sollte Sie auspeitschen lassen, Mr. Swallow, aber stattdessen werden Sie sich auf die Suche nach Wasser machen. Sie nehmen die für das Wasser verantwortlichen Männer mit. Wer war das? Wer hat noch seine Pflicht vernachlässigt?«
Swallow fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich übernehme die volle Verantwortung, Sir.«
»Können Sie etwa das Beiboot rudern und die Fässer allein tragen?«
»Nein, Sir.«
»Dann nennen Sie mir die Namen.«
Es entstand Unruhe. Die Männer blickten sich neugierig um und versuchten festzustellen, wer von ihnen an Land gehen musste. »Billy Kemp«, begann Swallow, »George Salter und Dutchy Baar.«
»Gut. Am Morgen werden wir an der Mündung des Endeavour River vor Anker gehen. In meinen Karten ist dort in Küstennähe Quellwasser verzeichnet. Sie werden zu viert das Wasser holen.« Er schnüffelte und rümpfte die Nase. »Was ist denn das für ein Gestank?« Gleich darauf schüttelte er verzweifelt den Kopf. »Du schon wieder, Gaunt!«
Der Kajütenjunge stand da und glotzte. Er hielt einen Eimer mit einer übelriechenden Flüssigkeit in der Hand. Man brauchte gar nicht erst zu raten, was es war: Gussie hatte sich wieder übergeben.
»Bring das weg«, brüllte Beckmann, »oder ich werfe dich mitsamt dem Eimer über Bord! Und scheuere den Eimer aus!« Voller Ekel wandte er sich ab. Wie ihn der alte Halunke Willy Gaunt dazu überreden konnte, seinen schwachsinnigen Sohn anzuheuern, würde er nie verstehen. »Der glotzende Gaunt« war ein verdammt guter Name für ihn, so wie er ständig herumstand und wartete, dass ihm jemand zum hundertsten Mal erklärte, was er tun solle. Er schien nichts zu behalten. Doch glücklicherweise hatte er auch eine gute Seite: Er war nett zu Augusta. Es machte ihm offenbar nichts aus, sie zu pflegen, hinter ihr herzuwischen, treppauf, treppab zu rennen und ihr Kaffee und Kekse zu bringen. Die Wäsche besorgte er ebenso gut wie jede chinesische Wäscherei. Gussie mochte ihn, und das war wenigstens etwas.
Beckmann beugte sich wieder über seine Karten und musterte die Küstenlinie um die Mündung des Endeavour River. Er konnte es sich nicht leisten, daran vorbeizufahren.
2
Will Gaunt hatte sich ganz genau ausgemalt, wie die Zukunft seines Sohnes aussehen sollte. Edmund würde als Kajütenjunge anfangen, einige Jahre als Matrose fahren, Befehle befolgen, sich mutig und tüchtig zeigen, Geld sparen und mit zunehmender Erfahrung Schritt für Schritt befördert werden. Auf diese Weise konnte er sich allmählich zur Spitze hocharbeiten und schließlich das kostbare Kapitänspatent erwerben.
Dieser Einfall war ihm in einem lichten Augenblick gekommen – der erste Einfall, den Willy je gehabt hatte –, und er konnte sich vor Aufregung kaum fassen, so genial fand er ihn. Bis zu jenem Tag hatte sich Willy vom Schicksal treiben lassen, hatte nicht mehr Gewalt über sein Leben gehabt als ein Stein, der eine gepflasterte Straße hinunterrollt. In den düsteren Elendsvierteln von Liverpool, die sein Zuhause gewesen waren, mussten die Einheimischen mit den Horden hungernder irischer Einwanderer um das tägliche Stückchen Brot kämpfen. Diebstahl war eine Lebensnotwendigkeit, und ein geschickter Dieb wurde von allen bewundert. Willy war weder ein guter noch ein schlechter Dieb. Er arbeitete einfach in diesem Beruf, und eigentlich wurde ihm niemals bewusst, dass er ums Überleben kämpfte.
Als der klirrende Frost des Winters über die ausgemergelten Menschen hereinbrach, schlossen sich hinter Willy und seinen Kameraden die Gefängnistore. Verächtlich grinsend stapften die Sträflinge über den Gefängnishof, wo Magistratsbeamte ihren Preis ausriefen wie auf einer Auktion; die einzigen Bieter waren die Kolonien.
Willy war es gleichgültig, dass er nun ein Weltreisender geworden war. Als er von Sydney aus zum Moreton-Bay-Gefängnis geführt wurde, sah er die Gräber anderer Sträflinge. Mit einem Dokument in der Tasche, das ihn als Freigänger auswies, schlug er sich nach Brisbane durch, um zu arbeiten. Er verlor jegliches Zeitgefühl, bis ihn ein gelangweilter Büroangestellter darauf aufmerksam machte, dass er nun schon seit mehr als einem Jahr ein freier Mann war.
Seine Frau Jane Bird, ebenfalls eine ehemalige Strafgefangene, kratzte die zehn Guineen zusammen, die zum Kauf eines eigenen Hauses nötig waren. Dort sollte ihr Sohn aufwachsen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Willy schon so an die schwere Arbeit gewöhnt, dass er weiter seinem Tagwerk nachging und sich in mehreren Berufen versuchte, nur gelegentlich, aus alter Gewohnheit, handelte er noch mit gestohlenen Waren.
Ein freier Mann zu sein bedeutete Willy sehr viel. Als junger Bursche hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, was das Wort »frei« eigentlich bedeutete, aber nun besaß er ein Stück Papier, das ihm diese Freiheit garantierte. Außerdem hatte er einen Sohn, dem die Möglichkeit offenstand, einmal eine wichtige Persönlichkeit zu werden, ein Mann, der anderen Leuten Befehle gab.
Durch seine guten Beziehungen zu den Hafenarbeitern von Brisbane machte Willy Gaunt die Bekanntschaft des deutschen Kapitäns Beckmann. Beckmann besaß einen Küstenklipper, die White Rose.
Der scharfsichtige Willy hatte sich schnell ein Urteil gebildet: Beckmann war ein guter Kerl, ein Mann, dem man vertrauen konnte. Es erforderte ein wenig Überredungskunst, aber schließlich war der Kapitän bereit, seinem Jungen eine Chance zu geben, und so heuerte Edmund als Kajütenjunge auf der White Rose an.
Jane war gestorben, als der Junge zehn Jahre alt war. Sie hatte ihren Mann inständig gebeten, für den Jungen zu sorgen, und Willy hatte Wort gehalten. Er liebte seinen Sohn und war stolz darauf, dass er so gut lesen und schreiben konnte wie ein großer Herr. Und nun sollte Edmunds Leben als Seemann beginnen.
Drei Nächte in der Woche musste Edmund Wache halten, auf Abruf bereit sein, Botschaften überbringen, musste die Laternen überprüfen und einfach die Augen offen halten.
»Deine Augen sind noch jung«, hatte Kapitän Beckmann gesagt. »Meistens wissen sie zwar nicht, wonach sie Ausschau halten sollen, aber wenigstens sind sie noch nicht von gestohlenem Rum vernebelt.«
Edmund saß hoch droben auf einer Spiere und beobachtete dienstbeflissen das ruhige, mondbeschienene Wasser der Whitsunday Passage. Endlich fühlte er sich einmal wohl, denn hier war der Seegang nicht so stark wie auf dem offenen Meer. Während alle anderen an Bord den eintausendsechshundert Kilometer langen Streifen voller Korallenriffe entlang der Küste von Queensland fürchteten, war Edmund dankbar. Die White Rose segelte gemächlich dahin, und so konnte sich sein Magen endlich beruhigen.
Sobald das Schiff vom Brisbane River in die Moreton Bay und Richtung Norden aufs offene Meer gefahren war, war Edmund schrecklich seekrank geworden. Sein Entsetzen darüber und das Gefühl, sich lächerlich zu machen, hatten sein Leiden noch verschlimmert. Ihm wäre zuvor nicht im Traum eingefallen, dass ihm übel werden könnte, und schon gar nicht, dass er sich dabei so sterbenselend fühlen würde. Er hatte Mr. Swallow angefleht, sich in seinen Verschlag aus Segeltuch unter dem Beiboot verkriechen zu dürfen, aber der wollte nichts davon hören. »Reiß dich zusammen, Junge. Wenn du dich oft genug auskotzt, dann kann irgendwann nichts mehr hochkommen. Mach weiter mit deiner Arbeit, aber kotz nicht aufs Deck, sonst zieh ich dir das Fell über die Ohren.«
Nur Mrs. Beckmann, die Frau des Kapitäns, hatte Mitleid mit ihm, denn auch sie war seekrank gewesen. Edmund musste die Eimer ausleeren, in die sie sich übergab, während sie sich wortreich bei ihrem Leidensgenossen entschuldigte. Sobald sie die Whitsundays erreicht hatten, waren sie beide aufgelebt, und die Reise gen Norden zu der kleinen Siedlung an der Spitze von Cape York war ohne Zwischenfälle verlaufen. Aber nun, auf der Rückfahrt, war die Frau des Kapitäns wieder krank geworden.
Die Mannschaft, die wusste, dass Mrs. Beckmann nicht seefest war, lachte und machte sich über sie lustig. In Edmunds Augen war das grausam, aber die Männer wollten Mrs. Beckmann einen Denkzettel verpassen, damit sie künftig zu Hause blieb. Sie wollten keine Frau an Bord, und schon gar keine Deutsche. Es sei ein böses Omen, sagten sie. Ständig redeten sie über böse Omen, jedes zweite Ereignis trug irgendein Vorzeichen. Edmund war beileibe kein Ungläubiger, o nein. Vielmehr erschreckten ihn ihre Geschichten zu Tode, und er wollte unbedingt wissen, wie er sich schützen konnte. Er tauschte seine täglichen Rumrationen bei Billy Kemp gegen einen Haifischzahn ein, den er nun um den Hals trug. Ein guter Tausch. Wenn er über Bord fiel oder Schiffbruch erlitt und einen Haifischzahn bei sich trug, würde sich kein Hai in seine Nähe wagen. »Die sind schneller weg als das Höschen einer Hure!«, hatte Billy gesagt, und Edmund war beruhigt. Er hatte nämlich furchtbare Angst vor Haien.
Eine Bewegung auf Deck unterbrach ihn in seinen Gedanken. Er ließ sich heruntergleiten und spürte die willkommene Kühle der Morgenbrise. Das Meer war bis zum Horizont in rosarotes Licht getaucht; immer wieder erstaunte es ihn aufs Neue, dass der Ozean eine solche Farbe annehmen konnte. Dort, wo gleich die Sonne aufgehen würde, zeichneten sich graue und rosafarbene Streifen auf dem Himmel ab. Edmund fragte sich, was wohl jenseits des Horizonts liegen mochte.
»Steh hier nicht rum, du alter Kakadu, hilf uns lieber!« Billy Kemp schob Edmund zum Beiboot. »Mach es los. Die Jungs bringen die Fässer.«
Billy war ein Typ, der immer Befehle geben musste. Man könnte denken, er sei Offizier und nicht bloß ein einfacher Matrose. Edmund nestelte an den Seilen herum, aber andere Hände waren schneller, und so wurde das Beiboot bald über Bord gehievt. Auf dem Schiff ging es plötzlich geschäftig zu, jeder wollte dabei sein und zusehen, wie die Fässer im Boot verstaut wurden und die Gruppe aufbrach. Edmund betete, dass sie Wasser finden würden. Er wollte nicht mit einer riesenhaft angeschwollenen Zunge sterben, die kaum noch in den Mund passte, wie es den Erzählungen nach beim Verdursten der Fall war.
Der Kapitän stand da und schaute mit unbewegter Miene zu. Da ein dichter Bart sein Gesicht verhüllte, war nur schwer zu erraten, was er dachte. Wenn er den Mund geschlossen hielt, konnte man nur die stahlgrauen Augen sehen. Eines Tages, sagte sich Edmund, würde er auch einen Bart tragen.
Mr. Swallow trug einen Revolver. Edmund erschauderte. Er war froh, dass er nicht an Land gehen musste. Sie lagen zwar weit vor der Küste, aber selbst von hier aus wirkte das Land unheimlich auf ihn.
Mrs. Beckmann kam mit gerafften Röcken schnaufend an Deck, um dem Aufbruch der Wassersucher zu dem winzigen Streifen weißen Strandes zuzusehen.
»Können wir nicht näher ran?«, hörte er sie den Kapitän fragen.
»Das ist zu gefährlich. Wir müssen hier in der Fahrrinne bleiben. Du siehst gut aus heute Morgen, meine Liebe.«
»Ich fühle mich auch besser. Um diese Tageszeit ist es noch nicht so mörderisch heiß.«
»Du solltest hier oben an der frischen Luft bleiben. Das ist viel besser für dich. Der Junge soll es dir bequem machen und deinen Morgentee bringen.«
Zu spät. Sie hatten ihn schon entdeckt. Unglücklich trottete Edmund in die Kombüse hinunter. Da er die halbe Nacht Wache geschoben hatte, hätte er sich jetzt eigentlich in seine Koje legen dürfen, aber sobald ihn der Koch in die Finger bekäme, würde er ihm beim Frühstück für die Mannschaft helfen müssen. Dann würde er wohl die Kajüten putzen müssen oder irgendeine andere Knochenarbeit aufgehalst bekommen. Er konnte von Glück sagen, wenn er vor der Dämmerung noch ein paar Stunden Schlaf abbekam.
Die Landgänger starrten ängstlich auf die grünen Berge, die bedrohlich hinter der Küstenlinie aufragten. Der Nebel, der vom feuchten Dschungel aufstieg, verhüllte ihre Gipfel wie ein riesiger grauer Schal. An der Mündung des Flusses hingen dunkelgrüne Mangroven ins Wasser, aber südlich davon hatte sich ein Streifen blendend weißen Strandes in das unbarmherzige Grün gedrängt.
Billy Kemp saß als Erster im Boot. Er war durstig. Beckmann hatte den Schuldigen jeden Tropfen Wasser verweigert, seit man festgestellt hatte, dass die Fässer leer waren. Billy hatte es eilig wegzukommen. Er hängte schon sein Ruder ein, während die anderen erst an Bord sprangen. »Beeilt euch gefälligst«, knurrte er. »Je eher wir wieder zurück sind, desto besser.«
»Nimm du ein Ruder, Dutchy«, befahl Bart Swallow.
Dutchy grinste Billy an. »Leg dich in die Riemen, Junge. Wenn wir am Wasser sind, wollen wir uns erst mal ordentlich den Bauch füllen.«
George Salter machte sich Sorgen. »Was ist, wenn wir kein Wasser finden?«
»Ach, halt’s Maul, du britischer Bastard«, fuhr Billy ihn an. »Mr. Swallow weiß, wo es Wasser gibt, nicht wahr?« Swallow nickte unbestimmt. »Ich denke schon. Kapitän Cook hat hier drei Monate lang vor Anker gelegen.«
»Mein Gott«, entfuhr es George. »Verdammt noch mal, das ist doch schon hundert Jahre her!«
»Das weiß ich«, herrschte Swallow ihn an. »Er war der Erste, der hier Wasser fand, aber seitdem waren auch noch andere Leute da. Es heißt, dass der Weg zu den Quellen durch Zeichen an Bäumen markiert ist.«
»Inzwischen sind die Pfade todsicher wieder zugewachsen«, wandte Billy ein. »In diesem Klima wuchert der Busch schneller als Unkraut. Egal, die Regenzeit ist gerade vorbei, und die Wasserläufe an diesen verdammten Hügeln müssten eigentlich überfließen.«
»Woher willst du das so genau wissen?«, fragte George. Billy beachtete ihn nicht. Er genoss die Herausforderung, mit dem großen, bärenstarken Holländer mitzuhalten. Scheinbar mühelos führte dieser mit seinen braun gebrannten, sehnigen Armen kräftige Ruderschläge aus, die das schwere Boot pfeilschnell auf die Küste zutrieben.
Woher er das wissen wollte? Er kannte sich aus mit Wasser, vor allem hatte er Erfahrung damit, was es bedeutete, wenn kein Wasser da war. Auf dieser verdammten, gottverlassenen Farm, die sein alter Herr gekauft hatte, hatte er oft genug Dürrezeiten erlebt. Seine Eltern waren freie Siedler gewesen, denen alle Möglichkeiten offenstanden. In der Familie Kemp hatte es keine Verbrecher gegeben, niemand trug die Narben von Peitschen oder Ketten. Voller Hoffnung waren seine Eltern mit ihren beiden kleinen Söhnen in dem fremden Land angekommen, und dann hatte man sie hereingelegt und ihnen dieses briefmarkengroße Stück Farmland hinter Bathurst angedreht. Wahnsinn! Jetzt, da es zu spät war, hätte Billy ihnen erklären können, dass man in diesem Land groß einkaufen musste oder es besser ganz bleiben ließ. Aber seine Eltern hatten immer davon geträumt, eine Farm zu besitzen, sich zu vergrößern und eines Tages zu den Großgrundbesitzern zu gehören. Doch sie hatten Pech gehabt.
Für die ärmliche kleine Schafzucht hatte es eigentlich von Anfang an keine Hoffnung gegeben, denn dort draußen brauchte man ungeheuer viel Land und eine wahre Armee von Schafen. Dennoch hatten sie tapfer weitergekämpft. Dingos schlugen die Schafe. Krähen hackten ihnen die Augen aus. Und Billy hatte die Eltern auf ihrer kleinen, abgelegenen Farm langsam zugrunde gehen sehen. Als sein jüngerer Bruder an einem Schlangenbiss starb, hatte die Mutter den Verstand verloren. Ruhelos lief sie umher und suchte nach dem toten Jungen; sie rief so oft nach ihrem Harry, dass die Papageien, diese unverbesserlichen Spaßvögel, ihren Ruf nachahmten. Kleine Wellensittiche kreischten mit ihren komisch piepsenden Stimmen: »Harry! Wobisduharry?« Auch die Kakadus hatten es schnell gelernt und machten ihre Sache noch besser. Sie waren zahm wie Hühner und äußerst neugierig, und so saßen sie in den Bäumen oder wühlten vor dem Haus im Staub und riefen dabei glockenrein im Chor: »Harry! Hallo Harry! Komm heim, Harry!« Das allein schon hätte jeden in den Wahnsinn getrieben. Und Regen? Sie wussten gar nicht mehr, was das war. Sie vergaßen, wie Gras aussah, denn überall gab es nur Staub, Staub und noch einmal Staub. Und als das letzte Schaf gestorben war, ging sein alter Herr hinunter zu dem ausgetrockneten Flusslauf und erschoss sich.
»Sachte jetzt«, sagte Bart Swallow, »haltet die Augen offen. Die Gegend sieht zwar verlassen aus, aber man weiß ja nie. Die Flut kommt, also bleibt diesen Felsen fern und steuert auf den Strand zu. Vorsichtig, das Boot nur langsam aufsetzen.«
»Glaubst du, dass es hier Schwarze gibt?«, fragte George. »Wir bleiben nicht lange genug, um das herauszufinden«, erwiderte Swallow kurz angebunden.
Sie zogen das Boot an den Strand und warfen die drei Fässer an Land. »Ich passe auf das Boot auf«, sagte Billy schnell. Er hatte keine Lust auf einen Spaziergang durch den Dschungel; dort wimmelte es von Schlangen.
»Hier gebe ich die Befehle, Kemp«, wies ihn Swallow zurecht. »Du kommst mit, Dutchy, ich brauche dich zum Fässerschleppen. Und ihr zwei bewacht das Boot.« Er nahm zwei Macheten und gab Dutchy eine davon. »Wie’s aussieht, müssen wir uns erst einen Weg bahnen.«
»He, wie sollen wir denn das Boot bewachen, wenn wir gar keine Waffe haben?«, fragte Billy. »Sollen wir vielleicht mit Sand werfen, wenn wir angegriffen werden? Gib mir den Revolver.«
»Er hat recht«, bemerkte George. »Wir hätten mehr Waffen mitnehmen sollen.«
»Die brauchen wir nicht.« Swallow legte sein Pistolenhalfter ab. »Gut, ich lasse euch den Revolver da. Nimm du ihn, George. Hier ist die Munition. Wenn ihr uns braucht, feuert einen Schuss ab, und wir kommen dann, so schnell wir können.«
Billy lachte abfällig, als sie im Busch verschwanden. »Dieser Swallow ist doch einfach zu nichts zu gebrauchen. Erst hat er das Wasser vergessen, und jetzt vergisst er die Gewehre. Komm, gehen wir in den Schatten, hier wird man bei lebendigem Leib geröstet. Der Sand glüht ja.«
Sie folgten den anderen ein Stück am Strand entlang und ließen sich auf einem Büschel Seegras nieder. Swallow und Dutchy waren in dem undurchdringlichen Buschwerk, durch das sich gewaltige Schlingpflanzen zogen, verschwunden, aber Billy und George hörten, wie sich die beiden einen Weg landeinwärts bahnten. Billy hoffte, sie würden nicht zu lange brauchen, schließlich war das hier kein Picknick. Er sah zu, wie George sich das Halfter umschnallte und den Revolver untersuchte. »Ist er geladen?«
»Natürlich.«
»Dann pass auf, dass du dir nicht deinen verdammten Fuß abschießt! Gib ihn mir!«
»Halt den Mund! Ich kann schießen. Du denkst, du weißt alles, Kemp, aber ich wette, du könntest nicht mal ’ne Krähe treffen.«
»Ich wette gegen eine goldene Uhr, dass du keine Krähe triffst«, sagte Billy träge. »Diese Vögel haben mehr Hirn als du, Kumpel.«
Er lehnte sich gegen einen Baum und beobachtete mit einem Auge das Boot. Schießen? Jeder konnte schießen. Außer seinem alten Herrn. Der hatte nicht mal das hingekriegt. Billy – er war damals zehn – hatte geschrien und geweint, als er zum Flusslauf kam und seinen Vater dort liegen sah: das halbe Gesicht weggeschossen und überall Blut. Er hatte sich neben seinen Vater in die Blutlache gekniet und ihn umarmt. Da hatte er bemerkt, dass das eine Auge flehentlich zu ihm hinaufstarrte! Er lebte noch! Was für eine verdammte Scheiße! Es war schrecklich, sich immer wieder daran zu erinnern. Billy hatte sein Gewehr genommen und dem Ganzen ein Ende gemacht. Er musste es tun. Man erschoss ja auch sterbende, kranke und blinde Schafe.
Mein Gott, war er durstig! Sein Mund war staubtrocken. Er stand auf, ging im Schatten am Strand entlang und hielt Ausschau nach einer Kokospalme. Ein Schluck Kokosmilch wäre jetzt genau das Richtige, aber weit und breit war keine Palme zu sehen. »Tja, wer hätte das gedacht?«, murmelte er vor sich hin. »Vom Schiff sieht es so aus, als wäre die ganze Küste voller Palmen, und wenn man wirklich eine braucht, findet man keine.«
Als er zurückkam, war George eingedöst. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken. Billy spuckte aus und trat ihn kräftig in die Rippen. »Du bist mir vielleicht ein toller Wachposten!«
»Was soll das?«, brüllte George und sprang auf. »Ich hab mich nur ’n bisschen ausgeruht.«
Ein Schwarm Loris stob in einer rotblauen Wolke aus dem Dschungel und flog kreischend hinaus aufs Meer. Billy stieß einen bewundernden Pfiff aus. Junge, waren die schnell! Alle machten gleichzeitig wieder kehrt und schossen in einem ausgedehnten Bogen zurück ans Land. Billy nickte anerkennend. Irgendwo musste ein Habicht lauern, aber dem waren sie entkommen.
An dem dicken Ende eines Schraubenpalmzweiges zog sich Billy in die Höhe und seufzte. Er wünschte, die anderen würden sich ein bisschen beeilen. Allmählich sollten sie jetzt Trinkwasser gefunden haben. Als er seinen Blick über die weiße Sandfläche gleiten ließ, entdeckte er am anderen Ende des Strandes eine Gestalt, die gerade aus dem Dschungel hervorgetreten war. Anscheinend ein Schwarzer, der da so sorglos dahinschritt. Gott sei Dank war er allein. Billy sagte George vorerst noch nichts von seiner Entdeckung. Stattdessen beobachtete er den Eingeborenen, der jetzt fischte. Er war hinaus ins Meer gewatet und reglos stehen geblieben. Wie eine glänzende schwarze Statue hob er sich gegen das blaue Wasser ab. Irgendwann stieß er dann blitzschnell mit dem Speer zu und steckte seinen Fang in einen mitgeführten Beutel. Als er weiter den Strand hinaufkam, erkannte Billy, dass er noch sehr jung war. Doch dann bückte er sich über den gefüllten Beutel, und ganz deutlich sah Billy die Umrisse kleiner Brüste. Ein Mädchen! So nackt wie Eva im Paradies, und selbst das Feigenblatt fehlte!
Grinsend fuhr Billy mit der Zunge über die Lippen, dann ließ er sich von seinem Hochsitz heruntergleiten. Währenddessen hatte sich das schwarze Mädchen aufgerichtet und starrte auf das verlassene Beiboot. Schließlich siegte die Neugier. Das Mädchen kam näher, um das Boot zu untersuchen.
Billy packte George. »Pssst! Ganz leise. Schau mal, was wir da haben.« Er zog George ins Gebüsch. »Ein toller Leckerbissen, mein Junge.«
George, der wie gebannt auf das Mädchen starrte, brachte ein Nicken zustande.
»Die holen wir uns«, sagte Billy. »Aber wir müssen fix sein. Wir nehmen sie mit ins Gebüsch.«
Zitternd vor Aufregung nickte George erneut.
»Außerdem«, gab Billy zu bedenken, »kann sie uns vielleicht zu einer Quelle führen, das wäre ein weiterer Vorteil.«
Die zwei Männer trennten sich und pirschten sich im Schutz des Dickichts so nah an das Mädchen heran, dass es sich zwischen ihnen befand. Dann rannten sie urplötzlich auf ihr Opfer zu.
Billy erhaschte einen Blick auf das zu Tode erschrockene Gesicht des Mädchens, bevor sie sich umdrehte und dabei fast mit George zusammenstieß. Doch behände wich sie ihm aus und warf sich ins Meer.
»Ihr nach!«, brüllte Billy und lief durch die Wellen. Sie mussten bis zur Hüfte ins Wasser waten, bevor sie das Mädchen erwischten, das sich mit Händen und Füßen wehrte. Es war, als wollte man einen Barramundi mit der bloßen Hand fangen, und ihre Zähne waren messerscharf. George bekam einen Fußtritt gegen das Kinn, worauf er rücklings ins Wasser fiel, aber Billy stürzte sich lachend auf das Mädchen und schlang einen Arm um ihre Brust. Er spürte ihre seidige Haut und streifte die kleinen Brustwarzen.
»Halt sie fest, Mann!«, stieß George hervor und tauchte nach ihren Füßen. Billy gab sich alle Mühe, aber das Mädchen kämpfte verbissen. Sie zog ihn in tieferes Wasser, und bald schlugen die Wellen über ihnen zusammen. Billy spürte keinen Boden mehr unter den Füßen. Einige Meter weiter draußen schrie George bereits in Todesangst: »Hilfe! Billy, hilf mir!« Er versank und tauchte prustend wieder auf. »Ich kann doch nicht schwimmen!« Hilflos ruderte er mit den Armen.
Durch George abgelenkt, lockerte Billy seinen Griff, und plötzlich war ihm das Mädchen entschlüpft. Suchend blickte er sich um, aber sie war nirgends zu sehen. Das Sonnenlicht, das auf dem schimmernden Wasser tanzte, blendete ihn. »Verdammter Mist!«, murmelte er, eher belustigt als verärgert, dass ihnen ihre Beute entwischt war. Er schwamm zu George hinaus und zog ihn zurück ins seichte Wasser. »Du verdammter Idiot. Du wirst noch mal in der Badewanne ertrinken.«
»Wo ist sie hin?«, gluckste George.
»Wenn ich das bloß wüsste.«
»Geschieht ihr recht, wenn sie ertrunken ist«, jammerte George. »Sie hat mir beinahe den Kiefer gebrochen. Als ob mich ein Esel getreten hätte.«
Billy trottete schwerfällig ans Ufer. »Die ist nicht ertrunken. Die schwimmt wie ein Fisch. Sie ist irgendwo da draußen und wartet ab.«
Plötzlich rannte George den Strand entlang.
»Wo willst du hin?«, rief Billy.
»Wir haben noch ihren Fang!«, schrie George über die Schulter zurück. »Die Fische!«
Billy zuckte die Schultern. Sollte er den Fisch ruhig haben. Aber wo hatte dieser Trottel den Revolver fallen lassen? Wahrscheinlich an dem schattigen Plätzchen in der Nähe des Bootes. Doch es war Georges Problem, den Verlust des Revolvers zu erklären.
Er steuerte gerade auf das Boot zu, als Dutchy brüllend aus dem Gebüsch gelaufen kam. »Schnell!«, schrie er im Laufen, und Billy brauchte keine zweite Aufforderung. Er rannte über den nassen Sand und stieß das Boot mit aller Kraft vom Ufer ab. Einige Sekunden später hatte Dutchy ihn erreicht. »Ins Boot, schnell!«
»George!«, rief Billy. »Komm zurück!« Er sah sich nach Swallow um, aber Dutchy hatte bereits eines der Ruder gepackt.
Billy war in seinem bisherigen Leben schon oft genug in der Zwickmühle gewesen, um zu wissen, dass man in einem solchen Augenblick erst handelte und dann nach dem Grund fragte; der Holländer hatte das Boot auch schon aufs offene Meer manövriert.
»He, warte auf die anderen, du Bastard!«, schrie Billy. Er verstummte jedoch, als eine Meute von bedrohlich aussehenden, weißbemalten Wilden auf den Strand gelaufen kam. »Renn, um Gottes willen, so renn doch!«, rief er George zu.
George rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Durch das seichte Wasser preschte er auf das Boot zu, während Dutchy es mit nur einem Arm weiter nach draußen ruderte.
»Er kann nicht schwimmen!«, rief Billy Dutchy zu, aber es war schon zu spät. Billy sah, wie einer der Aborigines weit ausholte, und beobachtete wie hypnotisiert den Flug des Speers, bis er George in den Rücken drang. George schrie auf, warf die Arme hoch und fiel mit dem Gesicht nach unten ins Wasser. Nur der Speer ragte wie ein winziger Mast aus dem Meer.
Mit hastigen Ruderschlägen trieben sie das Boot aufs offene Meer hinaus. Brüllend kamen die Schwarzen näher. Speere flogen durch die Luft. Schweißüberströmt zog Billy an dem schweren Ruder. Er hatte den Eindruck, dass sie sich nur im Schneckentempo vorwärtsbewegten. Sicher würden die Schwarzen, die ihnen mittlerweile nachschwammen, sie einholen und das Boot umkippen. Aber das Boot war nun leichter, da die Holzfässer noch am Ufer lagen und sie nur zu zweit darin saßen. Wo aber war Bart Swallow?
Mit jedem Ruderschlag vergrößerten sie den Abstand zwischen sich und den Angreifern, doch ihr Schiff lag weit draußen an einer Landzunge, und Billy fürchtete, die Schwarzen könnten ihnen in Kanus dorthin folgen. Ihn schauderte, wenn er an Swallow dachte, den sie allein an Land zurückgelassen hatten, andererseits war er froh, dass gerade Dutchy davongekommen war, denn ohne seine Muskelkraft hätten sie es niemals geschafft. »Was ist mit Swallow passiert?«, fragte Billy schließlich, als das Schiff allmählich in Sicht kam.
»Sie haben ihn erwischt«, knurrte Dutchy mit zusammengebissenen Zähnen.
»Ist er tot?«
Dutchy drehte sich wütend zu ihm um. »Ihr zwei solltet eigentlich Wache halten. Ich dachte, wenn ich aus dem Dschungel komme, gibt mir jemand Feuerschutz, und dann ist niemand beim Boot. Durch eure Schuld hätten sie mich beinahe auch noch erwischt, ihr verdammten Idioten.«
»Um Gottes willen! Du kannst doch nicht mir die Schuld geben! Mr. Swallow hätte den Revolver nicht George, sondern mir geben sollen. Ich war nicht weit weg, mir kannst du nichts vorwerfen.«
Einige Gesichter spähten über die Reling, als Dutchy die Taue packte. »Um dich wär’s auch nicht schade gewesen«, bemerkte er grimmig.
Der Zorn des Kapitäns war ebenso vorhersehbar gewesen wie Ebbe und Flut. Der Verlust der beiden Männer entsetzte ihn, besonders, als er von den Umständen ihres Todes hörte. Außerdem war er wütend, dass sie ohne ausreichende Bewaffnung an Land gegangen waren. Bei dem Gedanken, dass der diensthabende Offizier zu den Opfern gehörte, empfand er allerdings eine gewisse mit Schuldbewusstsein gepaarte Erleichterung. Anderenfalls hätte er nämlich dessen Auspeitschung anordnen müssen, und er verabscheute Gewalt.
Im Beisein des Zweiten Maats Henry Tucker und seiner Frau Augusta, die ängstlich in einer Ecke des Tagesraums saß, unterzog er Dutchy und Kemp einem ausführlichen Verhör.
»Wir fanden den Flusslauf«, erklärte Dutchy, »indem wir uns einfach geradeaus einen Weg bahnten. In dem dichten Busch hätte es sowieso keinen Sinn gehabt, nach markierten Bäumen zu suchen. Ich dachte, es wäre ganz einfach. Wir fanden eine Quelle, tief genug, um die Fässer einzutauchen. Eines hatten wir gerade gefüllt, und Mr. Swallow stand auf. Ich schwör’s, Käpt’n, ich hab nichts gehört und nichts gesehen, und wumm! Dieser verdammte Speer ist aus dem Nichts gekommen und ging mitten durch seinen Hals. Also bin ich, so schnell ich konnte, den Pfad wieder zurückgerannt.«
»Ihr habt ihn einfach dort liegen lassen?«, fragte Tucker. »Hätten wir ihn erst begraben sollen?«, knurrte Dutchy wütend. »Wenn man hier sitzt, kann man leicht mutig sein. Und dumm. Natürlich bin ich weggerannt, ich hab nicht mal mehr die Machete mitgenommen.«
»Warum war George nicht beim Boot?«, fragte der Kapitän. Schon wieder.
»Er schlenderte gerade ein bisschen am Strand entlang«, erwiderte Billy. »Es ist nicht meine Aufgabe, ihm zu sagen, was er tun soll. Außerdem hatte er den Revolver.«
»Warum hat er ihn dann nicht benutzt?«
»Er war zu sehr damit beschäftigt wegzulaufen, Käpt’n.«
Beckmann war überzeugt, dass irgendetwas an Billy Kemps Geschichte nicht stimmte; der Kerl wich seinem Blick aus. Andererseits war er wahrscheinlich noch immer ganz verstört, denn es musste ein schreckliches Erlebnis gewesen sein.
Tucker kratzte sich an seinem roten Bart und beugte sich vor. »Wenn er auch nur einen Schuss auf diese Wilden abgegeben und einen von ihnen getroffen hätte, wären sie in die Flucht geschlagen worden.«
»Stimmt, aber erklären Sie das mal George«, murmelte Billy. Beckmann war besorgt. Es erschien ihm feige, einfach davonzusegeln und keinen Versuch zu unternehmen, die Leichen zu bergen und den beiden Männern ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen, aber durfte er dafür das Leben der übrigen Männer aufs Spiel setzen?
»Ich werde einen genauen Bericht verfassen«, sagte er, »und ihr beiden werdet ihn vor Zeugen unterschreiben.«
In dem anschließenden Gottesdienst, den Beckmann für die Seelen der beiden tapferen Kameraden abhielt, die am Endeavour River heimtückisch ermordet worden waren, bat er den Herrn um Gnade für sie, da man ihnen in diesem Leben keine Gnade erwiesen hatte. Dann dankte er Gott dafür, dass er die beiden anderen Matrosen geschont hatte. Augusta stimmte einige Kirchenlieder an. Vor versammelter Mannschaft ordnete der Kapitän an, das letzte Trinkwasser rund um die Uhr zu bewachen. »Gott helfe uns«, sagte er. »Wir haben kaum noch Wasser; uns steht also eine schwere Zeit bevor. Segel setzen, Mr. Tucker.«
Als Tucker seine Befehle brüllte, machte sich die Mannschaft eifrig ans Werk. Keinem von ihnen tat es leid, diesen schrecklichen Ort zu verlassen, deshalb brauchten sie für das Losmachen der Segel auch nur die Hälfte der sonst üblichen Zeit. Als Beckmann jedoch das Steuer ergriff, ertönte plötzlich der Ruf: »Mann über Bord!«
»Was, in Gottes Namen, ist denn jetzt schon wieder los?«, rief der Kapitän.
Tucker eilte herbei.
»Kein Mann über Bord«, keuchte er. »Da treibt jemand vor uns im Wasser. Vielleicht konnten Bart oder George doch noch abhauen.«
»Unmöglich!«, erwiderte Beckmann, aber er musste auf Nummer sicher gehen. »Stehen Sie hier nicht rum, Mann, holen Sie ihn raus!«
Wieder wurde das Beiboot herabgelassen. Sie zogen aber nicht die Leiche von Swallow oder George aus dem Wasser, sondern ein Aborigine-Mädchen, ein kleines, schmächtiges Wesen.
3
Kagari sah das fremde Kanu und lief darauf zu, als die beiden Männer sich plötzlich auf sie stürzten; sie schienen aus dem Nichts aufgetaucht zu sein.
Vor Schrecken war Kagari wie geblendet. So, als wäre die Sonne vom Himmel gerissen worden; nur ein klaffendes Loch blieb zurück, das sie zu verschlingen drohte, während sie in der plötzlichen Finsternis mit den bösen Geistern kämpfte. Dämonische Hände griffen nach ihr, wanden sich wie Schlangen um ihre Arme und Beine, zerrten an ihren Haaren, rissen sie hin und her und versuchten sie festzuhalten.
Doch auch sie war in der Kunst der Schlangen bewandert. War sie denn nicht Kagari, benannt nach dem Kookaburra, dem lachenden Vogel, dem Schlangentöter, dem Schlangenfresser? Er war ein mächtiges Totem, sehr viel mächtiger als diese an das Land gebundenen Schlangen. Sie verwandelte sich in eine Seeschlange, und ihr schlanker Körper schnellte nach vorne, entschlüpfte ihnen und floh ins flache Wasser. Eine Welle glitt über sie hin; sie sammelte ihre Kräfte, streckte sich und schoss wie ein Speer in die Tiefe.
Das blausilberne Wasser in der Bucht des großen Flusses verbarg sie, als sie untertauchte. Geschmeidig glitt sie über das Korallenriff, bis ihre Lungen zu bersten drohten und sie zwangen, wieder an die Wasseroberfläche zu steigen.
Die plötzliche Wärme beim Auftauchen sagte ihr, dass die Sonne immer noch am Himmel stehen musste, aber ihre Augen sahen das Licht nicht. Neues Entsetzen packte sie. Die bösen Geister hatten ihr die Kraft der Augen genommen! Würde sie nun für immer im Finstern wandeln müssen? So wie ihr Bruder Meebal, den man führen und füttern musste, weil seine Augen von dem Giftbaum zerstört worden waren, als er noch ein kleiner Junge war, und der nun hinter abscheulich weißen, leeren und immer tränenden Augen lebte.
Die Furcht ließ ihr keine Zeit, sich lange über ihre Blindheit zu bekümmern. An der Bewegung der Wellen erkannte sie, dass sie ihr Gesicht der Küste zugewandt hatte. Der Wind trug schauerliche Stimmen an ihr Ohr, die ihr zuflüsterten, dass die bösen Geister immer noch da waren und im Meer nach ihrer Beute suchten. Sie tauchte wieder hinab in eine Spalte zwischen den Korallen. Die Tiefseeschlangen brauchten nicht sehen zu können, um dem scharfkantigen Fels auszuweichen, an denen sie sich verletzen konnten, und das galt auch für Kagari.
Fische schwammen ganz dicht an ihr vorbei; das warme Wasser und die Stille beruhigten sie. Als ein gewaltiger Fisch sie leicht mit dem Maul anstieß, wurde sie einen Augenblick von Furcht ergriffen. War es etwa ein Hai? Doch dann erkannte sie, dass es sich um einen dicken Mutterfisch handelte, größer als sie selbst, der nur Gesellschaft suchte.
Kagari ließ die Hände über den Rücken des Fisches gleiten, um sicherzugehen, dass sie wirklich keinen Hai vor sich hatte – die Rückenflosse hätte es ihr verraten. Ihr Leichtsinn ließ sie übermütig werden. Wenn es tatsächlich ein Hai gewesen wäre, hätte er keine Zeit mit solchen Spielereien verschwendet – seine gewaltigen Zähne hätten sie schon längst in Stücke gerissen. Nein, dies hier war eine Seekuh, das zahmste Meerestier, abgesehen von den langnasigen, quietschenden und lächelnden Delfinen, die stets im Schwarm umherschwammen. Sie klammerte sich an die Seekuh und ließ sich von ihr in Richtung Wasseroberfläche ziehen. Wo waren die Leute ihres Stammes? Sicher würde man sie vermissen und nach ihr suchen. Man würde ihren Korb mit Fischen am Strand finden und wissen, dass sie ihren Fang niemals der Sonnenglut oder den Seevögeln überlassen hätte.
Kagari schüttelte den Kopf, dass die Wassertropfen flogen, und rieb sich die Augen. Verzweifelt versuchte sie zu sehen. War dies ein Albtraum? Ein finsterer Traum, in dem sogar ein Schreckensschrei unhörbar blieb? Aber ihre Füße traten doch Wasser, und sie atmete die Luft ein! Nein, das war kein Traum, sondern Wirklichkeit, und sie trieb weit draußen vor der Küste. Sie war noch zu verängstigt, um sich von den Wellen ans Ufer tragen zu lassen. Zuerst musste sie sich wieder beruhigen, diese schreckliche Furcht vertreiben und abwarten. Kagari war stark. Ihr Vater Wogaburra hatte viele Kinder, aber sie war sein Liebling, denn er wusste, dass die Götter der Traumzeit ihr einige seiner magischen Fähigkeiten verliehen hatten, nicht alle selbstverständlich, das wäre nicht schicklich gewesen, aber jedenfalls genug, sodass sie sich von den anderen Kindern unterschied, wie es auch ihm als Knabe ergangen war.
Wogaburra war von höherem Wuchs als die Übrigen seines Stammes, und ein kühner Krieger und Jäger. Doch die Ältesten hatten bald erkannt, dass er auch ein weiser Mann war. Sie führten ihn in die Welt der Geheimnisse ein. Bald konnten sie die Augen nicht mehr davor verschließen, dass Wogaburra wirklich ein Zauberer war. Er besaß Kräfte, die über ihren Verstand hinausgingen, war ein Mann, dem die Achtung aller Irukandji gebührte. Inzwischen wurde er im ganzen Land gefürchtet, denn sein Zauber konnte heilen oder töten, Glück oder Unglück bringen und Unheil vorhersagen, um sein Volk zu schützen. Kagari lächelte. Die Zauberkräfte ihres Vaters waren so mächtig; die bösen Geister sollten sich besser vorsehen. Sogar Tajatella, der Häuptling der Irukandji, hielt sich am liebsten in Wogaburras Nähe auf, damit ihn kein Unheil befallen konnte.
Kagari fragte sich, was für böse Geister sie wohl am Strand überfallen hatten. Gewiss mussten es Geister sein, denn die Irukandji hatten ja keine Feinde; nicht mehr. Ihr Land war das schönste und üppigste auf der Welt. Sie hatten von den kalten und trockenen Ländern, den kargen Ländern gehört, denn in alter Zeit waren von dort die meisten ihrer Feinde gekommen. Manchmal waren furchterregende Männer aus dem Norden über sie hergefallen und hatten ihre Frauen geraubt, aber die Irukandji hatten sich tapfer verteidigt. Angeführt von ihren Häuptlingen hatten sie den Eindringlingen Lektionen erteilt, die diese niemals vergessen würden. Die Irukandji waren stolz auf ihre Krieger; sie waren die gefürchtetsten im ganzen Land. Auf der Welt gab es keinen Stamm, der es wagen würde, ihre Grenzen ohne Erlaubnis zu überschreiten. Gelegentlich brachten Kundschafter Händler mit, die dann an ihren Feuern saßen. Es war lustig, sie zu beobachten, sie waren aufgeregt wie junge Vögel.
Ihre Mutter Luka, diese schüchterne, immer lächelnde Frau, die beste Sängerin der Familie, würde sich Sorgen machen und Todesängste ausstehen, weil Kagari verschwunden war. Inzwischen hatte sie bestimmt schon den ganzen Stamm aufgescheucht.
Das Salz auf ihrem Gesicht brannte in der Sonne, deswegen tauchte Kagari wieder unter. Sie fühlte sich einsam und verloren, wie sie so durchs Wasser glitt; sie wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte. Plötzlich fröstelte sie, so als ob die Sonne kurz hinter einer Wolke verschwunden wäre, aber Wolken bewegten sich nicht so schnell. Als sie weiterschwamm und den Zwischenfall schon fast vergessen hatte, ging ihr auf einmal ein Licht auf. Es war ein Kanu! Ihr Vater war auf der Suche nach ihr! Sie schoss an die Oberfläche, winkte mit den Armen und rief, er möge zurückkommen.
Als aber die Hände nach ihr griffen, um sie in das Kanu zu ziehen, wusste sie, dass es aus mit ihr war. Der Geruch genügte. Die Geistermänner rochen ekelhaft, und ihre brummenden Stimmen waren ohrenbetäubend. Sie kämpfte wieder, biss und trat nach allen Seiten, aber sie waren zu stark. Als sie sie an Bord zogen, fühlte sie einen lähmenden Schlag auf den Hinterkopf. Kraftlos fiel sie zwischen ihnen zu Boden, ein kleines Mädchen, umgeben von Ungeheuern.
Auch wenn die Mannschaft über die Anwesenheit der Kapitänsgattin an Bord schimpfte und murrte, so zollte sie ihr dennoch Respekt. Eigentlich passte ein solches Verhalten gar nicht in diese raue Männerwelt, aber besonders in der Kolonie, wo Frauen Mangelware waren, brüstete sich jeder gerne damit, ein vollkommener Kavalier zu sein. Jeder durchwühlte sein Gedächtnis nach rührseligen Geschichten über seine gute alte Mutter oder Großmutter, die nicht nur eine bemerkenswerte Köchin, sondern auch der Inbegriff von Anstand und Sitte gewesen sein musste.
Augusta Beckmann genoss dank ihres Mannes einiges Ansehen, und als sie mit den Armen fuchtelnd und von einem halb aufgelösten blonden Zopf umweht an Deck geeilt kam, teilten sich die Reihen der Männer, damit die Kapitänsgattin einen Blick auf ihren Fang werfen konnte: ein Mädchen, das nass und glänzend wie eine schlanke schwarze Schildkröte auf den Planken lag.
»Gott im Himmel!«, kreischte sie, entsetzt darüber, dass all die Männer sich über das Mädchen beugten und ihre Nacktheit begafften, ihre kleinen straffen Brüste und das nur im Ansatz vorhandene Schamhaar. »Bringt eine Decke!«, rief sie und ließ sich aufs Deck fallen, um das Mädchen mit ihren Röcken zu bedecken. Sie wartete mit fordernd ausgestreckter Hand, bis einer der Seeleute endlich gehorchte.
Sie hielt ihr Gesicht nah an das des Mädchens, stellte fest, dass sie regelmäßig atmete, und wickelte sie in die Decke. »Die Kleine ist halb ertrunken«, teilte sie der Mannschaft mit.
»Keine Angst, Missus«, meldete sich eine Stimme. »Der geht’s nicht schlecht. Die hat sich gewehrt wie eine Katze, Taffy hat genug Kratzer abbekommen, um das zu beweisen. Wir haben doch nur versucht, sie zu retten, also mussten wir ihr ’nen Klaps auf den Kopf geben, nur ’nen leichten Klaps, um sie ruhigzustellen.«
»Ihr hättet sie umbringen können«, empörte sich Mrs. Beckmann. Sie überprüfte, ob die Decke auch an Ort und Stelle war, und wandte sich dann an ihren Mann. »Otto, du und ich, wir werden das Mädchen hinunter in unsere Kabine tragen.«
»Ja, natürlich«, entgegnete er, aber er konnte das Mädchen auch ohne ihre Hilfe aufheben.
Als der Kapitän außer Hörweite war, knurrte einer der Männer: »Wozu die Mühe? Sie ist eine von diesen verfluchten Wilden, die unsere Kameraden umgebracht haben. Ich meine, wir sollten sie wieder ins Wasser werfen. Verfüttern wir sie doch an die Haie.«
Edmund war entsetzt. »Sie ist doch nur ein Mädchen. Das kannst du nicht machen.«
»Kleine Kätzchen können sich in menschenfressende Bestien verwandeln. Sie gehört zu diesen Mördern. Was sagst du, Billy? Dich hätten sie ja auch beinahe erwischt.«
Billy Kemp hatte sich bewusst im Hintergrund gehalten. An diesem Tag jagte ein entsetzliches Ereignis das andere. Er hatte in ihr das Mädchen wiedererkannt, das er und George zu fangen versucht hatten, er wollte sie nicht an Bord haben. Sie hatte die ganze Zeit im Wasser überlebt, also sollte man sie doch dort lassen. »Ich sage, wir wollen dieses Weibsstück nicht! Auge um Auge! Werfen wir sie doch über Bord.« Jesus, wenn sie auf ihn zukommen und auf ihn zeigen würde, säße er ganz schön in der Patsche. Aber wahrscheinlich sprach sie sowieso kein Englisch. Hoffte er wenigstens. Einige dieser verfluchten Schwarzen konnten Pidgin.
Dutchy baute sich vor ihm auf. »Sie hat dir doch überhaupt nichts getan.« Er wandte sich an die anderen. »Ihr würdet sie kaltblütig ertränken, ihr seid nicht besser als diese Wilden. Der Käpt’n weiß schon, was er tut.« Er nahm Billy am Arm und zog ihn von den anderen weg. »Du schaust das kleine Mädchen an, als hättest du ein Gespenst gesehen, Kemp.«
»Ach was.« Billy versuchte zu grinsen. »Ist doch ein tolles Weibsstück, oder, Kumpel?«
»Sag nicht Kumpel zu mir«, knurrte Dutchy. »Was hat George eigentlich bei sich getragen, als er den Strand heraufgekommen ist? Ich habe gesehen, wie er etwas weggeworfen hat.«
O Gott. Dieser Bastard hatte wirklich Adleraugen. »Woher soll ich das wissen?«
»Warum solltest du das eigentlich nicht wissen? Es gab doch sonst nichts zu sehen, oder? Ich zum Beispiel beobachte die ganze Zeit. Beim Rudern hab ich die Kratzer an deinen Armen und deinem Nacken gesehen. Auf dem Weg hin hattest du die noch nicht.« Er packte Billys Arm und drehte die Innenseite nach außen. »Frische Kratzer, genau wie bei Taffy.«
»Das ist nichts«, winselte Billy. »Hör auf, du tust mir weh.«
»Dann hör mir gut zu, du Mistkerl. Wenn du das Mädchen anrührst oder noch ein Wort sagst …«
»Was willst du machen?« Billy spuckte vor ihm aus. »Zum Käpt’n gehn und ihm eine neue Geschichte erzählen?«
»O nein. Das wäre zu einfach. Wenn du dich nicht zurückhältst, gehst du eines Nachts über Bord. Verstanden?«
Er stieß Billy beiseite und schritt davon.
»Du bist verrückt, Dutchy, weißt du das?«, rief Billy ihm nach.
»Hey, Billy.« Gaunt, der Kajütenjunge, war zu ihm getreten. »Ich hab sie zuerst gesehen, da im Wasser. Ich hab sie entdeckt.«
»Schön für dich«, erwiderte Billy bissig.
Das Mädchen schlug die Augen auf und stieß einen gequälten Schrei aus, der in der Kabine widerhallte.
Gussie drückte sie fest in die Koje zurück und legte ihr zwei Finger auf die Lippen. »Schsch. Ruhig.« Und sogleich war das Mädchen still.
Otto reichte seiner Frau einen Wasserkrug, und Gussie versuchte das Mädchen zum Trinken zu bewegen. »Komm, Kleine, hier ist Wasser. Du musst was trinken.«
Aber ihre Patientin wehrte sich und verschüttete dabei alles. Gelassen nahm Gussie ein kleines Handtuch, tauchte es ins Wasser, presste es gegen die trockenen Lippen des Mädchens und ließ ein paar Tropfen in ihren Mund rinnen. Erfreut sah sie, dass das Mädchen an dem Tuch zu saugen begann.
Während Gussie leise und beruhigend auf das Mädchen einredete, badete sie ihr Gesicht und legte ein feuchtes, kühlendes Tuch auf ihre Stirn.
»Sieh dir die Haare an«, sagte sie und schob die schwarzen verfilzten Locken beiseite. »Die sind noch nie mit einem Kamm in Berührung gekommen.«
Beckmann lachte. »Was erwartest du denn, Mutter? Sie ist eine Wilde. Genauso wenig gezähmt wie ihr Haar, also pass besser auf. Wenn sie wieder zu sich kommt, schlägt sie vielleicht nach dir.«
Gussie ließ ihre Muskeln spielen und grinste. »Ich werde mich gegen so ein Fliegengewicht schon zu behaupten wissen.«
»Du hältst sie besser fest. Wenn sie dir entkommt, springt sie vielleicht über Bord, und wir können sie nicht aufhalten.« Das Mädchen rieb sich krampfhaft die Augen. »Sie müssen vom Salz brennen«, bemerkte er.
»Was hat sie so weit da draußen gemacht?«, fragte Gussie beinahe entrüstet, so als ob die Eltern ihre Pflicht vernachlässigt hätten. »Vielleicht war sie schwimmen und ist mit der Flut hinausgetrieben worden. Der Fluss ist ja ziemlich groß. Sobald sie sich erholt hat, muss ich einen sicheren Platz finden, um sie wieder an Land zu bringen.«
»Wie wird sie wieder nach Hause finden?«
»Die Eingeborenen kennen ihr Land, ich will sie ja nicht mitten in Sydney absetzen.«
Gussie betrachtete das ebenmäßige, dunkle Gesicht. »Sie ist wahrscheinlich nicht älter als elf oder zwölf. Es könnte gefährlich für sie sein.«
»Aber das ist alles, was ich tun kann«, sagte Otto. »Sie kann von Glück sagen, dass wir sie aufgelesen haben. Gaunt soll ihr etwas Suppe bringen.«
»Ja, Suppe ist gut«, antwortete Gussie. Das Mädchen zitterte wie ein ängstlicher junger Hund, und so streichelte sie die Kleine und versuchte, ihr Haar zu trocknen, wurde jedoch erneut zurückgestoßen.
Die ganze Nacht saß Augusta bei dem Mädchen und bemühte sich, sie im Bett zu halten. Es machte ihr nichts aus, dass die Kleine in ihrer Angst das Bett nass machte. Sie ersetzte die nassen Decken durch frische und bewachte ihre Patientin, die sich im Schlaf unruhig hin und her warf und in einer fremden, kehligen Sprache aufschrie.
Augusta war froh, sich in diesem schwimmenden Haushalt doch noch nützlich machen zu können. Sie hatte bald herausgefunden, dass die Mannschaft gegen ihre Anwesenheit an Bord war, obwohl sie es Otto gegenüber nicht erwähnt hatte, und durch ihre Seekrankheit war sie keine Hilfe, sondern nur eine Last gewesen. Gussie hatte gehofft, in der Küche helfen zu können, denn sie war eine ausgezeichnete Köchin, aber sogar das war ihr verwehrt worden. An den wenigen Tagen, an denen sie sich wohlgefühlt hatte, war sie zur Kombüse gegangen, um ihre Hilfe anzubieten, war jedoch auf den erbitterten Widerstand des Kochs gestoßen. Und dann hatte Otto sie freundlich aber bestimmt gebeten, sich nicht einzumischen. Auf der White Rose war kein Platz für sie, das wusste sie nun, aber sie fürchtete sich davor, in das einsame Haus in Brisbane zurückzukehren. Otto hatte ein hübsches Häuschen in der Charlotte Street gekauft, nicht weit vom Fluss entfernt, und Augusta hatte sich auf ihr neues Zuhause gefreut, aber nichts war so gewesen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ihre Nachbarn waren, gelinde gesagt, Trunkenbolde und ziemlich gewöhnlich. Aber die Frauen waren mit Abstand am schlimmsten. Es machte ihnen nichts aus, im Schmutz zu leben, und sie beschimpften die deutsche Frau, die so stolz auf ihren Haushalt war. Gerne hätte Gussie Gemüse und Blumen auf dem mit Gestrüpp überwachsenen Gelände hinter dem Haus angepflanzt, aber auch diese Hoffnung war zunichtegemacht worden.
Augusta war an harte Arbeit gewöhnt, und so hatte sie eines Tages die Ärmel hochgekrempelt und sich mit Hacke und Schaufel darangemacht, das dichte Unterholz zu lichten. Zufrieden blickte sie am Ende des ersten Tages auf ihre Arbeit. Nach ungefähr einer Woche würde sie es geschafft haben, dann würde sie den Abfall verbrennen und die Asche unter die ausgelaugte Erde mischen.
Am zweiten Tag rannten auf ihre Schreie die Nachbarn herbei, wenn auch nur aus Neugier. Als Augusta gerade einem hartnäckigen Farnbüschel zuleibe gerückt war, hatte sie zwei riesige Schlangen aufgeschreckt. Eine hatte sich sogar mit drohendem Zischen bis in Taillenhöhe aufgerichtet; sie züngelte mit ihrer kleinen bösen Zunge und stieß den Kopf zum Angriff nach vorne. Entsetzt war Augusta geflohen.
Keiner der Nachbarn hatte Lust, nach den Schlangen zu suchen. »Man weiß nie, wie viele da noch drin sind!«, sagten sie und empfahlen sich.
»Sie verschließen besser die Hintertür«, sagte eine Frau lachend. »Die kommen auch ins Haus.«
Augusta wusste, dass die Frau sie nur quälen wollte, aber sie konnte die Möglichkeit auch nicht ausschließen. Schlangen machten ihr Angst, verursachten ihr Albträume. Sie konnte bis zu einem gewissen Maß mit den Taranteln auskommen, seit ihr jemand erzählt hatte, dass sich diese großen, haarigen Spinnen von Moskitos ernährten, und auch mit den Ameisen, Kakerlaken und winzigen Echsen konnte sie leben. Aber mit Schlangen? Niemals.