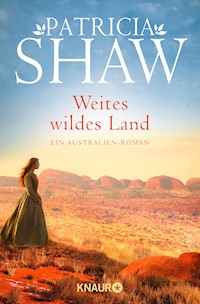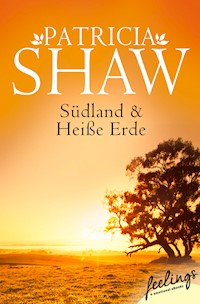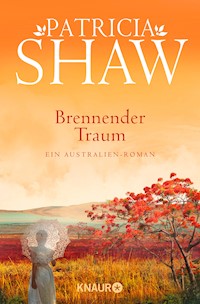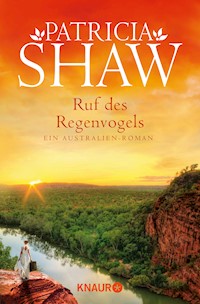
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Australien mit seinen eindrucksvollen Landschaften, mit seiner strahlenden Sonne - ein Land, in dem man es zum reichen Plantagenbesitzer bringen kann. So einfach jedenfalls hatte sich das Corby Morgan vorgestellt und England voller Zuversicht verlassen. Doch er muss einen steinigen Weg ins Ungewisse gehen. Auch Jessie, seine Frau, hat es nicht leicht. Das Leben mit Corby ist alles andere als idyllisch, und ihre Schwester Sylvia, die ein Auge auf ihn geworfen hat, ist für sie keine Hilfe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Patricia Shaw
Ruf des Regenvogels
Roman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
Über den grauen Straßen hing ein dunkler, finsterer Himmel, rußiger Schneeregen fegte über die eilende Menschenmenge hinweg und ließ die Londoner, die ihre Ohren gegen die beißende Kälte verpackt hatten, eiligst schützende Unterstände aufsuchen.
Corby Morgan schlitterte über das schmierige Pflaster und kämpfte mit seinem Regenschirm. Er war verärgert, dass er keine Pferdedroschke gefunden hatte, fürchtete zu spät zu kommen und wusste, dass sein Vater die Tür öffnen und sagen würde: »Wie immer zu spät, Corby!«
Als er um eine Ecke bog, hinein in eine heftige Windböe, blähte sich sein Schirm nach außen, zersprungene Stangen und schwarzes Tuch flatterten und schlugen wie eine übel zugerichtete Krähe. Während er versuchte, den Schirm wieder zusammenzulegen, grinsten abgehärmte Gesichter und freuten sich an seiner misslichen Lage, als sei er ein zu ihrem Vergnügen bestellter Spaßmacher. Corby errötete vor Verlegenheit. Er warf das nutzlose Gerät weg, mit grimmiger Befriedigung nahm er wahr, dass es zur Strafe unter den Rädern einer Kutsche zermalmt wurde. Ihm war kalt, er fühlte sich schlecht und durchnässt überquerte er die Straße zur Luton Street, auf dem Weg zum wichtigsten Treffen seines Lebens.
Corby Morgan, so sagte man, war nichts weiter als ein Träumer, einer jener desillusionierten jungen Engländer, die sich nach der sonnenüberfluteten, romantischen Lieblichkeit der Südsee sehnten, nach Utopia – ein Wahn, der offenbar viele von diesen verdorbenen Cambridge-Absolventen ergriff, für die das Gras immer irgendwo anders grüner war, sei es nun in Italien, Spanien oder, wie in seinem Fall, im Südpazifik. Genauer: in einer tropischen Idylle namens Trinity Bay.
Aber das stimmte nicht. Er biss die Zähne zusammen und bahnte sich seinen Weg. Er und Roger McLiver hatten diesen Schritt mit größter Sorgfalt vorbereitet und geplant. Sie hatten nicht die Absicht, ihr Leben und ihre Investitionen an einem öden Strand zu vergeuden. Sie hatten einen Ort gesucht, wo sie Geld verdienen und das gefällige Leben eines Gentlemans genießen konnten. Und, bei Gott, sie hatten ihn gefunden! Corby erinnerte sich noch gut an ihren Jubel, als Roger mit dem Zeitungsausschnitt der Times zu ihm kam. Genau das war es, wonach sie gesucht hatten! Sie waren so aufgeregt, dass sie zwei Flaschen Champagner tranken, bevor sie eine Antwort verfassten. Und selbst dann waren sie vorsichtig, vernichteten den ersten Brief und bekundeten in einem zweiten lediglich ihr Interesse, statt sich von ihrem Enthusiasmus mitreißen zu lassen, was den Besitzer nur zu einem höheren Preis und Betrügereien veranlassen konnte.
Mit derselben Vorsicht hatten sie dann die angebotene Zuckerplantage in der Trinity Bay im Norden von Queensland, im fernen Australien, gekauft. Obwohl keiner von ihnen die Antipoden jemals gesehen hatte, konnten sie durch informierte Bankleute telegrafisch Näheres in Erfahrung bringen. Man antwortete ihnen, dass Providence in der Tat eine etablierte Plantage unter renommierter Leitung und mit stabilen Exportzahlen war, nicht eine dieser Gelegenheiten, die von allen möglichen Gaunern angeboten wurden und schnelles Geld versprachen.
Bis gestern war alles unter Kontrolle gewesen. Allmächtiger Gott, er und Jessie hatten bereits gepackt, waren reisefertig, und dann das! Roger, sein Freund, sein Partner, hatte sein Wort gebrochen! Hatte ihn fallen gelassen.
»Zum Teufel mit seinen Gründen!«, murmelte Corby, während er seine behandschuhten Hände zusammenschlug. »Seine Frau und ihre Familie! Zur Hölle mit ihnen allen! Es wird ihm noch Leid tun. Zuckerplantagen in dieser Gegend werfen eine Menge Geld ab. Ich werde ein reicher Mann sein, während er noch immer in London am Rockzipfel seiner Frau hängen wird. Wenigstens unterstützt mich Jessie«, seufzte er. »Meine Frau hat genügend Verstand, um sich diese goldene Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Ich werde nicht aufgeben.«
Das war ein beunruhigender Gedanke. Er hatte keine andere Möglichkeit. Er hatte Abschied genommen, die Wohnung gekündigt, den Agenten bezahlt und den Vertrag unterzeichnet. Rogers Anteil am Unternehmen hatte genau die Hälfte betragen. Da Corbys Mittel für den Kauf aufgewendet worden waren, wurde die andere Hälfte nun dringend für die Überfahrt, den Transport der Güter und für erste geschäftliche Ausgaben benötigt. Man hörte oft genug, dass Gentlemen Unternehmen erwarben und innerhalb weniger Monate scheiterten, weil ihnen Kapital für unvorhergesehene Aufwendungen fehlte. Corby hatte sichergestellt, dass ihm das nicht passierte. Sie besaßen nun die Plantage und er hatte sich auf Rogers Investition verlassen, um finanziell bis zur nächsten Ernte über die Runden zu kommen. Aber nun war der Eigentümer von Providence völlig blank! Welch ein Abgang für Mr. und Mrs. Corby Morgan, Besitzer eines riesigen Anwesens, wenn sie die drei Monate nach Trinity Bay auf dem Zwischendeck verbringen sollten.
»Das Fell zieh ich ihm über die Ohren!«, stieß Corby hervor. Sein Gesicht war nass vom Regen. »Sir!«, rief eine Dame, die ihm entgegenkam, schockiert und stieß ihn zur Seite.
»Und Ihnen auch!«, gab er zurück. Verdammt! Er hatte über Wichtigeres nachzudenken als diese hochnäsigen Damen. Wochenlang hatte er sich Sorgen gemacht, weil Roger seinen Anteil nicht aufbrachte, und den Freund bei seinem Vater dafür entschuldigt. »Er wird es aufbringen. Man kann sich auf ihn verlassen, es gibt nur einige Verzögerung bei der Überweisung der Mittel.«
»Scheint mir eher eine Verzögerung seitens der Gattin zu sein, die nicht recht mitzieht«, hatte Colonel Chester Morgan gegrummelt.
»Sie hat nichts damit zu tun.«
»Oho, mein Junge! Unterschätze die kleine Frau nicht. Du hättest sein Geld auf der Bank haben sollen, bevor du deines über Bord geworfen hast.«
»Ich habe es nicht über Bord geworfen. Mir gehört das Anwesen, und Eure Moralpredigten brauche ich nicht. Ich weiß, was ich tue.«
»Wenn du so genau weißt, was du tust, und scharf auf einen Bauernhof bist, dann hättest du diese Schaffarm in Surrey kaufen sollen.«
»Eine Plantage ist kein Bauernhof, Sir.«
»Es ist das Gleiche. Man bestellt die Erde, ist auf das Wetter angewiesen und von Bediensteten abhängig, die heutzutage nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist.«
Verzweifelt hatte es Corby seinem Vater zu erklären versucht: »Das ist das Schöne an meiner Plantage. Sie liegt in den Tropen, es gibt also keine Probleme mit dem Wetter, mit Frost und Schnee – in den Tropen ist das Wetter immer gleich. Und auf den Feldern arbeiten Eingeborene zu ihrem eigenen Unterhalt. Weiße können in dem Klima nicht arbeiten. Australien besitzt eine große Eingeborenenpopulation, die zur Arbeit wie geschaffen ist.«
»Wenn sie dir nicht einen Speer in den Leib jagen.«
»Sir, ich möchte mit Euch nicht streiten«, hatte Corby schließlich gesagt, »aber ich will noch einmal darauf hinweisen, dass Providence nur eine von vielen Zuckerplantagen in Queensland ist, die alle mit hervorragenden Ergebnissen Eingeborene beschäftigen.«
Und nun … stand Corby im Begriff, seinen Vater um Hilfe zu bitten. An wen sonst konnte er sich wenden? Er hoffte, dass Jessie rechtzeitig gekommen war. Der Colonel mochte sie, sie kamen gut miteinander aus. Corby hatte ihr die Aufgabe übertragen, ihm von Rogers Rückzug zu berichten.
Corby litt bereits jetzt unter der anstehenden Demütigung. Es war leichter, wenn ihm Jessie das Terrain bereitete. In der Zwischenzeit hatte er versucht, Freunde zur Teilnahme an dem Unternehmen zu überreden. Er blieb nicht ohne enthusiastische Reaktionen, aber keiner von ihnen besaß das notwendige Geld. Niemals würde er Roger seinen Verrat verzeihen. Niemals!
Als er den Salon betrat, stand sein Vater am prasselnden Kamin, in der Hand ein Glas Brandy, und grinste wie eine Cheshire-Katze. »Wie immer zu spät, Corby.«
Jessie kam besorgt auf ihn zu und nahm ihm den Mantel ab.
»Liebling, du frierst ja. Komm ans Feuer, sonst holst du dir noch den Tod.«
»Unannehmlichkeiten«, intonierte eine Stimme aus dem tiefen Lehnstuhl. »Immer Unannehmlichkeiten.«
Jessies Vater! Lucas Langley! »Was macht er hier?«, flüsterte er seiner Frau zu. Ihr bärtiger, exzentrischer alter Vater war der Letzte, den er jetzt brauchen konnte. Chester Morgan konnte ihn nicht ausstehen. Er, der zackige pensionierte Offizier mit seinem Schatz an ehernen Überzeugungen, hatte nicht viel übrig für Professor Langley, der, wenn er etwas zu sagen hatte, immer anderer Meinung war. Corby hegte keine Abneigung gegen den alten Mann; er war ihm schlicht gleichgültig. Nur jetzt nicht, da er als störendes Element Corbys Chancen, dem Colonel die so dringend benötigten Gelder zu entlocken, nur schmälerte. Widerwillig warf er seinem Schwiegervater einen Gruß hin und wandte sich dann an Chester und die zu erwartende Bußpredigt.
Sein Vater enttäuschte ihn nicht. »Schwierigkeiten mit euch jungen Kerlen, die ihr glaubt alles zu wissen.«
Corby ignorierte die Eröffnung und schenkte sich einen Brandy ein, um die notwendige Demütigung besser ertragen zu können. Er würde betteln, wenn es denn sein musste, aber bis er dieses Stadium erreichte, bedurfte es noch einiger vernichtender Kommentare. Im Augenblick hasste er seinen Vater. Er hasste ihn und sein dank des Familienvermögens und einer unbedeutenden Karriere in der Armee verhätscheltes und selbstzufriedenes Leben.
Der Colonel hatte sich niemals um Geld kümmern müssen. Er ließ es sich gut gehen, besaß diese Wohnung in der Stadt, einen angenehmen Landsitz und seinen gottverdammten Club. Sein Sohn hatte eine kleine Erbschaft von einem Onkel erhalten, deren Reste für Providence aufgebraucht worden waren. Corby hatte Chester immer bitten müssen, wenn er Geld brauchte; niemals hatte er freiwillig einen Penny herausgerückt – schließlich würde sein Sohn sowieso alles erben, wie er behauptete. Oder das, was davon noch übrig war, wie er gerne hinzufügte.
Corby fürchtete, sein Vater könnte hundert Jahre alt werden und ihm nur Rechnungen und Schulden hinterlassen.
»Es war ein schwerer Schlag für mich«, sagte er traurig. »Kaum zu glauben, dass ein Gentleman wie er mich so hängen lässt. Roger hat meine Pläne zunichte gemacht.«
»Ach ja.« Chester lächelte affektiert. »Du hast immer die Schuld anderen zugeschoben. Immer der andere. Niemals du selbst. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst ihn festnageln? Hab ich dich nicht schon vor einem Monat gewarnt, dass du dich nicht auf ihn verlassen kannst, dass er schon beim ersten Kanonendonner in Deckung gehen wird? Aber hast du auf mich gehört? O nein! Und nun hat dich dein Kumpel verlassen, und du stehst mit einer Plantage da, die wahrscheinlich keinen Fingerhut wert ist und hast kein Geld, um sie zu betreiben. Hast du überhaupt noch etwas, oder hast du alles den Antipoden in den Rachen geschmissen?«
»Ich habe etwas Geld, Sir.«
»Heraus mit der Sprache. Wie viel? Auf den Penny.«
»Wir haben etwas Geld«, sagte Jessie ruhig. »Ich besitze zweihundert Pfund als Notgroschen.«
Chesters Monokel strahlte. Er genoss seine Position. »Ah, schön. Das bringt euch wahrscheinlich um das Kap nach Tasmanien und vielleicht nach Sydney. Und was dann? Habt ihr vor den Rest des Weges zu Fuß zu gehen?«
Der Professor fuhr mit seinem Pfeifenkopf durch die Luft und verkündete: »Vom Kap über den Indischen Ozean zur Torresstraße und dann nach Süden zur Trinity Bay.«
»Was ist das?«, fragte Chester herausfordernd.
»Ihre Route«, murmelte Lucas. »Die Zuckerroute.«
»Nun, wie auch immer«, tat ihn Chester ab. »Es ändert nichts an der Tatsache, dass du dich hast übers Ohr hauen lassen, Corby. Du kannst dir das Unternehmen nicht leisten, sag also dem Agenten, er soll die Plantage schleunigst verkaufen und dann rechne deine Verluste ab.«
»Nein«, sagte Corby und versuchte ruhig zu bleiben. »Ich kann es mir nicht leisten, mir diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Ihr könnt es Euch leisten, Vater. Warum wollt Ihr nicht als mein Partner einsteigen? Ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich.« Das war der Satz, auf den sich sein Vater stürzen würde, aber er hatte keine andere Wahl.
»So. Jetzt brauchst du also für dein verrücktes Projekt mein Geld. Warum sollte ich meinen Sohn darin unterstützen, sich in der Südsee auf die faule Haut zu legen? Denn so enden sie doch alle.«
»Ihr bringt da einiges durcheinander«, rief Corby. »Das ist nicht die Südsee. Es ist eine zivilisierte britische Gemeinschaft.«
»Zivilisiert? Ich nenne sie dekadent. Ich weiß, worauf du aus bist. Du wolltest noch nie arbeiten.«
»Aber Ihr?«
»Ich habe mich immer der Disziplin untergeordnet. Ich kann dich förmlich vor mir sehen, wie du mit einem weißen Hut auf dem Kopf in einer Hängematte liegst und deine Aborigines anbrüllst.«
Der Professor schaute auf und blinzelte. »Auf den Plantagen in Queensland gibt es keine Aborigines die arbeiten. Überhaupt nicht.«
Corby und sein Vater blickten sich an. Hier zumindest stimmten sie überein. Der alte Gentleman war senil, er wusste nicht, wovon er redete. Jeder wusste doch, dass auf den Plantagen die Eingeborenen arbeiteten.
Jessie kam Lucas zu Hilfe. »Es ist spät, Vater. Wir bringen dich bald nach Hause.«
Corby holte tief Luft. »Ich bitte Euch, Colonel, lehnt nicht ab. Ich bin so nahe dran. Ich brauche mindestens zweitausend Pfund. Roger wollte dreitausend aufbringen, aber zweitausend reichen. Ich weiß es. Ich biete Euch eine fünfzigprozentige Beteiligung für ein Drittel weniger, als Roger zahlen wollte.«
»Billiges Geld gibt es nicht«, erwiderte Chester. »Nur verzweifeltes. Und verzweifelte Investitionen sind gefährlich. Nein, deine Mutter und ich müssen leben, wir können es uns nicht leisten, unser gutes Geld zum Fenster hinauszuwerfen.«
»Wie könnt Ihr mich ablehnen?«, schrie Corby. »Ihr bringt mich um! Ich verliere alles!«
»Dann hättest du besser auf mich hören sollen. Beende dieses Schlamassel und dann helfe ich dir vielleicht mit der Schaffarm.«
»Ich will diese verdammte Schaffarm nicht!«
Der Professor zog an Jessies Ärmel. »Sag deinem Ehemann, dass wir investieren.«
»Wir?«, fragte sie verwirrt.
»Ja.« Er lächelte und befeuchtete seine rosafarbenen Lippen. »Wir übernehmen zu dem von ihm genannten Preis die halbe Beteiligung.«
»Aber Vater, das kannst du dir nicht leisten.«
»Ich kann die Summe aufbringen«, flüsterte er.
Jessie war entsetzt; ihr Vater machte sich zum Narren und, schlimmer noch, mischte sich in die Probleme des armen Corby ein. Ein weiteres Beispiel der spontanen Herzlichkeit ihres Vaters, die mehr für sein Gefühl als für seinen Verstand sprach. Es war bekannt, dass er einem Bedürftigen seine Stiefel überließ und dann, ohne sich darüber Gedanken zu machen, in seinen Socken nach Hause kam. Eine Zeit lang hatte er Wilderer zum Sonntagsessen eingeladen. Es stand nicht zu erwarten, dass er als Botaniker Corbys finanzielle Transaktionen begriff, aber es war nett von ihm das Angebot zu machen. »Keine Sorge, Vater, Corby wird es schon hinkriegen.«
Seine Augen waren traurig. »Ich bin noch nicht tot, Jessie. Aber seit dem Tod deiner Mutter scheint mich jeder abgeschrieben zu haben. Sie setzen mich in Stühle, die nach Westen zeigen, und alle warten auf meinen Sonnenuntergang. Sieh, das ist auch meine Chance.«
Jessie empfand Schuldgefühle. Sie wusste, dass ihre achtzehnjährige Schwester Sylvia sich nur ungern um ihren Vater kümmerte, seitdem Jessie das Zuhause verlassen hatte. Sylvia konnte kalt und hart mit ihm sein, aber als verheiratete Frau konnte Jessie wenig dagegen tun – hin und wieder konnte sie Sylvia vorsichtig zu verstehen geben, ein wenig mehr Geduld mit ihm aufzubringen; Kommentare, die allerdings wenig geschätzt wurden und die Situation wahrscheinlich nur verschlimmerten. Er wurde lebhafter. »Sag es ihnen!«, insistierte er. »Das ist meine Chance, Australien zu sehen. Ein neues Leben zu beginnen.«
»Du willst mitkommen?« Jessie war erstaunt.
»Ich hatte gehofft, dass du mich fragst, aber jetzt kann ich mich einkaufen. Ich werde gebraucht. Es gehört kein mathematisches Genie dazu sich auf diesen Handel einzulassen. Sag ihm, dass wir das Angebot annehmen.«
Jessie zögerte noch immer. Aus ihm sprach der Brandy. Aber als der Konflikt zwischen Corby und dem Colonel in eine drückende Stille mündete, griff er ein. »Mr. Jess«, sagte er – eine Bezeichnung, die ihren Ehemann aufbrachte –, »kann ich mit Ihnen einige Worte wechseln?«
Bestürzt war Corby gezwungen seinen Schwiegervater als Partner zu akzeptieren. Und dies im Angesicht des Colonels und seines amüsierten Spottes: für Chester Beweis genug, dass sein Sohn den letzten Strohhalm ergriff um sich nur tiefer in den Bankrott zu stürzen. Auch Corby war verärgert, dass Lucas, der alte Schurke, die Situation ausgenutzt hatte. Es zeugte von verdammt schlechten Manieren sich in eine private Unterhaltung einzumischen und dann die gleichen Bedingungen und mehr zu fordern. Wäre es Corby gelungen seinen Vater zu überreden, dann wäre er als stiller Teilhaber in England geblieben. Nun überließ er dem alten Trottel halb Providence zu einem niedrigen Preis, und er hatte auch noch vor mitzukommen. Wenn, dann war er nur ein weiteres Maul, das durchgefüttert werden musste; Corby hatte bereits beschlossen, sich jede Einmischung seitens des Professors zu verbitten.
Sobald es ihm möglich war, setzte er Jessie und ihren Vater in eine Droschke und schickte sie fort um sich und seine Gedanken zu sammeln.
Eine warme, laute Taverne bot ihm Zuflucht. Er fand eine schummrige Ecke, nach einigen Gläsern milderte sich seine Mutlosigkeit. Vielleicht war es möglich, dass Jessie den alten Jungen dazu überreden konnte das Richtige zu tun. Wenn er zweitausend auftreiben konnte, dann konnte er auch dreitausend aufbringen und den vollen Preis zahlen – wie es sich für einen Gentleman gehörte. Ja, das musste möglich sein. Aber da war noch diese andere Sorge. Corby war verärgert über Rogers Rückzug, aber es machte ihn auch sehr nervös alleine zu reisen. Er hatte sich auf die Erfahrung seines Freundes verlassen, der zuletzt das große Anwesen seines Onkels im Norden verwaltet hatte. Corby hatte in dieser Hinsicht mit nichts anderem zu tun gehabt als einem Ententeich. Schon gut, dass ihm Roger seine Notizen und Bücher über Zuckeranbau gegeben hatte – gute Lektüre für die Reise, hatte er gesagt. Aber das war nicht der Punkt. Tief im Inneren hatte Corby gehofft das Leben eines Gentlemans und Plantagenbesitzers zu genießen und Roger alle Entscheidungen zu überlassen. Nun aber lastete alle Verantwortung auf ihm; er spürte, wie sich leise Panik in ihm breit machte.
Als er aus dem King’s Arms herausschwankte, hatte er sich an den Gedanken gewöhnt, dass statt zweier begeisterter Ehepaare sich ein Trio nach Trinity Bay aufmachen würde – er, Jessie und der alte Schmarotzer Lucas Langley. Fast wünschte er sich, die beiden zurücklassen zu können. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, dass ihm wieder ein Elternteil über die Schultern blickte, nun, da er endlich dem abschätzigen Blick des Colonels entkommen war.
Aber das war nicht alles. Er hatte auch Sylvia vergessen. Nicht, dass sie sich bereitwillig auf die Reise begeben hätte.
»Ich kann nicht glauben, dass du mir das erzählst«, schrie sie Jessie an. »Du hast Vater dazu gebracht euch sein Geld zu geben, um deinem Mann aus der Klemme zu helfen!«
»So war es nicht«, sagte Jessie. »Er will mitkommen. Es ist wichtig für ihn.«
»Ach ja? Und was soll mit mir geschehen? Jeden Penny, den er hat, steckt er in diesen Wahnsinn. Wo soll ich wohnen, wenn er das Haus verkauft?«
Jessie versuchte sie zu beruhigen. »Nimm es dir nicht so zu Herzen, Sylvia. Du glaubst doch nicht, dass wir ohne dich fahren? Stell dir nur vor, was alles vor uns liegt … eine wundervolle Seereise und dann unser eigenes Anwesen in einem schönen Klima. Du wirst es wunderbar finden.«
Dieser Gedanke war Sylvia noch nicht gekommen. »Du willst, dass ich mitkomme? Dass ich London verlasse und in der Wildnis lebe?« Sie brach in Tränen aus. »Ich habe immer gesagt, dass du der egoistischste Mensch auf der Welt bist, und nun weiß ich, dass ich Recht hatte. Du würdest alles tun, wenn es nur in deinen Kram passt. Ich werde nicht mitkommen! Nein!«
»Ich fürchte, du hast keine andere Wahl«, sagte Jessie ruhig. »Es tut mir wirklich Leid, dass dich das alles so trifft. Aber versuch doch, die positive Seite zu sehen. Es wird dir gut gehen, und Corby sagt, dass wir viel Geld verdienen werden. Du kannst immer wieder auf Besuch hierher zurückkommen, und außerdem weißt du noch gar nicht, wen wir auf unserer Reise alles kennen lernen werden.«
»Ich weiß, was ich kennen lernen werde. Schwarze und Schlangen.« Sylvia weinte heftig. »Ich werde nicht zulassen, dass du mein Leben ruinierst. Vater muss wieder zur Besinnung kommen. Er ist zu alt für so was!«
Sylvias Flehen und Betteln war umsonst. Der Professor nahm kaum Notiz von ihr, außer dass er ihr auftrug, Moskitonetze mit in die Seekisten zu packen. Er war viel zu sehr damit beschäftigt seine Bücher zu sortieren und Listen anzulegen; für ihn war das alles eine faszinierende botanische Exkursion.
Enttäuscht machte sich Sylvia ans Packen, widersetzte sich Jessies Angebot, ihr zu helfen, und am Tag der Abreise ging sie mit ihnen an Bord der Brigg Caroline und begab sich unverzüglich in ihre Kabine um zu schmollen. Der Professor, der seinen Kopf kurz hineinsteckte, missdeutete ihre Stimmung völlig. »Ah, mein Mädchen. Ich sehe, du bist gut untergebracht.« Und fort war er um das Schiff zu erkunden.
Für Jessie allerdings war es das aufregendste Ereignis ihres Lebens, ein Tag, den sie niemals vergessen wollte.
Unter ihnen hob und senkte sich die dunkelgrüne See, über ihnen wölbten sich die Segel wie wilde Schwingen, die sie zu einem neuen und wundervollen Leben trugen. Sie klammerte sich an Corbys Arm und betrachtete sein gut geschnittenes Gesicht. Noch immer befand sie sich im Zustand der Euphorie, dass sie dieser Mann, den sie so sehr liebte, geheiratet hatte. Im ersten Jahr ihrer Ehe hatten sie sich Sorgen gemacht, da Corbys Kapital mit alarmierender Geschwindigkeit zusammenschmolz und sie nicht wussten, wie sie überleben sollten. Aber sie hatte Vertrauen in ihn. Jessie konnte seinen Widerwillen verstehen, sich an Handelsgeschäften zu beteiligen und sie verstand seine Weigerung, sich wie ein gewöhnlicher Arbeiter nach Beschäftigung umzusehen. Ewig dankbar war sie, dass er es abgelehnt hatte, in die Armee einzutreten. Sie hatte gewusst, dass er es irgendwie schaffen würde. Und als er und Roger mit dieser wunderbaren Idee der Zuckerplantage nach Hause kamen, hatte Jessie mit ihnen gefeiert. Später in jener Nacht konnte sie dann auch, da ihre Probleme ja nun gelöst waren, Corby ihre Neuigkeiten mitteilen; dass sie ein Kind in sich trug.
Er freute sich. »Schau! Alles fügt sich zusammen. Wir werden unsere Plantage haben, ein großes Anwesen, und einen Sohn, der den Familiennamen weiterträgt.«
»Und wenn es ein Mädchen ist?«
»Nein, du musst einen Sohn haben. Ich habe gehört, wenn du dich nur darauf konzentrierst, dann kannst du das entsprechende Geschlecht hervorbringen.«
Jessie hatte gelacht, obwohl sie wusste, dass er es ernst meinte. Nun, als Wind aufkam und die Segel sich blähten, wickelte sie sich fester in ihren dicken Umhang.
»Wie fühlst du dich?«, fragte er sie.
»Wunderbar.« Sie lächelte. »Einfach wunderbar.«
»Das ist ein guter Anfang. Einige unserer Mitpassagiere sehen bereits ziemlich grün aus. Übrigens habe ich über den Namen unseres Sohnes nachgedacht. Wir werden ihn Bronte nennen. Bronte Wilcox Morgan, nach meinem verstorbenen Onkel.«
»Wie du wünschst, mein Lieber.« Sie küsste ihn. Sie war viel zu glücklich um ihn nun belästigen zu wollen. So waren die Männer, nahm sie an. Immerhin konnte sie nun, nur für den Fall, einen Mädchennamen aussuchen.
2. Kapitel
Der schäbige Hafen von Cairns in der Trinity Bay kam niemals zur Ruhe. Das Äußerste, was er erlaubte, war ein gelegentlicher Schlummer. Und das um drei Uhr nachmittags, wenn sich die Europäer der drückenden Hitze hingaben und die Chinesen, nun vor Anfeindungen geschützt, leise und eilig ihre Besorgungen machten. Aber die Morgendämmerung war wie ein Tollhaus. Beim ersten Anzeichen von Licht begannen die bis dahin in den hohen, weitausladenden Palmkronen verborgenen Vögel zu singen, dann pfiffen die Honigfresser, es erwachte unaufhörliches Gezwitschere, Singvögel fielen mit ihren flötenden Tönen ein, bis, wie ein verrückter Bläserchor, die Papageien einstimmten – alle Arten von Papageien, von den Buntsittichen und Kakadus bis zu den Tausenden bunter Loris – und der Lärmpegel sich zu einem ohrenbetäubenden Kreischen steigerte.
Und das waren nur die Hintergrundgeräusche. Mike Devlin wälzte sich unruhig in seinem Bett in dem völlig zu Unrecht so genannten Palace Hotel. Die Vögel gehörten zum Leben im Norden, er hörte sie kaum noch, aber was er hörte, waren die Schreie und Flüche der nächtlichen Krakeeler, die aus den Bars und Bordellen wankten.
»O Gott«, murmelte er, drehte sich auf die andere Seite, um noch etwas Schlaf zu erhaschen, als Schlägereien ausbrachen, Frauen aufschrien und fluchten und eine zornige Gattin ihren Mann beschimpfte. Pferde schnaubten und wieherten und wirbelten Staub auf, während sie sich in den Straßen aufbäumten, Staub, der die heiße Luft noch mehr verdickte und der sich dem Gestank frischen Pferdedungs und den allgegenwärtigen Ausdünstungen der weitläufigen Mangrovensümpfe von Trinity Bay hinzufügte.
»Ebbe«, kommentierte er grimmig. Der Gestank war noch schlimmer, wenn die schlammigen Abfälle zum Vorschein kamen.
Er hörte einige Schüsse, aber nicht einmal das brachte ihn in Bewegung. Betrunkene, denen der Zeigefinger locker saß, waren nichts Ungewöhnliches in dieser Ecke – Goldschürfer, Seeleute, Viehtreiber und Pflanzer waren raue Menschen. Er fragte sich, ob diese Stadt im Grenzland wohl jemals zur Ruhe kommen würde. Früher oder später musste sie es, ging es ihm durch den Kopf. Providence, die Plantage, die er verwaltete, war von diesem Hafen abhängig.
Der Lärm draußen nahm zu; verschlafen beugte er sich über die Veranda um auf die Straße hinabzublicken. Er war noch immer nicht sonderlich interessiert – es war noch nicht Sonntag. Da Sonntag ihr einziger freier Tag war, kamen Samstagnacht wagenweise Kanaka in die Stadt. Betrunken stellten sie ein wirkliches Problem dar. Meistens gelang es Mike, seine Arbeiter zu überreden zu Hause zu bleiben, aber wenn sie darauf bestanden, die »hellen Lichter« zu besuchen, dann hatte er keine rechtliche Möglichkeit, sie davon abzuhalten. Alles, was er tun konnte, war, Sonntagnacht einen Wagen zu schicken, der die »Leichen« wieder aufsammelte; die meisten der armen Dummköpfe tranken sich bewusstlos.
»Was ist los?«, schrie er den Männern unter ihm zu.
»Ein Aufruhr!«, brüllte einer. »Ein Aufruhr im alten Lagerhaus.«
»Großer Gott!« Er zog hastig seine Kleider an und rannte die wackelige Nebentreppe hinab und zum Kai. Der Schuppen war die erste Station für die neu eingetroffenen Kanaka, hier wurden sie von den Einwanderungsoffizieren registriert und ihre Namen aufgezeichnet. Immer eine verwirrende, manchmal auch lustige Prozedur, denn die wilden Kerle kamen hier zum ersten Mal mit europäischer Kleidung in Berührung: mit Hosen, Hemden, Stiefeln und Hüten. Die meisten von ihnen hatten vorher lediglich einen Lendenschurz getragen, ihr Kampf mit den Kleidern war daher für die Zuschauer und selbst für die fröhlichen Insulaner ein großes Vergnügen. Sogar die Unglücklichen, die entführt worden waren, fanden bei den scheinbar chaotischen Vorgängen einigen Spaß.
Und verwundert starrten sie um sich, wenn sie zum ersten Mal ein Dorf der Weißen erblickten. Alles setzte sie in Erstaunen, besonders die Pferde. Mit einem Dolmetscher an ihrer Seite standen sie aufgereiht und warteten, bis die Beamten sorgfältig Datum und ihren Bestimmungsort notierten. Nach dem Gesetz waren die Pflanzer verpflichtet sie nach genau drei Jahren wieder auf ihre Heimatinseln zurückzuschicken. Die Zeitspanne sorgte oft für Probleme, denn viele der Freiwilligen waren nicht in der Lage zwischen Monden und Jahren zu unterscheiden. Drei Monde fort zu sein war für viele ein Abenteuer, wenn sie aber herausfanden, dass sie sich für drei Jahre verkauft hatten, regten sie sich verständlicherweise auf. Furcht und Verzweiflung waren die gewöhnlichen Reaktionen – niemals aber Aufruhr.
Als Mike sich dem Schuppen, einem ehemaligen Lagerhaus, näherte, schien der plötzliche Aufstand mehr oder weniger niedergeschlagen zu sein. Übel zugerichtete Männer, Seeleute und Beamte wanderten verwirrt am Kai herum, ihre Köpfe und Hemden waren mit Blut bedeckt. Einige Insulaner krümmten sich unter den Schlagstöcken der Polizisten, Blut floss aus Kopfwunden und drei Soldaten bewachten mit Gewehren die Tür des Schuppens. Drinnen hämmerten die Eingeborenen noch immer gegen die Wellblechwände.
»Was zum Teufel ist passiert?«, fragte Mike den Agenten Jock Bell.
»Woher soll ich das wissen«, gab Bell verärgert zurück. Sein vom Whisky gerötetes Gesicht war noch fleckig von der Anstrengung. »Wir haben sie gerade aussortiert, als sie Amok liefen.«
»Haben die Alkohol da drin?«
»Soweit ich weiß, nicht.«
»Es ist Ihre Aufgabe, das zu wissen«, sagte Mike wütend. »Ich habe gestern dreißig von den Jungs angeheuert und erwarte, sie in einem Stück zu bekommen, nicht zerschlagen und durchgeprügelt. Wo ist Captain King?«
»Noch immer an Bord. Hat sich ein Fieber eingefangen.«
Mike stürmte zu einem der Einwanderungsbeamten hinüber. »Was ist los, Charlie?«, rief er ihm durch das Getöse hindurch zu.
Charlie saß schwer auf einer Kiste und rieb sich seinen Nacken. »Einer der verdammten Hunde hat mir einen Schlag verpasst, hätte mir fast das Genick gebrochen.«
»Warum?«
»Keine Ahnung! Sie stellten sich der Reihe nach auf und plötzlich fielen sie über uns her.«
»Wer hat sie Aufstellung nehmen lassen? Bell?«
»Ja, er und einige seiner Kumpel.«
»Seine Jungs mit den Stöcken?«
»Nun ja, du weißt, wie die Nigger sich anstellen. Jock hat ihnen nur ein wenig Zunder gemacht, nicht mehr als sonst auch.«
»Außer, dass es einem nicht gefiel«, sagte Mike. Er sah sich um. »Wo ist Solly Sam?«
Solly Sam war der Dolmetscher, ein Mischling von den Salomonen, der Sohn eines Missionars, wie es hieß, aber das war wahrscheinlich ein Witz. Mike brauchte ihn, um herauszufinden, ob sich unter seinen neu erworbenen Arbeitern ein Hitzkopf befand. Obwohl die Kanaka in ihrer Heimat als Wilde galten, passten sie sich erstaunlich gut der Disziplin in den Zuckerrohrfeldern an; einer der Gründe, warum Pflanzer auf den Fidschis oder in Queensland sich um sie als Arbeitskräfte rissen. Weder die Bewohner der Fidschis noch australische Aborigines wollten auf den Feldern arbeiten, die Letzteren verachteten die Kanaka und nannten sie die »Hunde der weißen Männer«. Um auf Providence den Frieden zu erhalten, wählte Mike seine neuen Arbeiter sorgfältig aus. Unruhestifter konnte er nicht gebrauchen.
Solly Sam hockte auf dem Boden, neben ihm ein halbes Dutzend Eingeborener, die aus dem Gemenge gezogen worden waren. »Verdammt guter Kampf«, grinste er. Er blinzelte Mike zu.
»Verdammt dummer Kampf«, gab Mike zurück. »Wer hat angefangen?«
»Weiß nich’, Boss. Ging zu schnell. Bin ziemlich schnell durch dieses Fenster.«
»Was ist mit denen hier?« Mike zeigte auf die unter Arrest stehenden Insulaner.
»Ah, die wissen nichts.«
Solly Sam sah zu, wie Mr. Devlin zu den Soldaten hinüberging und nach einem lauten Wortwechsel die Erlaubnis erhielt, den Schuppen zu betreten.
»Geben Sie uns aber nicht die Schuld, wenn sie Ihnen den Kopf abreißen«, schrie ihm ein Soldat hinterher, nachdem Mike darauf bestanden hatte ihnen unbewaffnet gegenüberzutreten.
Solly klopfte zwei Eingeborenen auf die Schulter und redete mit ihnen in ihrer Sprache. »Dieser Mann ist Mr. Devlin. Ein starker Mann, guter Boss. Ihr Jungs seid glücklich, ihr geht mit ihm.«
Sie blickten auf; sie sahen erbärmlich aus. Niemand hatte sich um sie gekümmert und ihre Wunden versorgt; in ihrem jetzigen Zustand waren sie alles andere als glücklich. Aber Solly lachte. »Keine Knochen gebrochen. Die Weißen können euch hier nichts tun, ihr seid für sie Geld wert. Aber wenn ihr auf die Plantagen kommt, dann müsst ihr aufpassen. Einige Bosse schlechte Männer. Nicht gut. Verhaltet euch also ruhig, arbeitet hart oder sie erschießen euch und sagen den Häuptlingen, dass ihr an einer Krankheit gestorben seid.«
Der Krach im Schuppen verstummte, bald danach erschien Devlin mit einigen seiner Arbeiter. Solly erkannte manche Freunde, darunter Kwaika und Manasali, der auf den Feldern als Sal bekannt war.
Mike gab Kwaika zu verstehen, Männer von ihrer Insel Malaita aufzurufen. Als die Kanaka aus der fahlen Dunkelheit hervortraten, ging Jock Bell dazwischen. »Was tun Sie hier, Devlin? Nehmen sich wie immer die Besten.«
»Nein, ich trenne sie nur. Der Aufruhr kann von Fehden zwischen den Inseln herrühren. Sagen Sie King, dass ich sie zum Glockenturm bringen werde.«
Solly Sam hörte aufmerksam zu, als die Namen aufgerufen wurden und die Männer von Malaita vortraten. Natürlich wusste er, worum der Streit gegangen war. Die verletzten Insulaner hatten es ihm mit furchtsamen Stimmen erzählt, allerdings hütete er sich, die Informationen weiterzugeben, nicht einmal an Mike Devlin. Solly wusste, warum er sich aus Stammesangelegenheiten heraushielt. Dennoch trieb ihn die Neugierde nach vorne. Er bemerkte, wie Kwaika kurz innehielt, bevor er den Namen »Joseph« rief.
Es gab eine Verzögerung. Keinem der Weißen fiel etwas auf, aber finstere Blicke gingen von einem Insulaner zum anderen, als Joseph vortrat. Dann senkten sich ihre Augen, als wäre nichts Außergewöhnliches geschehen. Solly hielt vor Aufregung den Atem an. Niemals zuvor hatte er einen Gott gesehen. Das war nicht Joseph; das war, so hatte man ihm erzählt, Talua, der Sohn des großen Häuptlings und kürzlich ernannten Gottes Ratasali, der in den Himmel gegangen war, nachdem er seinen Sohn zu seinem Nachfolger gesalbt hatte.
Er war ein prachtvoller junger Mann, prachtvoll selbst noch in dem zu engen Hemd und den zu kurzen Hosen.
Unterwürfig ging Talua mit den anderen – ganz anders als sein stolzer, kriegerischer Vater. Solly wusste nicht, ob Talua nur Possen spielte oder wirklich von sanftmütigerer Natur war. »Aber der Vater wird erscheinen«, sagte er sich. »Ratasali wird einen klugen Gott abgeben. Er wird aufpassen. Und dieser Jock Bell ist ein gezeichneter Mann.«
Weise nickte er und genoss sein Geheimnis. Bell hatte Joseph beim Aufstellen geschlagen! Die Männer von Malaita waren außer sich, dass dieser Weiße es wagte einen Gott zu schlagen. Gewalttätig und spontan brach es aus ihnen heraus. Um Talua zu schützen, griffen sie alle Weißen in ihrer Nähe an. Niemand Bestimmtes konnte für den Angriff verantwortlich gemacht werden, und keiner würde den Grund verraten. Es erfüllte sie mit großem Stolz, dass Talua unter ihnen war, Talua, den sie bereits als ihren Führer anerkannten, als ihren eigenen Gott, der über sie wachte und ihnen in diesem fremden Land Glück brachte.
Und welch ein fremdartiges Land es war! Als man sie vom Kai wegtrieb, versuchten die Jungs, wie man sie nun rief, ihre neue Umgebung zu begreifen, wurden aber von ihrer Kleidung daran gehindert. Sie schwitzten in den rauen Hemden, zupften am Hintern um die Einschnürung dieser Dinger, die man Hosen nannte, zu mildern, und zogen trotz der Warnungen der alten Arbeiter die Stiefel aus, weil sie Blasen hervorriefen.
»Stiefel schützen euch in den Zuckerrohrfeldern«, erzählte man ihnen. »Sie schützen vor den Schlangen.« Aber das alles ergab für sie keinen Sinn. Auch verwirrte sie, dass sie von diesen weißen Männern, dem Boss und den beiden anderen, plötzlich anders behandelt wurden; sie trugen keine Gewehre oder Stöcke, schlenderten neben ihnen her und reichten runde Wasserbeutel aus Leinwand herum.
Während sie im Schatten eines hohen Baumes ruhten, begann das Aufrufen der Namen erneut, diesmal ohne jeglichen Streit. Nahrungsbeutel wurden ausgegeben. Das Essen – Brot mit Fleischstreifen und viele Bananen – war besser als der verschimmelte Reis, den sie auf dem Schiff erhalten hatten.
Als sie in die Wagen kletterten, die sie in ihre neue Heimat, die Plantage Providence, bringen sollten, hatten die Insulaner einiges von ihrer Skepsis verloren, sie waren zufriedener, manche lachten sogar und drängelten sich ausgelassen auf die Wagen.
Die Kutscher der Rollwagen waren Weiße, Plantagenarbeiter, die für diese Aufgabe abgestellt wurden und keineswegs unglücklich waren eine Nacht in der Stadt verbringen zu müssen. »Ich muss in der Stadt bleiben, um die neuen Besitzer zu empfangen«, sagte ihnen Mike. »Die Caroline muss jeden Tag einlaufen. Behaltet die alten Arbeiter, Kwaika und Sal, vorne bei euch, das verleiht ihnen Autorität. Ihr solltet keine Probleme bekommen, aber sorgt dafür, dass ihr den Pferden beim Halfway Creek einige Stunden Ruhe gönnt.«
Erleichtert, dass die Kanaka sich beruhigt hatten, winkte er ihnen nach. Er hatte diesmal dreißig Männer angeheuert, keine Frauen. Einzelne Frauen verursachten zu viele Probleme. Für das halbe Dutzend Kanaka, das ihre Frauen mitgebracht hatte, wurden kleine Ehequartiere errichtet; seither waren sechs Paare die übliche Zahl. Die übrigen Männer wohnten, eine halbe Meile vom Haupthaus entfernt, in langen Baracken, sorgsam getrennt von den Frauen. Die Ehefrauen kochten für alle Männer.
Mike Devlin ging an den vergitterten Fenstern der Bank von New South Wales vorbei und öffnete die schwere Tür. Der Eigentümerwechsel gefiel ihm nicht.
»Ja, Mr. Devlin?«, sprach ihn der Bankangestellte an. Mike überschlug schnell die Kosten. Zweihundertundzehn Pfund für Captain King.
Ein Pfund pro Kopf an die Einwanderungsbehörde für die dreißig Kanaka, dazu zehn Pfund pro Kopf für die Rückfahrt, die treuhänderisch verwaltet wurden um sicherzustellen, dass die Männer nach drei Jahren wieder zurückkehrten. Fünfhundertundvierzig Pfund.
»Geben Sie mir sechshundert«, sagte er zu dem Angestellten und unterschrieb das Abbuchungsformular. Er hatte noch dreihundert Pfund ausstehen, doch das Providence-Konto war ziemlich leer. Erst nach der Ernte konnten sie wieder mit Einnahmen rechnen. Der neue Besitzer, der reiche Engländer, musste das Konto sehr bald auffüllen.
Er steckte das Geld ein, trat hinaus in das gleißende Sonnenlicht und begab sich in die Saloonbar des Victoria Hotels, wo solche Transaktionen durchgeführt zu werden pflegten.
Nun wartete Mike. Die Caroline, die die neuen Eigentümer Mr. und Mrs. Corby Morgan brachte, musste jeden Tag kommen.
Er ging ins Hotel und bestellte sich ein Pint. Und hoffte, dass das verdammte Schiff wie so viele andere auch auf seinem Weg von der Torresstraße auf ein Riff laufen möge.
3. Kapitel
McTavish, Kapitän der Caroline, ging kein Risiko ein. Dank seiner Gewissenhaftigkeit war die Reise ab London von Beginn an ein Bilderbuchunternehmen. Das Schiff befand sich in gutem Zustand, war gut ausgerüstet, die Mannschaft hatte er eigenhändig ausgesucht.
An einem sonnigblauen Tag warf die Caroline am Eingang zum Trinity Inlet Anker, und die Mannschaft brachte auf den Kapitän ein dreifaches Hurra aus.
Bald danach kam der Prahm Bee hinaus, um zuerst einmal Passagiere und Fracht an Land zu bringen. McTavish stand an Deck und verabschiedete seine Gäste.
Corby Morgan, ein widerspenstiger Genosse, gab ihm die Hand. »Gut gemacht, Captain.«
McTavish lächelte. Morgan und seine Frau hatten auf dem Achterdeck eine Einzelkabine, aber selbst diese Position, vier Klassen über dem Zwischendeck, hatte ihn nicht davon abgehalten, herumzukritteln und sich zu beschweren. McTavish verabschiedete sich von Mrs. Morgan, einer angenehmen Frau, und dem alten Professor. Aus vollem Herzen lächelte er jedoch, als er Miss Sylvia Langley zum letzten Mal sah. Sie hatte erst einem seiner Offiziere schöne Augen gemacht und dann ihre Aufmerksamkeit plötzlich auf seinen Ersten Offizier, Lieutenant John Mansfield, gerichtet, was nicht nur zu Zwistigkeiten zwischen den beiden Männern führte, sondern auch unter den Passagieren für einen Skandal sorgte – Mansfield war ein verheirateter Mann. Mit ihren dunklen Locken, den fast kobaltblauen Augen und den langen Wimpern war sie eine sehr attraktive junge Frau, aber sonst von konfuser, ungestümer Natur. Unglücklicherweise hatte sie ihre Kabine mit Mrs. Lita de Flores geteilt, einer erfahrenen, weltklugen jungen Witwe, die zur Plantage ihrer Familie in der Trinity Bay zurückkehrte. Nicht gerade die ideale Gesellschaft für eine leicht empfängliche Miss wie Sylvia.
Aber nun war er sie los. Lita, in Australien geboren, kehrte in ihre Heimat zurück. Aber die Morgans begannen hier in den Tropen ein neues Leben. Gott mag ihnen beistehen, ging es ihm durch den Kopf. Hier waren sie den Gewalten ausgeliefert, den Menschen und der Natur, die sich von ihrer besten und schlimmsten Seite zeigen konnten.
Mike erblickte sie am Ende des Kais, und ihn durchfuhr – als wirkten zwischen ihnen magnetische Kräfte – ein spürbarer Ruck. Sie bemerkte ihn nicht. Über ihrem weiten Kleid trug sie einen Staubmantel, auf dem üppigen Haarknoten einen imposanten Hut; sie starrte hinaus auf das Meer, als wollte sie es nur ungern verlassen. Aber es war die Stille, die sie umgab, welche seine Aufmerksamkeit erregte. Sie strahlte eine Klarheit und Ruhe aus, die in dieser turbulenten Stadt kaum anzutreffen waren.
Nicht ohne Überwindung riss er sich vom Anblick des ruhigen, attraktiven Gesichts los und begab sich zur Menge weiter unten am Kai. Die Passagiere der Caroline wurden angelandet, und inmitten der Neuankömmlinge und den auf sie Wartenden, den Hafenarbeitern, Schaulustigen und chinesischen Trägern, musste er Mr. Morgan finden.
Lita de Flores hängte sich an seinen Arm, als er sich in das Gemenge schob. »Mike, Darling! Wie schön, dich zu sehen! O Gott, was bin ich froh, wieder zu Hause zu sein! Europa ist tödlich. Verdammt kalt. Du hast gehört, dass mein Mann gestorben ist?«
»Ja, tut mir Leid, Lita. Mein Beileid.«
»Nun ja, es war seine Schuld. Er bestand darauf, nach Paris zu fahren um seine Familie zu sehen. Er war schwach auf der Brust. Daddy hatte ihn gewarnt, aber du kennst ja de Flores. Verdammt dickschädelig, er musste seinen Kopf durchsetzen.« Er grinste. Lita, von sich überzeugt, glatt und gewandt, war das damenhafteste Schlitzohr, das ihm jemals begegnet war. »Na, das sagst gerade du«, kommentierte er.
»Ach, hör auf! Ich bin nicht dickköpfig! Darling, ich war vier Monate mit ihm in diesem trübseligen Schweizer Sanatorium, bis zum Ende. Mehr kann niemand verlangen! Und die ganze Zeit hatte ich Angst, dass ich mir die Krankheit ebenfalls einfange. Aber nun muss ich gehen, Daddy wartet schon. Du musst mir versprechen, dass du und Jake sobald wie möglich zu uns nach Helenslea kommt.«
»Jake ist tot.«
Lita trat einen Schritt zurück und starrte ihn an. »Jake? Das kann nicht sein! Oh, wie schrecklich! Auf dem Schiff sagten mir Leute, dass sie von ihm Providence gekauft haben …«
»Von seinem Sohn.Er hatte nie Interesse an Providence.«
»Großer Gott! Und was machst du nun?«
»Ich hoffe, dass ich bleiben kann.«
»Sie müssten verrückt sein, wenn sie dich gehen ließen. Das dort drüben, der Mann in der grauen Jacke und dem Zylinder, ist Corby Morgan. Ein pedantisch fader Mensch. Ich werde ein Wort für dich bei Daddy einlegen, Mike.«
Sie küsste ihn auf die Wange und eilte davon. Ihr weißer Rock bauschte sich im Wind, in dem eleganten Kleid und dem dazu passenden Schirm sah sie kühl und unnahbar aus. Mike lächelte. Für gewöhnlich trug sie Reithosen und Seidenhemden und ritt wie der Teufel über die Plantage; trotz der teuren Internate und ihres zweijährigen Europaaufenthalts war sie immer noch ein wildes Mädchen aus dem Busch.
Nun aber war es an der Zeit den neuen Boss kennen zu lernen. Ruhig ging er zu dem Gentleman hinüber, der besorgt zusah, wie sein Gepäck an Land geworfen wurde. »Mr. Morgan?«
»Ja?«
»Willkommen in Cairns, Sir. Ich bin Mike Devlin, der Verwalter von Providence.«
»Oh, Sie sind das? Schön. Ausgezeichnet. Ich habe darauf gehofft, dass wir uns begegnen. Ich muss sagen, Sie haben sich einen schönen Tag für uns ausgesucht. Ein wenig warm, aber ich denke, das war zu erwarten.«
»Ja, unsere Winter sind mild«, erwiderte Mike.
Überrascht zwinkerte Morgan, dann lachte er. »Winter. Natürlich. Hier ist ja alles auf den Kopf gestellt, nicht wahr?«
»Auf den Kopf gestellt, ja«, sagte Mike, erleichtert, in Morgan einen anscheinend angenehmen Zeitgenossen gefunden zu haben, der erst in seinen Dreißigern war. Er hatte einen sehr viel älteren, ernsteren Gentleman erwartet. »Und Sie sind Mrs. Morgan?«, fragte er lächelnd die junge Lady, die neben Morgan stand. »Nein. Das ist Miss Langley, meine Schwägerin. Meine Frau scheint irgendwie verschwunden zu sein. Geh und suche sie, Sylvia. Und wo ist dein Vater?«
Das Mädchen ignorierte ihn und streckte Mike ihre gepflegte Hand entgegen. »Mr. Devlin, es freut mich, Sie kennen zu lernen. Ich habe meinen kleinen Hund in einen Käfig gesteckt, damit er nicht ins Wasser fällt. Aber ich fürchte, es ist zu heiß für ihn. Meinen Sie, Sie könnten ihn nicht so lange in den Schatten stellen, bis wir abfahrbereit sind?«
Ein Hund? Bestürzt starrte Mike auf den traurig blickenden Spaniel. Hatte ihnen denn niemand gesagt, was mit Hunden hier passierte? Bis auf einige buscherfahrene Dingos, die nur die Aborigines zähmen konnten, gab es in der Stadt keinen einzigen Hund mehr. Aber jetzt war nicht die Zeit für Erklärungen dieser Art. Er musste die Leute bei Laune halten. Er nahm den Käfig und blickte sich hilflos um. In welchen Schatten? Auf einem Kai?
Glücklicherweise widerrief Morgan ihre Anweisung. »Wir sehnen uns alle nach Schatten, Sylvia. Wenn Sie einen Träger für uns finden, Mr. Devlin, dann können wir gehen.«
Mike war ihm gern zu Diensten, holte eine lange Schubkarre und schichtete darauf das von Morgan bezeichnete Kabinengepäck. Als er das letzte Stück auflegte, erschien auch der vermisste Vater, der ihm als Professor Langley vorgestellt wurde. Ein kleiner Mann mit flauschigem Backenbart und aufgeweckt blinzelnden Augen.
»Sie sind also der Verwalter unserer Plantage«, sagte er begeistert. Mike spürte, wie Morgan zusammenzuckte. Unsere Plantage? ging es ihm durch den Kopf. Ich dachte, Mr. Morgan sei der alleinige Besitzer. Ich nehme an, das wird sich mit der Zeit klären.
»Ja«, sagte er. »Und ich freue mich darauf, Sie herumführen zu dürfen.«
»Ich kann es kaum erwarten«, erwiderte der Alte. »Das ist alles sehr aufregend.«
»Können wir dann bitte gehen?«, sagte Morgan. »Ich sehe, dass meine Frau uns schon vorausgegangen ist.«
Während er die Schubkarre über die unebenen Planken des Kais schob, sah Mike, dass die sanfte Frau mit dem liebenswerten Gesicht auf sie zukam. Er verspürte einen Anflug von Enttäuschung, als sie ihm als Morgans Frau vorgestellt wurde.
»Hast du vom Meer noch immer nicht genug?«, fragte Corby. »Du starrst hinaus, als würdest du es vermissen.«
»O nein«, sagte sie. »Ich habe nur diese Bucht bewundert. Sie ist wirklich schön, die Farben sind so kräftig, mit diesen Bergen im Hintergrund.« Sie wandte sich an Mike. »Das Licht ist hier anders«, bemerkte sie, als sie nun neben ihm ging. »Es ist so klar, Mr. Devlin.«
Es schien sie nicht zu kümmern, dass ihr Ehemann, gefolgt von ihrer Schwester und ihrem Vater, vorausschritt. »Wie lange sind Sie schon in Providence, Mr. Devlin?«
»Vom ersten Tag an, Ma’am. Seit sechs Jahren.«
»Gott sei Dank. Mr. Morgan hat sich während der Reise mit dem Zuckeranbau beschäftigt, und ich bin mir sicher, dass seinem Unternehmen Erfolg beschieden ist. Aber er wird Ihnen und Ihrer Führung dankbar sein. Ich hoffe also, dass Sie bei uns bleiben, vorerst zumindest.«
Seine ersten Gefühle der Zuneigung für die Lady schwanden. Was meinte sie damit? Vorerst? Was hatten sie vor? Wollten sie sich seine Erfahrung zu Eigen machen und ihn dann hinauswerfen? Den Teufel werden sie! Dennoch … langsam, langsam fängt man den Affen, dachte er. Ein Verwalter konnte jederzeit entlassen werden. Das beste würde es also sein, erst einmal stillzuhalten und diesem Ausbund an Schriftgelehrtheit Stück für Stück seines Wissens mitzuteilen. Sich unersetzlich machen.
»Wohin gehen wir nun?«, fragte Morgan.
»Ich habe dafür gesorgt, dass Sie die nächsten Tage hier in der Stadt, im Victoria Hotel, verbringen«, erzählte ihnen Mike. »Dadurch haben Sie Gelegenheit, sich hier erst einmal zurechtzufinden. Es ist ein neues Hotel, erst vor sechs Monaten gebaut, mit einer ausgezeichneten Küche. Es sollte Ihnen also gefallen.«
»Warum müssen wir diese Ausgaben auf uns nehmen? Die Plantage ist unser Zuhause. Wir sollten sofort nach Hause gehen.«
»Ich kann Sie verstehen«, sagte Mike zuvorkommend. »Aber es gibt einige Leute in der Stadt, die Ihre Bekanntschaft zu machen wünschen. Sie kennen das … der Bankdirektor, Stadträte, andere Pflanzer. Ich dachte, ein Abendessen unter Gentlemen sei in Ordnung.«
»Und wer zahlt dieses Abendessen, Mr. Devlin?«
»Es geht auf Rechnung der Plantage. Jake gab viermal im Jahr ein Essen für die ersten Bürger der Stadt. Die sich natürlich dafür revanchierten.«
»Mit Jake, nehme ich an, meinen Sie den ehemaligen Besitzer, Mr. Devlin. Aber ich bin nicht Jake. Wir haben eine lange Reise um die halbe Welt hinter uns. Ich bin nicht in Stimmung und nicht darauf vorbereitet. Verzeihen Sie mir, ich will nicht undankbar erscheinen. Glauben Sie mir, ich schätze Ihre Gewissenhaftigkeit, und unter anderen Umständen wäre es eine großartige Idee, aber nicht jetzt.« Er nahm Mike beiseite. »Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin durchaus in der Lage, einen Herren-Abend zu genießen. Aber ich muss erst die Familie unterbringen. Wir brechen sofort auf.«
»Kein Problem, das Dinner abzusagen«, ließ Mike verlauten, obwohl er wusste, dass er sich damit den Zorn von Clancy Ahearne zuzog, des Besitzers des Victoria Hotels. »Dennoch denke ich, dass Sie die Nacht hier verbringen sollten.«
»Warum?«
»Es ist keine besonders gute Idee sich auf den Weg zu machen, wenn die Sonne hoch steht. Es ist jetzt fast elf Uhr. Es ist besser, frühmorgens aufzubrechen.«
Corby klopfte ihm auf die Schulter. »Kommen Sie, Mr. Devlin. Sehe ich aus wie ein Muttersöhnchen? Es ist ein herrlicher Tag. Was können Sie also für unseren Transport zur Verfügung stellen?«
Sein Verwalter zuckte mit den Schultern. »Ein Ochsengespann kann die schweren Kisten transportieren, die Sie sicherlich haben werden.«
»Die haben wir in der Tat.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann habe ich ein Pferd für Sie. Die Damen und Professor Langley können mit dem Kabinengepäck in einem Wagen fahren. Außerdem habe ich auch einige Packpferde besorgt.«
»Nun … das ist es doch. Überhaupt kein Problem. Und in null Komma nichts sind wir zu Hause.«
»In sechs Stunden«, korrigierte ihn Mike. »Wenn alles gut läuft.«
Die Bestürzung in Morgans Gesicht entschädigte Mike für die ihm allmählich dämmernde Einsicht, dass es diesem Mann nicht gegeben war, einen Rat anzunehmen.
»Sechs Stunden, sagen Sie? Ich dachte, Providence läge viel näher.«
»Der Wagen hält uns auf. Zu Pferd geht es sehr viel schneller.« Und um seine Position zu stärken und ihn zu verunsichern, fügte er an: »Das heißt jetzt, in der Trockenzeit. In der Regenzeit kann es viel länger dauern – wenn wir dann nicht völlig abgeschnitten sind.«
»Dann bleibt uns eben nichts anderes übrig, nicht wahr?«, erwiderte Corby fest.
»In der Tat«, sagte Mike mit einem Grinsen. Trotz der eleganten Kleidung und seinem uneinsichtigen Gebaren fehlte es dem Engländer offenbar nicht an Mut. Statt nachzugeben, focht er seine Entscheidung aus, wenn er sie erst einmal getroffen hatte. Mike schrieb ihm dies gut. Natürlich hatten sie einen langen Weg vor sich – die Reise nach Providence, obwohl nicht ungefährlich, war nur der Anfang. Providence selbst konnte sich als launisch erweisen, als fröhlich und grausig, vollkommen unberechenbar. Immer, wenn Mike einen Tag ohne Probleme oder dramatische Ereignisse überstand, hatte er das Gefühl, es gut gemacht zu haben. Es dürfte interessant werden zu beobachten, wie Morgan mit der physischen Anstrengung und dem Druck zurechtkam, den eine Arbeiterschaft von neunzig Kanaka ausübte.
Obwohl er nicht mehr der Jüngste war – mindestens vierzig –, erschien Sylvia der Plantagenverwalter mit seinem schwarzen, hinten zusammengehaltenen Haar, den dunklen Augen, der gebräunten Haut und dem warmen Lächeln, das unter dem dicken Bart hervortrat, als gutaussehender Mann. Er trug, obwohl es sich für Gentlemen eigentlich gehörte, keine Jacke; unter dem altmodischen langärmeligen Hemd, das am Hals aufreizend offen war, blieben sein breiter Brustkorb und die muskulösen Arme nicht verborgen.
»O, là là!«, sagte sie sich – das Wort hatte sie von Lita –, als sie ihn beim Abladen der Karre beobachtete. »Er sieht aus wie ein Pirat!« Fasziniert hatte sie mit angesehen, wie Lita ihn vor aller Augen auf die Wange geküsst hatte, und sein Lächeln, seine Reaktion darauf, als wäre er ihr Bruder, der er sicherlich nicht war. In den nächsten Tagen musste sie von Lita alles über ihn herausfinden.
Es war grausam von Corby, dass er darauf bestand auf der Stelle abzureisen. Mr. Devlin hatte versucht, ihr Leben ein wenig angenehmer zu gestalten, als er vorschlug, noch einige Tage im Hotel zu bleiben. Corby jedoch wollte es anders – natürlich war er zu geizig. Zumindest war ihr und Jessie erlaubt worden, im Foyer des Hotels den Morgentee einzunehmen, während die Männer bereits Reisevorbereitungen trafen.
»Das scheint ein ganz passables Hotel zu sein«, sagte sie zu Jessie. »Du solltest darauf bestehen, dass wir ein wenig länger bleiben, vor allem in deinem Zustand.«
»Was würde es denn ändern«, erwiderte Jessie. »Ob in meinem Zustand oder nicht, früher oder später müsste ich die Reise doch antreten. Außerdem fühle ich mich ganz wohl.«
Sylvia schwieg. Jessie war ein solcher Dummkopf. Was immer Corby auch sagen mochte, sie tat immer das, was man von ihr verlangte. Dennoch, dachte sie und machte sich an ihrem Haar zu schaffen, während sie zu den drei jungen Männern hinüberblickte, die sich an der Tür in ernsthafter Unterhaltung befanden, konnte Jessie von Glück sagen, dass sie Corby hatte gewinnen können – mit ihrem mausfarbenen Haar und ihren blassen Farben. Trotz seines herrischen Wesens sah er ganz gut aus und war immer elegant gekleidet – was man von seiner Frau nicht behaupten konnte. Für Mode interessierte sich Jessie nicht; sie trug, im Gegensatz zu ihrer Schwester, die attraktive Stoffe bevorzugte, langweilig-korrekte Kleidung, die vor allem dazu gemacht schien, lange zu halten.
Corby schien nicht zu bemerken, wie langweilig seine Frau neben ihm wirkte. Sylvia war dies ein Rätsel, bis ihr Lita, ihre neue Freundin und Kabinengenossin, zuflüsterte: »Das ist ganz normal, Liebes. Viele Männer schätzen kleine, langweilige Frauen, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. So erregen sie nicht die Aufmerksamkeit anderer Männer. Sie sind keine Konkurrenz. Wäre Ihre Schwester eine vor Geist sprühende Frau, hätte sie Mr. Morgan, der es vorzieht, selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, niemals geheiratet.«
Von dem Zeitpunkt an, wo sie Lita begegnet war, hatte sich Sylvias Leben verändert. Hier war jemand, der ihr zuhörte, der verstand, dass es ungehörig war, eine junge Lady aus ihrer angestammten sozialen Umgebung zu reißen, und die vor allem so fröhlich war. Niemals schien sie etwas ernst zu nehmen, schon gar nicht ihre Rolle als Sylvias Anstandsdame, wenn sich die Familie zurückgezogen hatte. Sie, die selbst ausgiebig flirtete, hatte gegen Sylvias Schiffsromanzen nicht das Geringste einzuwenden. Im Gegenteil, sie genoss es, alles darüber zu erfahren.
Natürlich hatte Corby gegen Mrs. de Flores Vorbehalte, aber das kümmerte Sylvia nicht. Sie vergötterte Lita fast, und sie war ihre Freundin. Als sie so am Fenster saß und diese fremdartigen und rauen Leute durch den Ort gehen sah, hoffte Sylvia, dass Lita sie nun, da die Reise vorüber war, nicht vergessen würde. Sie hatte behauptet, dass es in der Gegend viele freundliche Leute gebe, die erfreut wären, die Neuankömmlinge willkommen zu heißen, und hatte versprochen in Verbindung zu bleiben.
»Wir sollten einen Spaziergang machen«, sagte sie zu Jessie, nachdem sie die Verzögerung zu langweilen begann.
»Nein. Corby hat uns gebeten hier zu warten. Er will bestimmt nicht, dass er uns dann suchen muss. Möchtest du noch etwas Tee?«
»Danke, nein. Ich werde kurz vor die Tür gehen. Das wird deinen Ehemann doch sicherlich nicht stören!«
»Sei nicht so, Sylvia. Corby hat mit dir viel Geduld gezeigt …«
»Weswegen?«
»Das weißt du sehr gut. Dein Verhalten auf dem Schiff hat einiges zu wünschen übrig gelassen. Ich rate dir, bring ihn nicht noch mehr gegen dich auf.«
»Er ist nicht mein Aufpasser«, blaffte sie zurück.
An der Tür begegnete ihr ihr Vater, der seinen Hut abnahm und sich den Schweiß vom Gesicht wischte. »O mein Gott, ist die Sonne heiß. Ich habe mich hier umgesehen. Hier entsteht ja eine richtige Stadt … ein neues Gerichtsgebäude, eine Post und eine Polizeistation …«
»Hoffentlich«, gab Sylvia zurück.
»Ja.« Er blinzelte. »Komm und trink mit mir eine Tasse Tee.« Mit einem Seufzer der Enttäuschung kehrte Sylvia mit ihm wieder um.
Devlins Vorschlag, die Reise nicht in der prallen Sonne zu beginnen, fiel Corby ein, als er fassungslos feststellen musste, dass die Frauen in einem schwerfälligen offenen Wagen reisen sollten. Er sorgte sich dabei wenig um Sylvia, doch Jessie war im siebten Monat schwanger und konnte unter der Hitze leiden.
»Es gibt sicherlich etwas Besseres als das«, sagte er. »Ich dachte an einen Landauer mit Dach, der mir für die Ladys angemessener erscheint.«
»Ich fürchte nicht. Wenn wir erst aus der Stadt sind, verschlechtert sich die Straße. In der Trockenzeit fühlt es sich an, als ob man über ein gepflügtes Feld fährt. Bei einem leichteren Wagen würden sie sich die Zähne ausschlagen. Der hier ist viel sicherer.«
Er stellte den Kutscher vor, einen grauhaarigen Eingeborenen. »Er hat Hände aus Eisen, er wird vorsichtig fahren, nicht wahr, Toby?«
»Ganz sicher, Boss.« Toby grinste. »Beide Gäule brave Kerle.«
Corby beaufsichtigte die Beladung des Wagens, Taschen mit Proviant wurden auf die Packpferde geschnallt. Zwei Chinesen kamen mit einem Essenskorb und drei Schirmen angerannt.
»Unsere Passagiere brauchen Schatten«, erklärte Devlin. »Und im Korb sind Lebensmittel für eine Mahlzeit unterwegs.«
»Sehr aufmerksam von Ihnen«, erwiderte Corby. Er fühlte sich sehr abenteuerlustig. Zwei Pferde waren für sie bereits gesattelt, und unter dem Kutschbock des Wagens befand sich, wie er bemerkte, ein Gewehr. Als sich auch Devlin mit einer Pistole bewaffnete und ein Gewehr in die Ledertasche an seinem Sattel steckte, wich seine Aufgeregtheit allerdings einem Gefühl der Unruhe. »Sind diese Gewehre wirklich nötig?«
»Man kann nie wissen«, sagte Devlin.
»Was kann man nicht wissen?«
»Schlangen«, erwiderte der Verwalter. Aber Corby ließ sich damit nicht abspeisen.
»Sie brauchen dieses Waffenarsenal um sich gegen Schlangen zu verteidigen?«
Der Verwalter zögerte. »Ich will Sie nicht beunruhigen. Aber die Aborigines-Stämme draußen im Busch können manchmal ein wenig Probleme bereiten. Es gibt jedoch Aufseher, die aufpassen. Außerdem stellen wir nicht unbedingt ein Ziel für sie dar; gewöhnlich haben sie es auf Gold abgesehen.«
»Und Vorräte?« Corby zeigte auf die Packpferde.
»Möglich.«
»Dann würde ich es vorziehen, ebenfalls bewaffnet zu sein.«
Corby wollte dem Kerl zu verstehen geben, dass er nicht nur einen Passagier abgeben wollte, sondern sich verantwortlich für die Expedition fühlte.
»Natürlich. Was wollen Sie? Ein Gewehr oder einen Revolver?« Corby fragte sich, ob der Wortschatz des Kerls das Wort »Sir« beinhaltete. »Das letztere, bitte, und einen anständigen.« Er holte seine Geldbörse hervor. »Wie viel brauchen Sie?«
»Wir ziehen es von unserem Konto ab«, sagte Devlin. »Warten Sie hier, ich springe schnell rüber und besorge einen.«
Die Antwort erfreute und verärgerte Corby zugleich. Dass sie ein Konto besaßen, bedeutete, dass Geld vorhanden war und er seine mageren Finanzen nicht angreifen musste. Andererseits beunruhigte ihn »unser« Konto. Er würde auf Devlin ein Auge werfen und darauf achten müssen, dass Devlin in der Stadt nicht Dinge kaufte, ohne vom wirklichen Boss, Corby Morgan, dazu ermächtigt worden zu sein. Gott weiß, was ihn diese lockere Handhabung kosten mochte. Während Devlins Abwesenheit wandte er sich dem jungen Stallburschen zu, der an einem Zaun lehnte und sich um die Pferde kümmerte. »Gehören alle diese Pferde zu Providence?«
»Ja. Mike hat immer einige Pferde in der Stadt, meistens ein halbes Dutzend oder so.«
»Es sind schöne Pferde.«
»O ja. Jake verstand was von Pferden. Das eine dort drüben …« Er zeigte auf eines der Packpferde, ein hohes, kastanienbraunes Tier mit weißer Mähne. »Das ist Prissy, die Schwester Ihres Hengstes Prince.« Er lachte. »Und sehen Sie nur, wie beleidigt sie ist mit ihrem Gepäck, auch wenn wir ihr nur wenig aufgeladen haben! Die Biester riechen das. Mike hat sie mitgebracht weil er dachte, Ihre Missus würde gerne reiten. Und am nächsten Tag hörte er, sie is’ in anderen Umständen, da musste er sich was anderes einfallen lassen, nich’?«
Angewidert von der beiläufigen Anspielung dieses Flegels auf den Zustand seiner Frau drehte sich Corby weg. Wie sehr wünschte er sich, dass Roger und seine Frau hier wären, um ihm die Unterstützung zu geben, die er bräuchte, um mit diesen schrecklichen Leuten hier fertig zu werden.
Trotzdem konnte er einem Anflug von großtuerischem Stolz nicht widerstehen, als er die Hauptstraße hinaufmarschierte, um die Frauen und den Alten abzuholen – nun, da an seiner Hüfte ein Revolver hing und seine maßgeschneiderte Jacke offenstand. Keiner auf der Straße, einige der Männer trugen selbst Waffen, schien das allerdings zu bemerken; als ihn jedoch Sylvia erblickte, brach sie in schallendes Gelächter aus. »Mein Gott, Corby! Du siehst aus wie ein Revolverheld! Zieh oder stirb!«
Er ignorierte sie und nahm Jessie am Arm. »Sei nicht beunruhigt. Mir wurde mitgeteilt, dass man auf dem Land auf Schlangen stoßen könnte. Nun kommt, es ist an der Zeit.«
»Hättest du nicht deine Reitgarderobe anlegen sollen, Liebling?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf.
»Wir gehen nicht auf die Jagd, Jessie. Ich besitze nicht diese raue Kluft, die sie hier tragen. Das hier muss genügen.«
Die Reise war entsetzlich. Die Männer trotteten in Sichtweite des Wagens einher, an dem hinten die Packpferde angebunden waren. Corby glaubte, sie würden es niemals vor Einbruch der Dunkelheit bis nach Providence schaffen; er sehnte sich nach einem schnelleren Fortkommen. Sie folgten einem schmalen Weg, der durch eine verdorrte, trockene Landschaft führte, die mit ihren Büschen und verkrüppelten Bäumen immer gleich aussah; Gehöfte waren nicht zu sehen. Wären nicht die Fliegenschwaden gewesen, die mit ihnen reisten, hätte Corby fürchten müssen, vor Langeweile von seinem Pferd zu fallen.
Es gab einige harsche Wortwechsel mit dem Professor, der vorne bei Toby saß und ihn jedes Mal anhalten ließ, wenn er wieder eine außergewöhnliche Pflanze entdeckt hatte, die er seiner Sammlung hinzufügen wollte. Corby befahl Toby, auf die Launen des Alten nicht mehr weiter einzugehen, was den Aborigine jedoch nur verwirrte; er hielt weiterhin an, bis Mike mit ihm sprach und einige entschuldigende Worte an Corbys Schwiegervater richtete.