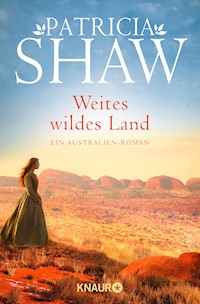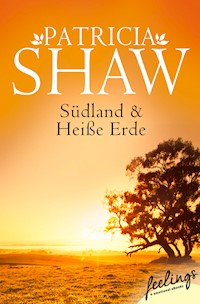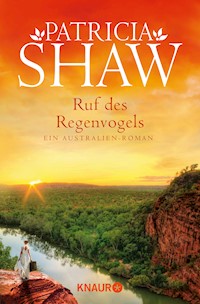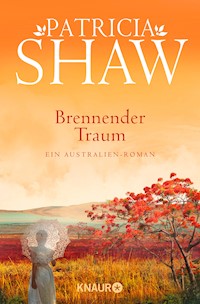6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Buchanan-Saga
- Sprache: Deutsch
Glück und ohnmächtige Wut, stürmische Leidenschaft und skrupelloser Ehrgeiz prägen das Leben des Aborigine-Mischlings Ben, das auf eine unaufhaltsame Katastrophe zuzutreiben scheint. Patricia Shaws neues Australien-Epos ist von großer Kraft, engagiert schildert es das Antlitz des fünften Kontinents um die Jahrhundertwende, ein Land im Umbruch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Patricia Shaw
Der Traum der Schlange
Die große Australiensaga
Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für
Evangeline Holly Shaw
Lynne und Garry
Desiree Shaw
Erstes Kapitel
Ben sah sich im Geiste als Seefahrer, als stolzen und furchtlosen Kapitän, der sein Schiff den Fluss hinunter in die Moreton Bay und dann mit vom Wind geblähten Segeln hinaus aufs blaue Meer führte. Bei Wind und Wetter hinter dem Steuerrad, ein tapferer Kapitän, der die Bewunderung seiner treuen Mannschaft genoss.
Er trug einen spitzen Hut und eine elegante Jacke mit Messingknöpfen, genau wie Großvater Beckman auf dem Porträt, das über dem Kaminsims hing. Der arme Captain Beckman! In einer dunklen, stürmischen Nacht war er samt seinem Schiff vor dem Great Barrier Reef untergegangen. Ben sah ihn vor sich auf der Brücke – aufrecht und stark rief er inmitten des tobenden Sturms seinen Männern zu, sie sollten sich retten. Er selbst jedoch weigerte sich, seine Ehre zu verlieren, indem er das Schiff preisgab. Dieser Teil der Geschichte, die Oma Beckman ihm so oft erzählt hatte, gefiel Ben am besten. Es war ein schönes Gefühl, wenn man einen Helden in der Familie hatte.
Ben kroch bis an den Rand der staubigen, orangefarbenen Klippe und ließ sich auf einen Vorsprung fallen. Kangaroo Point war sein liebster Ausguck. Von hier aus konnte er die ganze Stadt Brisbane und die geschäftigen Docks überblicken. Für ihn war es der aufregendste Anblick der Welt. Kein Schiff konnte passieren, ohne dass Ben es bemerkte. Na ja … einige wenige vielleicht. Er ärgerte sich immer, wenn er eins verpasste, weil er im Haus oder auf dem Hof arbeiten oder eine von Omas endlosen Lektionen ertragen musste. Diese Lektionen! Sie ließ einfach nicht locker. Wenn er sich beschwerte, drohte seine Mutter damit, ihn zur Schule zu schicken, dann könne er überhaupt keine Schiffe mehr beobachten.
Bei diesem Gedanken huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Unten quälte sich gerade die Louisa Jane, ein alter, nicht weiter interessanter Raddampfer, stromaufwärts. Sie beförderte Ladung und Passagiere zwischen Brisbane und den Niederlassungen an der Südküste hin und her – wie langweilig für einen Kapitän! Ben ließ sie einfach vorüberziehen. Manchmal nahm er fremde Schiffe mit einer Tonröhre, die ihm als Kanone diente, ins Visier und jagte sie in die Luft, weil sie es gewagt hatten, ohne Erlaubnis sein Fort zu passieren. Schließlich verkörperte er die Marine von Queensland, den Hafenmeister und den misstrauischen Zollbeamten in einer Person.
Ihn zur Schule zu schicken! Ein guter Witz. Ben wusste ebenso gut wie seine Mutter, dass er weder hier noch sonst irgendwo zur Schule gehen konnte. Das hatten ihm die Kinder auf den Docks erzählt. Doch er tat immer, als habe er Angst vor dieser Strafe, um seiner Mutter eine Freude zu machen. Er liebte sie. Sie war eine hochgewachsene, gutaussehende Frau, doch Ben holte sie langsam ein. Sie und Oma legten oft ein Lineal auf seinen Kopf und markierten seine Fortschritte mit einem Einschnitt an der Holzwand. Großmutter, Oma Beckman, warf seiner Mutter vor, sie würde ihn verwöhnen, aber sie kam ihm immer zu Hilfe, wenn Mutter einmal ernsthaft böse war und härtere Maßnahmen androhte. Sie erfand Entschuldigungen für Ben, so dass der lederne Schleifriemen in der Wäschekammer blieb, wo er seit den Tagen des Kapitäns hing.
Wenn der Fährmann einen guten Tag hatte, erwischte Ben schon einmal eine Freifahrt mit der Fähre und wanderte durch die Docks. Besonders interessant war es, wenn große Schiffe im Hafen lagen und er den ganzen Wirbel des Be- und Entladens, die fremden Stimmen der Passagiere auf den Decks, deren Neugier bei der Ankunft und die tränenreichen Szenen beim Ablegen miterleben durfte. Sie riefen ihren Freunden und Familien einen letzten Gruß zu, während das Schiff sich immer weiter vom Ufer entfernte. Ben verstand nicht, weshalb sie weinten. Er war fest entschlossen, mit Mum und Oma, seinen beiden Damen, eines Tages auf einem eigenen Schiff um die Welt zu fahren. Sie würden sogar den Pazifik überqueren, bis zur Nordostküste Südamerikas, wo große Schätze verborgen lagen. Er hatte einmal davon geträumt, in einer Höhle einen sagenhaften Schatz zu finden. Dieser Traum war so wundervoll gewesen, dass er sich bemühte, ihn nicht zu vergessen, obwohl er ihm nun doch allmählich entglitt.
Weit unter ihm kehrten Fischerboote zurück, von kreischenden Möwen begleitet. Ben winkte den Männern an Bord zu, die mit geschickten Händen ihren Fang für den Markt vorbereiteten. Sie winkten freundlich zurück und entgingen damit einer Ladung aus seiner Kanone. Wenn er erst Piratenkapitän mit einem eigenen Schiff war, das übrigens Black Swan heißen sollte, nach den Schwänen, die wie kleine, würdevolle Galeonen über den Fluss segelten, würde Ben die Fischer beschützen.
Wenn er zu lange auf den Docks blieb, bekam er Schwierigkeiten. Die Fähren waren dann überfüllt, so dass er den langen Fußmarsch bis zur Victoria Bridge in Kauf nehmen musste. Wenn er sie überquert hatte, musste er etliche Meilen durch die feuchten, furchteinflößenden Straßen von South Brisbane laufen und hinauf bis zum Point. Schon oft hatten betrunkene Männer nach ihm geschnappt, wenn er an den Kneipen und Bordellen vorbeirannte.
»Wohin so schnell, Kleiner?«
»Hübscher Junge. Bleib doch mal stehen.«
»Komm, ich spendiere dir einen Rum.«
So beängstigend das auch sein mochte, war es doch nichts im Vergleich zu Diamonds Zorn, wenn er zu spät nach Hause kam. Diamond, seine Mum, machte sich solche Sorgen, dass sie bei seinem Anblick schon in heller Panik war und ihm eine Ohrfeige versetzte, die sich gewaschen hatte! Sie mochte es nicht, wenn er sich bei den Docks herumtrieb, es sei kein Ort für Kinder. Außerdem hatte Ben den Fehler begangen, ihr zu erzählen, dass er im Gegensatz zu den anderen Kindern niemals stahl oder sich auf die Schiffe schlich; dadurch wurde ihre Wut nur noch größer.
Sie schrie ihn an. »Du bleibst gefälligst von diesen Docks weg, verstanden? Bleib auf deiner Seite des Flusses! Das sind schlechte Menschen da drüben.«
Ben hatte sich trotzig an Oma gewandt. »Der Kapitän ist doch auch zur See gefahren! Warum sollte ich vor Seeleuten Angst haben?«
In diesem Punkt teilte Oma jedoch Diamonds Meinung. »Der Kapitän war ein gottesfürchtiger Mann. Du weißt nicht, wie diese Leute sind.«
»Ich möchte es aber wissen. Hier ist es so langweilig. Es gibt nichts zu tun.«
Noch ein Fehler. Diamond hatte keine Mühe, neue Aufgaben für ihn zu finden. Trotzdem gelang ihm immer wieder die eine oder andere Fahrt über den schäumenden Fluss hinüber zu seinen Freunden, den schmächtigen Burschen und den Mädchen, denen Wildheit aus den Augen sprühte, zu machen. Die meisten von ihnen hatten kein richtiges Zuhause und fanden stattdessen Unterschlupf in den großen Wollschuppen, unter den Lagerhäusern oder in den Verschlägen hinter den Geschäften auf der anderen Straßenseite. Sie trieben sich nur zu einem Zweck auf den Docks herum: um ein paar Pennys zum Überleben zu verdienen. Ben fand ihre Gesellschaft aufregend. Diese Kinder trugen Lumpen und lachten über seine sauberen Hemden, die Kniehosen und langen Strümpfe, doch sie akzeptierten ihn. Er war keine Petze, obwohl er genau bemerkte, was sie taten: Sie klauten, hatten flüchtige Zusammenkünfte mit Männern hinter den Schuppen, hantierten geschickt mit Schnapskisten, verwirrten damit die Zollbeamten, und das alles für ein paar Pennys. Nebenher betätigten sie sich als Taschendiebe, während sie sich lautlos zwischen die aufgeregten Neuankömmlinge von den Schiffen mischten.
Ben sah das alles und staunte über ihre Kühnheit, doch die ausgemergelten Gesichter der Kinder verrieten, dass sie diesen Broterwerb bitter nötig hatten. Omas Vorratskammer war bestens ausgestattet, und sie erwartete, dass sich der Junge selbst bediente, wann immer er zwischen den Mahlzeiten Hunger verspürte. Also stopfte er sich die Taschen voll mit Essen und brachte es seinen Freunden mit.
Sein bester Freund hieß Willy Sloane, war so alt wie er und Anführer einer Bande. Sein Versteck sei rattenfrei, verkündete er stolz, und liege irgendwo unter dem Dach eines Hauses. Er wusste, dass Ben auf der anderen Seite des Flusses lebte, doch wie die übrigen Kinder stellte er nie irgendwelche Fragen. Dazu waren sie alle viel zu beschäftigt.
Wenn die Polizei wieder einmal verrückt spielte, brachte Willy Ben nach unten in den Park in Sicherheit. Dort ließen sie sich ein Weilchen nieder.
»Aber ich habe doch nichts getan«, beschwerte sich Ben dann immer.
»Meinst du, das interessiert sie, Kumpel? Mach dich rar, oder sie schnappen dich mit den anderen.«
Ben dachte oft daran, Willy zu seinem ersten Maat zu ernennen, wenn er erst das Schiff besaß. Noch nie war ihm ein schlauerer Kerl begegnet als er. Gern hätte er ihn zu sich nach Hause eingeladen, doch sie bekamen selten Besuch, und ein ruheloser, nervöser Junge wie Willy hätte sich wahrscheinlich zu Tode gelangweilt.
Die Nachbarn nebenan hatten andauernd Besuch, aber sie bewohnten auch ein großes Haus. Oma nannte es »ein Anwesen«. Ben empfand jedoch keinen Neid. Von den Klippen aus betrachtete er sein eigenes Zuhause, ein hübsches, weißes Holzhaus, das nicht direkt an der Straße lag und einen großen Garten besaß. Drinnen gab es drei Schlafzimmer, eins für jeden von ihnen, und mehr brauchten sie auch nicht. Von seinem Fenster aus konnte er nachts das gasbeleuchtete Zauberland von Brisbane sehen und von der großen Welt da draußen träumen.
Das Haus nebenan besaß zwei Stockwerke und einen Balkon, von dem man sicher einen herrlichen Ausblick hatte. Dort lebten Dr. und Mrs. Thurlwell, wichtige Leute, die es nicht für nötig befanden, mit den Beckmans zu sprechen. Sie blieben auf ihrer Seite des Zauns und empfingen laut Zeitungsberichten die feine Gesellschaft von Brisbane – angeblich sogar den Gouverneur, obwohl Ben ihn noch nie dort entdeckt hatte.
Die Thurlwells nannten ihr Anwesen Somerset House, und Ben kannte jeden Winkel ihres Grundstücks. Seit Jahren schon schlich er regelmäßig über die Klippen und kroch durch ihre Hecke, um in den bunten Garten mit den majestätischen Kiefern und rauschenden Palmen zu gelangen. Rasen und Büsche waren sorgfältig gepflegt, und von Blumenbeeten gesäumte Wege zogen sich von der Seite des Hauses hinunter. Der Vorgarten wirkte noch exotischer, besonders dann, wenn die großen Feuerbäume in voller Blüte standen. Im Schatten des üppigen Grüns konnte Ben die Kutschen und offenen Wagen beobachten, die über den knirschenden Kies der langen Auffahrt zum Vordereingang rollten. Uniformierte Dienstboten öffneten die Tür und verbeugten sich vor den Spitzen der Gesellschaft. Er staunte beim Anblick dieses Schauspiels und der schönen Menschen, die in diesem Haus lebten. Auf der Seite, die den Klippen zugewandt lag, gab es eine elegante Veranda, auf der Damen in blendend weißen Kleidern und gutangezogene Herren frische Luft schnappten und lässig auf bequemen Sesseln und Sofas ruhten.
Manchmal erwischten ihn die Gärtner und jagten ihn davon, doch sie wussten, dass er nebenan wohnte, und regten sich nicht weiter auf.
Ben seufzte und kickte ein paar Steine über den Klippenrand. Somerset House war sein Lieblingsort, gleich nach den Docks. Wenn er zur See fuhr, würde er es bestimmt vermissen, ebenso wie Phoebe, die Tochter der Thurlwells. Natürlich hatte er noch nie mit ihr gesprochen, und sie wusste auch nicht, dass er sich in ihrem Garten verbarg.
Ihm kam es vor, als sei sie schon immer dort gewesen und habe sich von Puppenspiel und Teegeschirr über das Bücherlesen bis hin zu den Besuchen anderer Mädchen entwickelt. Aber keines von ihnen war so hübsch wie Phoebe. Sie sah selbst aus wie eine Puppe in den fließenden Sommerkleidern und mit den langen, blonden Zöpfen, deren Schleifen immer farblich zu den Schärpen um ihre Taille passten. Ben begegnete auf den Docks vielen frechen Mädchen mit scharfen Augen und weinerlichen Stimmen und empfand ihre Gesellschaft nicht anders als die der Jungen. Sie konnten klauen und kämpfen und davonrennen, wenn es sein musste. Nein, an sich bereitete ihm die Sache mit den Mädchen kein Kopfzerbrechen – schließlich lebte er mit zwei Frauen zusammen –, doch diese Miss Phoebe war etwas anderes. Ben ärgerte sich, weil er beim Anblick eines albernen Mädchen tatsächlich weiche Knie bekam und so schüchtern wurde, dass er sich nicht traute, sie anzusprechen.
Manchmal war sie unartig und wagte sich hinaus auf die Klippen. Die Hausmädchen stürzten sich dann auf sie, rissen sie zurück und drohten, es ihrer Mutter zu sagen. In solchen Augenblicken empfand sich Ben als Phoebes Beschützer und malte sich diese Situation aus: Wenn sie jemals auf den Klippen in Gefahr geraten sollte, würde er Phoebe retten, sich mutig nach vorn werfen, und sie in Sicherheit bringen. Dann fragte sie ihn dankbar nach seinem Namen. Ben Beckman von nebenan, antwortete er. Sie würde es ihrer Mutter erzählen, die ihn hocherfreut zu einem kühlen Getränk in das weiße Haus einlud, doch Ben würde respektvoll ablehnen. Er kannte seinen Platz, und es reichte vollkommen, ein Held zu sein …
Diamond rief ihn. Er drehte sich um und wollte vom Vorsprung nach oben klettern. Als er nach einem Grasbüschel griff, sah er die Schlange. Wie lange sie wohl schon dort gelauert hatte, genau über seinem Kopf, zusammengerollt auf dem warmen Felsen und in die Betrachtung seines Hinterkopfes versunken? Er fragte sich, ob die Schlange so fair war, ihn nicht von hinten anzugreifen, weil sie dem Feind ins Gesicht sehen wollte. Eines stand jedenfalls fest: Dieses Kriechtier mit dem gelben Bauch verhieß nichts Gutes!
Ben verharrte regungslos, die rechte Hand um das Grasbüschel geklammert, die Füße auf dem Vorsprung, und dachte krampfhaft nach. Soweit er sich erinnern konnte, verhieß eine Taipan-Schlange – und um so eine handelte es sich zweifellos – niemals etwas Gutes. Die metallisch schimmernde, gelb-schwarze Haut und der große, gebeugte Kopf mit der gespaltenen Zunge befanden sich nur wenige Fuß von Bens Gesicht entfernt.
Plötzlich rollte sie ein Stück ihres glänzenden Körpers aus, als wolle sie ihn ablenken. Die Knopfaugen starrten weiterhin die Beute an.
Bens Arm wurde langsam steif. Bald musste er das Grasbüschel loslassen, doch diese machtvollen Augen forderten seine ganze Aufmerksamkeit. Vielleicht wollte sie ihn hypnotisieren und an der Flucht hindern. Einen fragwürdigen Ausweg gab es nämlich. Er konnte sich nach hinten werfen und auf gut Glück von der Klippe fallen lassen. Wahrscheinlich würde er sich dabei den Hals und sämtliche Knochen brechen, was vermutlich noch schlimmer war als ein Schlangenbiss.
Wo steckte bloß seine Mutter? Sie hatte ihn gerufen. Warum kam sie dann nicht, um ihn zu suchen? Diamond besaß ein Gewehr, mit dem sie dieses Biest erschießen konnte, das sich langsam vor seinen Augen hin und her wiegte, als lausche es in aller Ruhe seinen Gedanken. Das Tier provozierte ihn noch immer mit der flinken Zunge und drohte mit einem Angriff.
Aus einem Baum schoss ein kleiner Honigkuckuck davon. Ohne den Blick abzuwenden, konnte Ben den Baum hinter der Schlange sehen. Ein großes, altes Exemplar mit ausladenden Ästen, das auf dem Grundstück der Thurlwells stand und bis hinüber in seinen eigenen Garten ragte. Er hatte den Baum oft als Abkürzung auf dem Weg nach Hause benutzt. Ben fragte sich, wodurch der Vogel aufgeschreckt worden war, und entdeckte dann zwischen den Ästen das Mädchen von nebenan in seinem weißen Rüschenkleid. Sie sah ihn an. Er wagte nicht, sie zu rufen. Während er an der Klippe hing, stieg Ärger in ihm auf. Phoebe saß in aller Ruhe auf ihrem Baum. Allerdings war das knorrige Ding auch kein allzu schwieriges Hindernis für ein Mädchen.
Verzweifelt lenkte er seine Gedanken wieder auf die Schlange. Er hatte inzwischen begriffen, dass sie ihn lähmen wollte, so wie Katzen es mit kleinen Vögeln taten, die sie derart in Schrecken versetzten, dass sie einfach nicht mehr davonfliegen konnten. Wenn er sich nicht bald bewegte und versuchte, diesen Kopf beiseitezustoßen, würde er zu steif sein, um auch nur einen Finger zu rühren. Das dumme Mädchen dort hinten kletterte den Baum noch weiter hoch und bewegte sich schrittweise auf die überhängenden Äste zu. Sie wollte tatsächlich über die Mauer!
Wenn sie das tat, würde er sie umbringen. Das hieß, wenn er lange genug lebte, denn sie schreckte bestimmt die Schlange auf, die ihn dann sofort beißen würde. Versteinert beobachtete Ben, wie sich das Mädchen auf einen niedrigeren Ast fallen ließ und über der Mauer baumelte. Die Rüschen ihres Kleides hatten sich in einem Zweig verfangen, so dass man ihren Hosenboden sehen konnte. Plötzlich ließ sie sich ins Gras herunterfallen und verschwand.
Die Schlange wiegte sich noch immer vor seiner Nase und schien es überhaupt nicht eilig zu haben. Bens Blick wurde glasig, der Hintergrund verschwamm. Er wünschte sich, die Augen zu schließen, aber das konnte die Schlange als Signal zum Angriff auffassen. Also riss er die Augen wieder auf, fest entschlossen, weiter Widerstand zu leisten. Vielleicht klappte es. Vielleicht auch nicht. Da entdeckte er Diamond über sich, die scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht war. Ben hatte sie nicht kommen sehen, sie war einfach da, seine wunderbare Mum. Sie trug einen langen, schwarzen Rock, der ihre nackten Füße streifte.
Ha!, dachte er bei sich. So, Mrs. Schlange, jetzt haben Sie ein Problem. Meine Mum wird Sie totschießen!
Ben wappnete sich für den Schuss, bevor er bemerkte, dass Diamond ihr Gewehr überhaupt nicht bei sich trug. Er hatte gehofft, dass Phoebe seine missliche Lage entdeckt und Hilfe geholt hatte, doch das schien wohl nicht der Fall zu sein. Zweifellos war sie nach Hause gerannt zu ihrem blöden Spielzeug und hatte ihn seinem Schicksal überlassen.
Anstatt das Gewehr zu holen, ließ sich Diamond im Schneidersitz hinter der Schlange nieder. Entsetzt wollte Ben ihr zurufen, sie solle verschwinden, weil sie nun selber in Gefahr war. Doch seine Mum legte stumm den Finger an die Lippen. Ben schossen die Tränen in die Augen, als er begriff, dass sie die Aufmerksamkeit der Schlange von ihm ablenken wollte.
Dann begann sie mit tiefer Stimme zu singen, ein seltsam monotones Lied, dessen gemurmelte Worte sich ständig wiederholten. Sie presste die Handflächen an den Boden, als wolle sie der schrecklichen Schlange beweisen, dass sie keine Waffe trug. Ben war wütend: Wie konnte sie nur so dumm sein. Sie durfte nicht sterben, er liebte sie doch. Mum und Oma waren das ganze Leben für ihn. Diamonds Gesang glitt hinüber in den Rhythmus eines Schlafliedes. Die verfluchte Schlange streckte sich, wiegte sich stärker, während sie böse züngelte und zwischen den beiden Menschen hin und her schwang. Sie will sehen, wen von uns sie besser erwischen kann, dachte Ben in Panik.
Die dunklen Augen seiner Mutter lenkten die Schlange allmählich von ihm weg. Ihr Gesicht trug einen so lieblichen Ausdruck, dass Ben tief betroffen war. Sie hätte einen großen Stock nehmen und das Biest verprügeln sollen, stattdessen gab sie sich der Taipan preis. Ben löste seine Hand von dem Grasbüschel und zog sie ganz langsam weg, während die Schlange seiner Mutter lauschte. Die Windungen ihres Körpers glitten allmählich von ihm weg, der Kopf wandte sich in Diamonds Richtung. Sie sang weiter, sah zu, wie die Zunge verschwand und die Schlange sich verführerisch vor ihr wiegte, als wolle sie für sie tanzen.
Diamond war nun die lächelnde Zuschauerin und beobachtete die tanzende Schlange, bis sich diese langsam zurückzog. Ben kam es wie eine Ewigkeit vor.
Erleichtert kletterte er die Klippe hinauf. »Schnell, Mum! Töte sie, bevor sie verschwindet!«
»Nein«, gab sie zurück. »Sie lebt hier. Ich habe sie oft gesehen. Es ist ihr Zuhause. Du hast sie erschreckt.«
»Aber sie hätte mich gebissen und umgebracht.«
»Möglich. Nächstes Mal bist du vorsichtiger. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht auf den Klippen herumklettern. In den Höhlen unter dem Rand leben viele kleine Tiere und Vögel. Du machst ihnen angst.«
Oma kam mit wehenden Röcken angelaufen und nahm ihn stürmisch in die Arme. »Das kleine Mädchen hatte solche Angst! Sie hat die Schlange gesehen und kam weinend zu uns. Geht es dir gut, mein Junge? Ach, Diamond, der Ärmste, bring ihn ins Haus!«
»Wo ist sie?«, fragte Ben. »Das Mädchen, meine ich.«
»Nach Hause gegangen. Sie schämte sich für das zerrissene Kleid. Ich wollte es nähen, damit es keiner merkt, aber sie ist einfach zum Tor hinausgelaufen. Ich glaube, Miss Phoebe mag unseren kleinen Ben.«
»Pah!«, sagte er wegwerfend. »Ich bin nicht euer kleiner Ben, und das Mädchen mag sowieso niemand.« Trotzdem überraschte es ihn, dass Oma ihren Namen kannte.
Wie peinlich, dass sie ihn gerettet hatte! Das zerstörte seine Tagträume, in denen er sich als ihr Beschützer sah. Sie musste ihn für einen echten Trottel halten.
Während der nächsten Wochen änderte sich Bens Meinung jedoch. Phoebe war immerhin schlau genug gewesen, Hilfe zu holen, ohne die Schlange aufzuscheuchen. Jetzt stand er in ihrer Schuld. Verdankte ihr wahrscheinlich sein Leben. Eines Tages würde er da sein, wenn sie ihn brauchte, würde sie retten. Ein Piratenkapitän, der Lady Phoebe von einem sinkenden Schiff holt …
Die Damen zeigten sich von Lalla Thurlwells »langem Zimmer« verzaubert. Wie sie ihnen erklärte, hatte sie zunächst nicht gewusst, was sie mit diesem Raum anfangen sollte, da Somerset House bereits ein Empfangszimmer und einen Salon besaß.
»Man konnte es kaum als Wohnzimmer benutzen, weil es zu groß ist. Es zieht sich über die gesamte Breite des Hauses, und wegen der davorliegenden Veranda ist es auch nicht sonnig. Die großen Glastüren zum Fluss hinaus erinnerten mich an ein Treibhaus, und deshalb habe ich mich entschieden, den Raum auch dementsprechend einzurichten.«
Mrs. Sutcliffe, die Frau des Parlamentssprecher war begeistert. »Einfach perfekt. Diese himmlischen weißen Rattanmöbel inmitten der herrlichen Topfpflanzen und diese Palmen. Ich würde es als Studie in Grün und Weiß bezeichnen. Und so wunderbar kühl. Ich muss Ihnen wirklich gratulieren, Mrs. Thurlwell.«
Lalla strahlte. »Vielen Dank. Da ich Sie kaum bitten konnte, den Tee mit mir im Treibhaus einzunehmen, habe ich den Raum das ›lange Zimmer‹ getauft.«
Auch Mrs. Buchanan war hingerissen. »Die wunderbaren Teppiche und die kleinen Statuen sind das Tüpfelchen auf dem i, Mrs. Thurlwell. Darf ich so unverschämt sein zu fragen, woher Sie die ganzen Möbel haben? Sie wirken so robust und geräumig.«
Ihre Mutter, die berühmte Belle Foster, eine der wichtigsten Gastgeberinnen von Brisbane, sah sie missbilligend an. »Clara! Sei nicht so unhöflich. Wie du selbst gesagt hast, ist diese Frage unverschämt.«
»Ich dachte doch nur …«, Clara schrumpfte förmlich in sich zusammen, »… wir könnten mit meinem Mann sprechen, bevor wir wieder aufs Land fahren. Wir brauchen neue Möbel, und die Entscheidung fällt mir schwer. Sie müssen die Hitze vertragen können.«
»Das tun sie«, meinte Lalla freundlich. »Ich werde Ihnen die Kataloge zuschicken. Wir haben die Stühle, Tische und Regale aus Hongkong kommen lassen.« Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Allerdings bekam William bei der Lieferung einen Schock.«
»Wieso? Wegen der Rechnung?«, dröhnte Mrs. Foster.
Lalla kicherte. »O nein! Die Kosten spielten keine Rolle. Er war höchst beeindruckt von der Ware, vor allem von diesen geschwungenen Lehnsesseln. Als er dann hörte, dass ich sie alle weiß anstreichen wollte … na ja, Sie können es sich vorstellen! Doch ich sagte ihm, er solle mir einfach vertrauen, und machte mich an die Arbeit. Inzwischen hat er sich daran gewöhnt.«
Mrs. Foster sah sich um. »Gefällt mir. Das langweilige Bambusrohr hätte einfach nicht dieselbe Wirkung.«
Die Frauen drehten sich um, als Dr. Thurlwell in der Tür erschien. Lalla schwebte zu ihm hinüber. Ihre bestickte, seidene Schleppe raschelte leise über den polierten Fußboden. »Meine Liebe.« Er gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Du siehst wunderbar aus.«
Die Gäste seufzten beim Anblick dieses galanten Ehemanns. Lalla sah wirklich hinreißend aus. Aus dem dichten, blonden Haar, das sie seitlich zu zwei Rollen aufgesteckt trug, fielen neckische Strähnen hinab, wodurch ihr gutgeschnittenes Gesicht weicher wirkte. Das weiße, figurbetonte Teekleid war ein Traum. Ein teurer Traum, wie alle insgeheim konstatierten, der von einer Smaragdbrosche am Spitzenkragen gekrönt wurde. Sie hatten gehört, dass sich diese Frau passend zu den Farben ihrer Empfangsräume kleidete, und hier war nun der endgültige Beweis.
»Die Damen wollten gerade gehen«, sagte sie zu ihrem Mann. Er wirkte enttäuscht. »So ein Pech, auf die Gesellschaft drei charmanter Damen verzichten zu müssen, aber die Pflicht rief. Ich hoffe, Sie haben einen erfreulichen Nachmittag verbracht.«
»Allerdings, Doktor. Der Tee war exzellent«, sprudelte Mrs. Sutcliffe hervor.
Mrs. Foster, eine üppige, hochgewachsene Frau, ergriff die Gelegenheit, ihr eins auszuwischen. Das Amt des Parlamentsprechers von Mrs. Sutcliffe beeindruckte sie überhaupt nicht. In Mrs. Fosters Augen waren Politiker die Diener des Volkes und sollten auch dementsprechend behandelt werden. »Weniger hätte ich von Mrs. Thurlwell auch nicht erwartet!«
Als das Mädchen die Gäste zur Haustür begleitete, stieß William seine Frau an. »Hat es geklappt?«
Lalla lächelte zuversichtlich. »Natürlich. Biddy, wo ist Phoebe?«, rief sie einem anderen Hausmädchen zu. »Ich möchte, dass sie sich von den Damen verabschiedet.«
»Ich kann sie nicht finden, Ma'am. Wir haben schon überall nach ihr gesucht.«
»Dann such noch einmal!«, zischte Lalla und segelte hinüber in die weißgeflieste Eingangshalle.
Vor der Tür warteten zwei leichte Kutschen auf die Besucherinnen. Lalla plauderte, während sie innerlich vor Wut kochte. Wo war diese Göre? Sie hatte ihrer Tochter zwar befohlen, sich während der Teezeit nicht blicken zu lassen, sie sollte sich bereithalten, um den Damen auf Wiedersehen zu sagen. Typisch Phoebe, genau dann zu verschwinden, wenn man sie brauchte. Der Himmel mochte wissen, warum er sie mit einer Tochter gestraft hatte, die nicht nur lispelte und völlig unscheinbar aussah, sondern auch noch trotzig und schwierig war, und ihrer Mutter andauernd widersprach …
»Du lieber Gott!«, stieß Mrs. Foster hervor, als Phoebe über den Rasen vor dem Haus auf sie zukam.
Lalla erstarrte. Sie war von Sauberkeit und Ordnung wie besessen. In ihrem Haus hatte alles seinen Platz und durfte keinen Zentimeter verrückt werden. Die Kleidung ihrer Familie musste makellos, perfekt sauber, ohne lose Fäden oder Knöpfe sein.
Und nun dieser Auftritt! In Phoebes Haar fehlte eine Schleife, und der Zopf hatte sich gelöst. Ihr Kleid war zerrissen, ein Ärmel hing herunter, und eine Rüsche vom Saum schleifte lose über den Boden.
»Hallo!«, grüßte sie fröhlich und ging automatisch auf Mrs. Foster zu, die am wichtigsten wirkte. »Hatten Sie einen schönen Tag?«
»Danke der Nachfrage. Was ist denn mit dir passiert, Kind? Bist du vom Baum gefallen?«
Phoebe grinste übers ganze Gesicht. »Ssstimmt. Woher wissen Sie das?«
»So etwas kommt vor.« Mrs. Foster zuckte die Achseln und stieg in die erste Kutsche. »In Zukunft solltest du die Äste prüfen, Kind. Denk dran.«
Lalla stand mit einem gezwungenen Lächeln neben ihrer unglückseligen Tochter, bis die Gäste verschwunden waren. Dann wandte sie sich an Phoebe. »Was ist passiert?«
»Ich bin vom Baum gefallen.«
»Ich habe dir gesagt, Damen klettern nicht auf Bäume!«
»Ja, aber –«
Lalla schüttelte sie. »Dein Aber interessiert mich nicht. Und was hast du in diesem Aufzug draußen vor dem Tor gemacht?«
»Ich war nebenan. Ich habe den Nachbarjungen gesehen und es war –«
»Wie bitte? Du bist nach nebenan gegangen?« Seit die Thurlwells Somerset House bezogen hatten, weigerten sie sich, ihre Nachbarn zur Kenntnis zu nehmen. Tatsächlich hatte William bereits des Öfteren versucht, den Besitz am Ende des Point zu erwerben, doch die Deutsche, die dort lebte, hatte einen Verkauf strikt abgelehnt. So stand noch immer dieses unpassende, bäuerliche Cottage neben dem Herrenhaus der Thurlwells.
»Ich musste es tun«, verteidigte sich Phoebe, woraufhin Lalla ihr einen wütenden Schlag ins Gesicht versetzte.
»Rein mit dir, du missratenes Ding. Biddy! Bade sie gründlich, damit sie wieder wie ein Mensch aussieht. Ich werde mich noch um sie kümmern.« Sie sah, wie ihr Mann die Stirn runzelte. »Warum schaust du mich so an? Willst du etwa, dass sie sich mit denen trifft? Willst du das?«
»Nein, natürlich nicht«, lenkte er ein. William fühlte sich seiner Frau bei Auseinandersetzungen einfach nicht gewachsen. Sie war schlank und anmutig. Ihre Zartheit betonte sie mit den Pastellfarben und kostbaren Stoffen ihrer Kleider. Obwohl er sie liebte und bewunderte, überraschte es ihn doch immer wieder, wie aggressiv sie beim geringsten Widerspruch reagieren konnte. Im Laufe der Jahre hatte er gelernt, Lalla einfach ihren Willen zu lassen, statt ihren verbalen Zorn auf sich zu ziehen.
Zurzeit standen wichtigere Fragen auf dem Spiel. William war ein überzeugter Gegner der Föderation. Seine Vorfahren gehörten zu den Pionieren der großen Viehauftriebe im Nordwesten von Queensland. Nun wollte ein Haufen Reformer alle australischen Staaten zu einem Commonwealth zusammenschließen, eine Entwicklung, die den Thurlwells und ihren Freunden nur Machtverluste und höhere Steuern einbringen würde. Eine Bundesregierung konnte nicht von Luft allein leben. Woher also sollte das Geld kommen, wenn nicht aus den Taschen der Leute, die bereits die Staatsregierungen unterstützten? William hielt die ganze Sache für albern und war froh, dass auch Lalla mit gewohnter Energie den Kampf aufgenommen hatte.
»Was hat Mrs. Foster gesagt?«, fragte er.
»Sie ließ sich leicht überzeugen, da sie Politiker ohnehin nicht ausstehen kann. Beim Gedanken an einen weiteren Haufen dieser Spezies geriet sie in Wut. Sie wird unsere Bewegung mit Freuden unterstützen – auch in finanzieller Hinsicht, wie ich glaube.«
»Hervorragend. Und wie steht es mit Mrs. Sutcliffe?«
»Sie ist eine Närrin. Hat fallenlassen, dass Harold Sutcliffe die Föderation befürworte.«
»Tatsächlich? Das ist interessant. Er selbst hat den Eindruck erweckt, er sei dagegen, und bei Gott, er ist in dem Komitee, das einen Bericht zu der Frage vorlegen soll.«
»Vielleicht ändert er ja seine Meinung.« Lalla lächelte. »Keine Sorge, Mrs. Foster hat seiner Frau gut zugeredet. Als sie mit ihr fertig war, stand Mrs. Sutcliffe ganz auf unserer Seite und hat versprochen, mit ihrem Mann zu sprechen.«
»Falls er ihr zuhört.«
»Das wird er, wenn sie ihn daran erinnert, dass die Fosters einen Haufen Stimmen in seinem Wahlbezirk halten. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Clara Buchanan gestand mir, dass ihr Mann Gefallen an einer Union der Staaten findet. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter es erfährt, damit sie keinen falschen Eindruck von ihm erhält.«
»Hast du es Mrs. Foster erzählt?«
»Natürlich nicht. Ben Buchanan hatte schon immer politische Ambitionen. Er könnte nützlich sein.«
»Dieser verdammte Idiot. Warum bleibt er nicht im Busch und kümmert sich um seinen eigenen Kram?«
»Weil seine Lage im Augenblick nicht gerade rosig ist. Er hat seine Viehstation im Norden verkauft und eine andere bei Charleville erworben. Ungefähr fünfhundert Meilen westlich von hier. Anfangs ging alles gut, doch nun herrscht eine Dürre. Außerdem ist er gern in der Stadt.«
»Aber er ist gegen uns«, gab William zu bedenken.
»Nicht unbedingt. Ich würde vorschlagen, wir suchen nach einem Weg, um Ben Buchanan ins Staatsparlament zu schicken. Unter der Bedingung, dass er sich unserer Bewegung anschließt. Diese Chance wird er sich nicht entgehen lassen.«
William lachte. »Meine Liebe, du solltest selbst Politikerin werden.«
»Nein. Auch wenn Damen zugelassen wären, würde es mir an Geduld fehlen. Buchanan können wir leicht umstimmen. Wir müssen ihn nur ermutigen. Am besten laden wir Clara und Ben zu uns ein, bevor sie nach Hause fahren. Das sollte eigentlich reichen.«
»Jetzt hör mal zu, Kleine«, sagte Biddy, während sie Phoebes Haar bürstete. »Widersprich nicht immer deiner Ma. Sei einfach still.«
»Sie hat mich schon wieder geschlagen!«, schnappte Phoebe zurück.
»Gib nichts drauf. Sie war erschreckt, weil du dein Kleid zerrissen hast, und dachte bestimmt, du seist überfallen worden.«
»Und wenn sschon? Ist dass ein Grund, mich zu sschlagen? Ssie ist ein Biest, ich hasse sie.«
»O Herr im Himmel, so etwas darfst du nicht sagen. Wenn du dich aufregst, fängst du wieder an zu lispeln. Komm, wir üben zusammen: süße Soße, saure Sahne.«
Phoebe wiederholte die Worte ohne die Spur eines Lispelns. Biddy lächelte. »Na bitte. Du kannst das sehr gut. Du vergisst es bloß immer, wenn du dich ärgerst.«
»Mutter sieht das anders …«, erwiderte Phoebe und gab sich besondere Mühe mit der Aussprache. »Sie … sagt … ich sei ein Dummkopf.«
»Aber nein!«, meinte Biddy, doch Phoebe hatte recht. Besorgt band sie ihr eine Schürze um. Es war gut und schön zu sagen, dass man Kinder nicht hören, sondern sehen sollte, doch dieses arme Ding durfte in Gesellschaft nie den Mund aufmachen. Deshalb hatte man sie am Nachmittag aus dem Weg geschafft. Als sich die Besucher verabschiedeten, wollte ihre Mutter sie wie ein Püppchen vorführen. Die Missus war schuld an Phoebes Lispeln, weil sie das Mädchen so herumstieß. Mit den Dienstboten und ihrem Vater kam die Kleine viel besser zurecht. Und je schlechter sie von ihrer Mutter behandelt wurde, desto mehr lehnte sie sich dagegen auf, dachte Biddy. Sie selbst hatte auf die harte Tour gelernt, den Mund zu halten. Doch wie sollte sie das einem Mädchen erklären, das mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen war? Biddy war noch keine dreißig, doch im Vergleich zu Phoebe kam sie sich vor wie Methusalem.
In Phoebes Alter lebte Biddy Donovan, die Tochter irischer Einwanderer, in dem Hüttenviertel im Süden der Stadt. Jim Donovan hatte sich abgerackert und jeden Penny gespart, um mit seiner Familie herzukommen. Er wünschte sich ein besseres Leben und ein gesünderes Klima für seine lungenkranke Frau. Doch die lange Reise war zu viel für sie gewesen. Sie starb, als das Schiff in der Moreton Bay anlegte.
Jim wollte unbedingt das Versprechen halten, das er seiner sterbenden Frau gegeben hatte. Er würde sich um die Mädchen kümmern. Bald fand er einen Job als Straßenarbeiter und mietete für seine Familie ein Häuschen mit zwei Zimmern in Fortitude Valley. Traurig erinnerte sich Biddy daran, wie er selbst auf der winzigen Veranda übernachtete und seine Mädchen – die sechzehnjährige Maureen, die dreizehnjährige Tess und Biddy, die damals zwölf war –, die im Zimmer hinter ihm schliefen, bewacht hatte. Ihr mutiger Papa!
Maureen übernahm die Aufgabe der Haushälterin. Jim gelang es, Tess und Biddy auf die Schule am Ende der Straße zu schicken. Der Unterricht war teuer, eigentlich ein Luxus für eine Familie, die Irland wegen der Hungersnot verlassen hatte. Daher musste Maureen in diesem so reichen Land äußerst sparsam wirtschaften. Als Gegenleistung für ihre Ausbildung bestand Jim darauf, dass die jüngeren Mädchen das Gelernte mit Maureen teilten. Er saß immer dabei, hörte zu und fragte die Mädchen, ob er es aus Spaß auch einmal versuchen könne. Sie schlossen ihn freilich in ihren Unterricht ein, obwohl sie wussten, dass Papa niemals lesen und schreiben gelernt hatte. Er war noch eifriger auf Bildung bedacht als sie. Der arme Papa!
Dann kam der Tag, an dem sie nach der Schule einen kalten Herd ohne Essen vorfand. Maureen lag blutend und zusammengerollt auf ihrem Bett.
Jims Zorn war furchtbar. Die Nachbarn versuchten vergeblich, ihn zu beruhigen. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal hörte Biddy das Wort »Vergewaltigung«. Da Maureen den ganzen Tag allein zu Hause war, hatte sie ein willkommenes Opfer für den Vermieter abgegeben. Er kam unter dem Vorwand, das Haus zu inspizieren, herein und fiel dann über sie her.
Biddy hörte noch immer das Weinen ihres Vaters, der sich die Schuld an dem gab, was Maureen zugestoßen war. Sie hörte noch immer das Flüstern der Frauen – Maureen hätte sich nicht wehren sollen, dann wäre sie auch nicht so zugerichtet worden. Es dauerte lange, bis sich Biddys Zorn legte, bis sie sich nicht mehr wehrte, sondern den Kopf beugte und das harte Leben in der Fabrik akzeptierte. Als sie schließlich eine bessere Stelle als Dienstmädchen gefunden hatte, waren die Tage des Kämpfens vorüber. Biddy konnte sich nun verbeugen, »Ja, Sir, nein, Sir« sagen und sich ihren Teil dabei denken. Das wollte sie auch Phoebe beibringen.
Nie würde sie Maureen vergessen, wie sie mit bandagiertem Kopf im Krankenhaus lag. Ihr Gesicht war zu einem purpurfarbenen Ballon angeschwollen, die blutunterlaufenen Augen blickten wild und verzweifelt. Sie hatte sich nicht mehr erholt und starb sechs Jahre später im Irrenhaus. Die Nachbarn sagten, der Vermieter, Tom Cranston, ein grobschlächtiger, alter Metzger, habe den Verstand aus ihr herausgeprügelt.
Als Jim ihn zur Rede stellte, stritt er alles ab, trotz der Kratzer in seinem Gesicht. Daraufhin riss Jim ihm die Kleider vom Leib und entdeckte die langen Fingernagelspuren auf Brust und Rücken, die er Maureen verdankte. Er schlug Cranston zusammen, was keinen verwunderte. Eigentlich wäre die Sache damit zu Ende gewesen, wenn Jim nicht im Krankenhaus festgestellt hätte, dass Maureen niemanden mehr erkannte und wohl auch niemals mehr erkennen würde.
Da nahm Jim Donovan ein Gewehr und erschoss Cranston vor seinem Laden. Biddys Vater verbüßte noch immer seine lebenslängliche Strafe im Gefängnis von Brisbane.
Die Nachbarn schoben die Donovan-Mädchen von einem Haus zum anderen, bis sie die Schule beendet hatten und in einem Arbeitshaus landeten. Danach lebten sie allein in einem Kellerraum im Hüttenviertel. Biddy konnte nie ganz begreifen, dass Tess auf die Straße gegangen war und nun davon lebte, was Maureen das Leben gekostet hatte.
Als Biddy es schließlich zum Dienstmädchen gebracht hatte, wusste sie nichts Genaues über Männer; sie wollte einfach nur ihre Arbeit tun, ein sauberes Zimmer haben und bezahlt werden … mit anderen Worten, ein sicheres Leben führen. Biddy störte es nicht weiter, wenn andere sie damit aufzogen, dass sie eine alte Jungfer werden würde. Sicherheit ist besser als Herzeleid, sagte sie immer. Sie hatte ihren Vater im Gefängnis besucht, bis er ihr eines Tages befahl, sie solle nicht mehr kommen. Ein Knastbruder als Vater würde sich nicht gut in ihrem Lebenslauf machen. Er gab ihr seinen Segen. Sie solle ein gutes Mädchen sein und ihn in ihre Gebete einschließen. Tess erwähnte er mit keinem Wort, und auch Biddy hatte jeglichen Kontakt zu ihrer Schwester verloren.
Die Köchin sagte einmal: »Das Unglück ist nicht wählerisch. Reich und arm, es kann jeden treffen. Und in meinen Augen ist Miss Phoebe ebenso unglücklich wie wir als Kinder. Eine Schande, dass ihr Vater nicht mal den Mund aufmacht. Ein richtiger Weichling.«
Als die Tür aufging, schreckte Biddy aus ihren Erinnerungen hoch und hielt eine passende Antwort bereit. »Hier ist sie, Madam, und besser als neu.«
Lalla beachtete sie nicht, sondern griff erneut das Kind an. »Wie kannst du es wagen, auf Bäume zu klettern!«
»Ich wollte meinen Ball holen.«
»Dafür haben wir Gärtner. Warum hast du keinen gerufen?«
»Habe ich vergessen.«
Sie packte Phoebe am Ohr und zog sie ans Fenster. »Du lügst. Du bist absichtlich auf den Baum geklettert, um nach nebenan zu kommen. Zieh deine Kleider aus!«
Biddy wusste genau, was nun kam, nahm ihren Mut zusammen und sagte: »Entschuldigen Sie, Madam, aber sie ist vom Baum gefallen. Ein Glück, dass sie nicht verletzt ist.«
»Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt?« zischte Lalla. Sie tippte ungeduldig mit dem Fuß, während Phoebe Schürze und Kleid auszog und ihr trotzig in Unterhemd und Hosen gegenübertrat.
»Nun«, ihre Stimme war leise und drohend, »du bist ohne Ball nach Hause gekommen. Wo ist er?«
»Ist wohl noch im Baum«, lispelte ihre Tochter.
»Hör auf mit dem kindischen Gerede! Du bist nicht vom Baum gefallen, ich sehe nicht einen Kratzer. Du wolltest mich ärgern, oder etwa nicht?«
»Nein!«, schrie Phoebe. »Ich habe den Jungen gesehen und die Schlange, und er hatte Angst und konnte sich nicht bewegen, also bin ich zu seiner Mutter gelaufen und habe es ihr gesagt, und sie ist rausgekommen und die deutsche Dame auch –«
»Ha! Hast du das gehört?«, sagte Lalla zu Biddy. »Sie ist gar nicht vom Baum gefallen.« Sie schüttelte Phoebe. »Oder etwa doch?«
»Nein. Ich bin gesprungen. Ich musste seine Mutter holen.«
»Na bitte, da haben wir die halbe Wahrheit, du missratenes Ding! Plötzlich steht sie als Heldin da. Eine Schlange! Wenn tatsächlich eine da war, wären die Leute sicher auch ohne dich zurechtgekommen.«
»Ich musste ihnen Bescheid sagen.«
Lallas Stimme wurde trügerisch ruhig. »Verstehe. Du hast also eine Schlange in ihrem Garten gesehen und bist völlig unerschrocken hinuntergesprungen, anstatt auf dem sicheren Baum zu bleiben. Und dann?«
Biddy bemerkte, dass Phoebe das Interesse ihrer Mutter für echt hielt und bei der atemlosen Erklärung sogar das Lispeln vergaß. »Du hättest sehen sollen, was passiert ist! Der Junge konnte sich nicht bewegen, weil die große Schlange direkt vor ihm war. Sie wiegte den Kopf hin und her und konnte jederzeit beißen, daher bin ich zum Haus gerannt und habe den beiden Damen Bescheid gesagt.«
»Damen!« Lallas Stimme klang angewidert.
Phoebe war nicht zu bremsen. »Ich habe ihnen von der Schlange erzählt, und die Mutter des Jungen ging hinunter und setzte sich hinter die Schlange ins Gras und sang leise ein kleines Lied, das wir kaum hören konnten.«
»Wer ist wir?«
»Die deutsche Dame. Du weißt schon.«
»Ich weiß gar nichts!«
Biddy unterdrückte einen Seufzer. Die Thurlwells lebten seit mehr als zwölf Jahren neben Mrs. Beckman.
»Egal, seine Mutter saß bloß ganz dicht bei der Schlange und sang, und diese wandte sich von dem Jungen ab und zu seiner Mutter, und sie hat ihr lange zugehört, und es ist nichts passiert. Dann ist sie irgendwann davongekrochen, als hätte die Mutter ihr gesagt, sie solle brav sein und verschwinden.«
»Verstehe. Sie hat der Schlange also befohlen, nach Hause zu gehen?«
»Ja.«
Lalla holte blitzschnell aus und versetzte ihrer Tochter eine so heftige Ohrfeige, dass Phoebes Kopf gegen die Fensterbank schlug.
Biddy schoss in die Höhe, als sei sie selbst geschlagen worden, traute sich aber nicht einzugreifen.
»Ein Haufen Lügen! Soll ich diesen Mist etwa glauben? Du hast mit dem Jungen gespielt. Hat er dich angefasst?« Sie schüttelte ihre Tochter. »Wo hat er dich berührt?«
»Nirgendwo!«, schrie Phoebe.
»Du hast also mit ihm gespielt!«
»Nein.«
Lalla holte die Rute aus dem Schrank. Sie zwang ihre Tochter, sich über einen Stuhl zu beugen, und schlug sie, bis ihr Zorn verraucht war. Dann wandte sie sich erschöpft an Biddy. »Eigentlich müsste sie untersucht werden.«
»O nein, Ma'am«, flehte Biddy.
Phoebe hatte die ganze Zeit keinen Laut von sich gegeben. Unvermittelt sagte sie jetzt zu ihrer Mutter: »Ich hasse dich!«
Lalla seufzte und ordnete vor dem Spiegel ihre Frisur. »Nein, das tust du nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Kind solche unglaublichen Geschichten ausdenkt. Du kommst jetzt in die Pubertät, da muss ich wohl noch besser auf dich aufpassen. Biddy, sie denkt, man hätte ihr übel mitgespielt, aber eine Mutter hat gewisse Pflichten. Ich weiß, auf welche Ideen Mädchen kommen können.«
»Sprechen wohl aus Erfahrung«, murmelte Biddy.
»Wie bitte?«
»Ist eine schlimme Erfahrung«, improvisierte Biddy eilig.
»Allerdings. Bring sie zu Bett. Ohne Abendessen.«
»Aber sie hatte auch keinen Tee.«
»Dann eben Wasser und Brot.«
Biddy stupste das Mädchen an, während sie ihm das Nachthemd über den Kopf streifte. Phoebe wusste genau, dass Biddy ihr nicht nur Wasser und Brot, sondern auch einige Leckereien bringen würde, eingewickelt in Lallas gute Damastservietten. Sie liebte Biddy und verstand, warum die Dienstboten ihrer Mutter nicht widersprechen konnten, so gemein sie auch sein mochte. Aber sie selbst konnte es. Um ihr den Mund zu verschließen, müsste ihre Mutter sie schon umbringen.
Als die Erwachsenen das Zimmer verlassen hatten, legte sich Phoebe auf den Bauch und stöhnte vor sich hin. Ihr Ohr tat weh, und der Hintern brannte wie Feuer. Sie schwor sich, es ihrer Mutter irgendwann einmal, vor all ihren wichtigen Freunden, heimzuzahlen – wenn sie erst ihr Lispeln überwunden hatte. Sie würde so gern eine richtige Szene machen …, irgendwann einmal.
Sie dachte wieder an die Nachbarn. Warum hasste ihre Mutter sie nur? Die Mutter des Jungen war sehr würdevoll und hatte wunderschöne dunkle Augen. Sie war nicht in Panik geraten, als Phoebe ihr von der Schlange erzählte; ihr Lächeln wirkte so zärtlich, als habe sie das Mädchen schon immer gekannt. Die alte Dame reagierte ängstlich und hatte sich an Phoebe festgeklammert, während sie sich das Drama ansahen. Für das Mädchen war es tröstlich und ungewohnt gewesen, sich in die Röcke dieser rundlichen Dame zu kuscheln, die so gut nach sauberem, gebügeltem Leinen duftete. Lalla hingegen verströmte immer einen überwältigenden Hauch von Parfüm.
»Du bist ein gutes Kind«, hatte die deutsche Dame gesagt, als die Schlange verschwand. »Komm herein, dann stopfe ich dir dein Kleid.«
»Nein, nein! Vielen Dank, aber ich muss gehen.« Phoebe war davongelaufen und hatte sich keine Gedanken über ihr zerrissenes Kleid gemacht, bis sie über den Rasen kam, die gaffenden Frauen und den kalten Blick ihrer Mutter sah.
»Biddy«, erkundigte sie sich, als das Hausmädchen mit dem armseligen Tablett und der heimlichen Zuteilung an Hähnchensandwiches und knusprigen Nussplätzchen auftauchte. »Was hat meine Mutter gegen unsere Nachbarn?«
»Keine Ahnung«, antwortete Biddy ohne jeden weiteren Kommentar.
»Es stimmt, was ich Mama erzählt habe. Das mit der Schlange.«
»Ich glaube dir ja, aber lass es jetzt gut sein, Liebes. Lass es einfach gut sein.«
Die Geschichte mit der Schlange war lange vergessen. Die Jahre vergingen, und Diamond sorgte sich zunehmend um die Zukunft ihres Sohnes.
»Ben ist vierzehn, Oma. Wir müssen eine Stelle für ihn finden. Er kann doch nicht weiter für uns als Gärtner und Mädchen für alles arbeiten; er braucht einen richtigen Beruf.«
»Ich weiß, meine Liebe, ich weiß.« Auch Gussie Beckman machte sich Gedanken. »Ich habe mich schon erkundigt, aber sobald ich erwähne, dass er farbig ist, winken alle ab. Ich erzähle ihnen, dass er gebildet ist und gutes Englisch spricht, aber sie hören überhaupt nicht zu.«
Diamond lächelte. »Irgendetwas wird sich ergeben. Als ich in dem Alter war, hast du auch eine Stelle für mich gefunden.«
»Als Hausmädchen. Du hättest etwas Besseres verdient«, erwiderte Oma und rümpfte die Nase.
»Mehr konntest du für ein schwarzes Mädchen nicht tun, und ich habe es doch geschafft. Du bist müde, und die Nacht ist kalt. Geh ins Bett, ich werde dir einen heißen Kakao machen.«
Gussie legte die Stickerei weg und erhob sich schwerfällig aus dem Sessel. »Gott, ich werde zwar alt, Liebes, aber meinen Kakao kann ich mir noch selber kochen.«
»Das wirst du aber nicht. Ab ins Bett, ich habe es schon aufgedeckt.«
Die alte Frau zog sich den Schal enger um die Schultern. »Du verwöhnst mich viel zu sehr.«
»Dich verwöhnen?«, wiederholte Diamond. »Nach allem, was du für mich getan hast? Mach, dass du ins Bett kommst.« Sie ging in die Küche, zündete das Feuer an und setzte die Milch auf den Herd. Dann betrachtete sie vom Fenster aus die funkelnden Lichter von Brisbane am anderen Flussufer und erinnerte sich an das zwölfjährige Aborigine-Mädchen, das der Kapitän und Gussie Beckman voller Güte adoptiert hatten.
Als die Beckmans sie mit nach Hause nahmen, war sie vor Angst völlig außer sich gewesen. In der ersten Nacht verbarg sie sich im Holzschuppen und weigerte sich, herauszukommen. Doch sie hatten Geduld bewiesen und allmählich ihr Vertrauen gewonnen. Gussie sagte oft, dass Diamond ihr Leben völlig verändert und die Einsamkeit einer Seemannsfrau in einem fremden Land vertrieben hatte. Sie nannten sie Diamond nach der Gräfin Diamantina, der Frau des Gouverneurs von Queensland. Die Gräfin kam aus Europa. Da Gussie Deutsche war und mit dem neuen Land und der fremden Sprache zu kämpfen hatte, erkor sie diese Frau zu ihrer Heldin. Gussies Ehemann befuhr als Kapitän eines Handelsschiffes, dessen Heimathafen Brisbane war, die Route zwischen Melbourne und Java. Er kam oft monatelang nicht nach Hause. Die ersten Jahre in Brisbane verliefen für Gussie sehr unglücklich. Bis Diamond auftauchte. Gussie nahm sich ihrer mit aller aufgestauten Liebe und Energie an. Sie brachte ihr Englisch bei, das Diamond auch heute noch mit einem leichten deutschen Akzent sprach, lehrte sie kochen und nähen. Später übernahm Gussie ihre Schulausbildung, als sei Diamond ihre eigene Tochter. Wenn der geliebte Kapitän nach Hause kam, geriet das ganze Haus in Aufregung. Diamond las ihm vor und zeigte ihm die Aufgabenhefte, in denen sie mit Gussies Hilfe schreiben und rechnen geübt hatte. Natürlich erst nach dem Festessen, das Gussie zur Feier des Tages zubereitet hatte.
Diamond seufzte beim Gedanken an dieses Willkommensessen. Bis das Schicksal zugeschlagen hatte, waren sie eine glückliche, kleine Familie gewesen, genau wie jetzt mit Ben. Doch auch das augenblickliche Trio würde nicht von Dauer sein. Sie wusste so viele Dinge, die sie anderen Menschen nicht erklären konnte. Erdgeschichten, Ursprüngliches Wissen ihres Stammes, das von einer anderen Bewusstseinsebene herrührte, an der sie niemals gezweifelt hatte. An Ben konnte sie es nicht weitergeben, da er die Familientraditionen der Aborigines nicht kannte. Sein Vater war ein Weißer. In der erlernten Sprache bezeichnete Diamond diese Gedanken als Intuition und beließ es dabei, doch sie wusste, dass über ihrem Glück ein Sturm aufzog. Manchmal saß sie nachts stundenlang am Rand der Klippen und suchte nach einem Leitstern, einem Muster an diesem wunderbar geordneten Himmel, nach einem Plan, der Ben seinen Lebenspfad weisen könnte.
Als die Milch schließlich überkochte, sprang sie auf, rettete die Überreste und säuberte den Herd. Dann machte sie Gussies Tablett fertig.
Oma – Ben benutzte immer das deutsche Wort für Großmutter – kniete im Nachthemd neben dem Bett und betete. Wie immer stimmte Diamond in den letzten Vers mit ein. »Gott segne unseren lieben Kapitän, und er wache im Himmel über uns. Amen.«
Als Gussie bequem im Bett lag, reichte Diamond ihr das Tablett. »Ben scheint fest entschlossen, auch zur See zu fahren«, sagte sie, doch die alte Dame schüttelte den Kopf.
»Das darfst du nicht zulassen. Nicht, weil das Schiff des Kapitäns untergegangen ist; das war der Wille Gottes. Aber das Leben eines farbigen Jungen auf einem Schiff wäre entsetzlich, völlig wertlos. Er könnte es höchstens zum einfachen Matrosen bringen. Da ist das Überleben schon schwer genug. Diamond, er ist ein hübscher Junge!«
Diamond lachte. »Ich weiß. Ich bin stolz auf Ben, weil er so schön ist. Diese wunderbare, olivbraune Haut und das glatte, braune Haar, das er von seinem Vater geerbt hat. Es ist nicht so kraus wie meines. Wenn er erwachsen ist, wird er ein gutaussehender Mann. Was sollte daran falsch sein?«
Während sie dies sagte, entdeckte Diamond die Angst in Gussies Augen. »Oma, was ist denn los?«
»Gib mir meinen Rosenkranz«, sagte Oma. Sie umklammerte ihn fest und flüsterte: »Der Kapitän hat niemals über solche Dinge gesprochen, aber ich bin mit ihm gereist. Wenn keine Frauen da sind, tun Männer seltsame Dinge. Als ich an Bord war, peitschte er einmal einen Mann aus, der einen Matrosen angegriffen hatte. Ich besuchte das Opfer im Krankenrevier und war schockiert. Weil ich die Sache noch immer nicht verstand, durchkämmte ich die Logbücher nach ähnlichen Auspeitschungen und habe sie auch gefunden. Die Männer wurden wegen Unzucht bestraft. Und nun höre mir gut zu. Ben würde an Bord eines Schiffes sehr gefährlich leben und stünde als farbiger Junge vermutlich nicht einmal unter dem Schutz der Offiziere.«
»Wenn jemand meinen Sohn anfasst, werde ich ihn verfluchen, dass er es nicht überlebt«, erwiderte Diamond entschlossen.
»Ein bisschen spät. Ich mache mir Vorwürfe, weil ich ihm die ganzen Geschichten über den Kapitän in den Kopf gesetzt habe. Dadurch kennt er nur den angenehmen Teil des Seemannslebens.«
»Nein, nein! Die Erinnerung an den Kapitän hat uns zur Familie gemacht. Wenn Ben darauf besteht, müssen wir ihm die Sache eben erklären. Als erwachsener Mann kann er dann seine eigenen Entscheidungen treffen.«
Auf dem Weg in die Küche warf Diamond einen Blick in Bens Zimmer. Ihr Sohn schlief tief und fest unter der weichen Decke mit dem bestickten Überzug. Er hatte einen Arm weit ausgestreckt und wirkte so verletzlich, dass sie es kaum ertragen konnte.
Hätte sie ihm noch mehr beibringen können? Wie man sich schützte? Welchen Schutz gab es denn überhaupt? Ihr Wissen darüber stammte aus den Nebeln der Zeit, wie etwas, das immer schon existiert hatte. Ben war zur Hälfte weiß. Würde ein Teil dieses Wissens, dieser mystischen Wahrnehmung jemals zu ihm durchdringen? Er war nicht mit der Schlange fertig geworden. Wenn sie nicht gekommen wäre, um das Tier zu beruhigen, hätte es ihn vielleicht gebissen.
Diamond erinnerte sich an den Zwischenfall mit der grausamen Haushälterin, von dem sie Gussie niemals erzählt hatte.
Als der Tod des Kapitäns gemeldet wurde, brach ihre ganze Welt zusammen. Da sie völlig mittellos dastand, sah sich Gussie gezwungen, zu ihrer Familie nach Deutschland zurückzukehren, doch sie konnte Diamond nicht mitnehmen.
»Sie hat ihr Bestes getan«, murmelte Diamond.
Gussie hatte für sie eine Stelle mit Unterkunft als Hausmädchen gefunden und ihr alles Geld, das sie entbehren konnte, gegeben.
»Im Grunde war ich damals noch immer eine Wilde«, erinnerte sie sich. Wie sie unter den Kränkungen und Schlägen der Haushälterin gelitten hatte. Wenn sie an die Folgen dieser Misshandlungen dachte, empfand sie noch immer Schuldgefühle. Die Haushälterin starb an einem Schlangenbiss, und das Tier war nicht zufällig in ihr Zimmer geraten …
Nein, diese Geschichte würde Gussie nicht gefallen. Ansonsten hatte sie ihr fast alles erzählt. Wie sie nach Norden gereist war und gelernt hatte, sich schwarze wie weiße Männer vom Leib zu halten, bis sie sich schließlich in Ben Buchanan verliebte, den Inhaber der Caravale-Viehstation. Sie erlebte eine wunderbare Zeit voller Romantik und hoffte, mit Ben als Liebhaber endlich ein Zuhause zu finden, doch es kam anders. Ben beschloss, eine weiße Frau zu heiraten, und wies Diamond kalt aus dem Haus.
Einige Jahre lang hatte sie jede Arbeit übernommen, um sich durchzuschlagen. Schließlich schloss sie sich einigen Freunden an, die zu den Palmer-Goldfeldern im Norden zogen. Ursprünglich lag Diamonds einziges Ziel darin, Mitglieder ihres eigenen Stammes, der Irukandji, zu treffen. Doch die Stammesangehörigen zeigten ihr die Goldvorkommen, so dass sie für den Rest ihres Lebens ausgesorgt hatte.
Dann erfuhr sie, dass sich auch Ben Buchanan auf den Goldfeldern aufhielt und wie so viele andere krank geworden war. Er hatte Fieber. Diamond war glücklich, ihn zu pflegen, und brachte ihn an die Küste. Sie konnte es kaum erwarten, ihm die gute Neuigkeit zu berichten, dass sie heimlich ein Versteck mit Goldnuggets angelegt hatte. Mit der Gesundheit kehrte jedoch auch sein altes Selbst wieder zurück, der arrogante Viehzüchter, der sie voller Verachtung als ›Niggerfrau‹ behandelte und schließlich – mittellos, wie er glaubte – in einer kleinen Hafenstadt im Norden zurückließ.
Wieder hatte er Diamond das Herz gebrochen, doch nun war sie außerdem schwanger. Sie kehrte nach Brisbane zurück, fest davon überzeugt, dass kein Geld der Welt ihr den geliebten Mann ersetzen könne.
Sie schloss Bens Zimmertür und ging zurück in die Küche.
Die Zeit hatte die Wunden geheilt, und sie empfand diesem Mann gegenüber keine Verbitterung mehr. Die Geburt ihres Sohnes war die größte Freude ihres Lebens. Das Gold erwies sich dabei selbstverständlich als äußerst nützlich. Diamond hatte das Haus gekauft, was sich nicht einfach gestaltete, da niemand an eine ›Niggerfrau‹ verkaufen wollte. Daher schrieb sie an ihre Adoptivmutter und lud sie ein, nach Australien zurückzukehren. Gussie Beckman war überglücklich, von ihr zu hören. Seit Jahren hatte sie von den Almosen ihrer Verwandten gelebt, die sie nicht mochten, und so bestieg sie das erstbeste Schiff nach Brisbane.
Da eine Aborigine mit einem Haufen Gold zu viel Aufsehen erregt hätte, verkaufte ihr Anwalt Joseph Mantrell die Nuggets nach und nach. Er eröffnete ein Konto auf den Namen Augusta Beckman, und auch das Haus kauften sie auf Gussies Namen. Als Diamond ihm berichtete, dass die nördlichen Goldvorkommen noch lange nicht erschöpft seien, legte er Geld für sie – und ganz nebenbei auch für sich – in Goldaktien an, was sich für beide Seiten zu einem profitablen Unternehmen entwickelte. Nur Mantrell wusste, dass seine ruhigen, zurückhaltenden Mandantinnen reiche Frauen waren.
Über den Hügeln zog der Donner auf, und Diamond schloss die Fenster an der Vorderseite des Hauses. Das kommende Gewitter machte sie nervös. Auch in ihrem Leben zog ein Unwetter auf, und sie wusste nicht, wie sie es verhindern sollte.
»Wir müssen etwas für Ben finden«, flüsterte sie. »Ich will ihn auf einen sicheren Weg führen, auf dem er nicht dieselben Demütigungen zu erleiden hat, die ich erdulden musste.«
Als Gussie mit der guten Neuigkeit heimkehrte, dass sie für Ben eine Stelle gefunden hatte, war seine Mutter begeistert. »Wo denn, Oma? Erzähl schon.«
»Es ist nichts Besonderes«, sagte Gussie und nahm den Hut ab. »Ich entdeckte ein Schild mit der Aufschrift ›Junge gesucht‹ und bin gleich hineingegangen. Ich habe mich mit Mr. O'Neill, einem netten Mann, unterhalten. Er besitzt große Stallungen und eine Sattlerei in New Farm.«
»Und was soll Ben für ihn tun?«
»Er sagte, er könne als Stallbursche anfangen und den Umgang mit Pferden lernen. Wenn er tatsächlich ein guter Junge sei –«
»Du hast gesagt, er sei ein guter Junge?«, fragte Diamond eifrig nach.
»Warum nicht? Ich sagte, er sei ein guter Junge, aus gutem Haus und gebildet. Mr. O'Neill war überrascht, als er erfuhr, dass Ben lesen und schreiben kann, obwohl –«
»Obwohl er farbig ist?«, ergänzte Diamond.
»Genau. Lass den Kopf nicht hängen, Kleines. Mr. O'Neill erklärte mir, er habe selbst einen Sohn, der ein bisschen älter ist als Ben und sich mit dem Lernen furchtbar schwergetan hat. Heißt Cash oder so ähnlich. Er arbeitet jetzt in der Sattlerei, und deshalb brauchen sie einen Stallburschen. Ben hätte dann Gesellschaft.«
»Falls man ihn akzeptiert«, meinte Diamond.
»Ach was! Jungen sind alle gleich. Ich werde morgen früh mit Ben hingehen. Wo steckt er denn?«
»Ich weiß nicht, er ist nach dem Essen weggegangen. Wahrscheinlich wieder zu den Docks.« Sie sah Gussies missbilligenden Blick. »Ich kann ihn doch nicht einsperren, er ist kein Baby mehr!«
»Ja, ich weiß. Doch er wird ja bald arbeiten und keine Zeit mehr haben, sich dort herumzutreiben.« Sie nahm ihre Geldbörse heraus und legte einige Sovereigns auf den Tisch. Gussie hatte jeden Monat die Aufgabe, Geld von der Bank zu holen und die Konten zu überprüfen. Manchmal ging Diamond mit und wartete draußen. Anschließend machten sich die beiden Frauen einen schönen Tag und spazierten durch den Botanischen Garten, den Diamond so liebte. Früher hatte sich Ben auf diese Ausflüge gefreut, dann aber das Interesse daran verloren. Allerdings ging er noch immer gern mit ihnen auf die Märkte, um den Rufen der Marktschreier zu lauschen, kandierte Äpfel zu essen und mit seinen Freunden zu plaudern.
Auf den Samstagsmärkten hatte Diamond zum ersten Mal die zerlumpten Bettler gesehen, Bens Freunde von den Docks. Sie taten ihr leid, doch sie erkannte auch die schlauen, berechnenden Blicke ihrer Augen, die vorzeitig gealtert waren, und machte sich Sorgen um ihren Sohn. Immer wieder versuchte sie Ben davon zu überzeugen, dass dies kein Umgang für ihn sei, doch sie predigte tauben Ohren. Keines der weißen Kinder aus der Nachbarschaft durfte mit ihm spielen, und er schien auch gar nicht an ihnen interessiert zu sein. Die nötige Freude und Unterhaltung fand Ben dort unten auf den Docks, wo er gleichaltrige Freunde getroffen hatte. Dachte er zumindest.
»Ich habe den Kontoauszug mitgebracht«, sagte Gussie.
Die Frauen studierten die gestochene Handschrift. Dies war die Quelle ihres Lebensunterhalts, und sie überprüften den Beleg sorgfältig auf Abweichungen in der festen Überzeugung, dass die Banken sie betrügen könnten. Diamonds Gold war kein Gesprächsthema mehr, sie erwähnten nur den gemeinsamen Notpfennig, der dank ihres sparsamen Lebensstils und des Erfolges an der Börse noch immer bei mehr als zehntausend Pfund stand.
Nachdem sie den Kontoauszug studiert hatten, grinste Diamond. »Wir sind noch immer nicht pleite.« Das war ein alter Scherz zwischen den Frauen, die schreckliche Angst vor der Armut hatten. »Ich bin froh, dass du einen Job für Ben gefunden hast. Ich dachte schon, wir müssten von hier fortgehen und ihm eine Farm kaufen.«
»Guter Gott! Er ist zu jung für eine eigene Farm, ich bin zu alt, um eine zu leiten, und du hast nicht die geringste Ahnung davon.«
Diamond zuckte die Achseln. »Nur so eine Idee. Wenn er ein bisschen älter wäre, würde ich ihm ein Stück Land kaufen. Das wäre genau das Richtige.«
»Eins nach dem anderen«, meinte Gussie streng. »Er soll zuerst etwas lernen.«
Diamond sah zur Hintertür. Wo blieb Ben? Die Nachmittagssonne ging schon langsam unter. »Wirst du ihm eine Unterstützung zahlen, wenn mir etwas zustoßen sollte? Aber gib ihm nicht das ganze Geld, das auf der Bank liegt.«
»Dir wird nichts zustoßen. Ich bin doch die alte Frau. Ich habe mein Testament verfasst und bei Mr. Mantrell hinterlegt. Er wird dir alles zurückgeben. Ich habe sowieso Angst mit dem ganzen Besitz, Diamond. Du hast jetzt deinen Platz in der Gesellschaft, so dass dich niemand mehr belästigen kann. Ich möchte dir alles zurückgeben.«
»Nein. Wie wir wissen, besitzt Ben noch nicht genug Menschenkenntnis.« Sie lachte. »Wahrscheinlich, weil er es nicht auf die harte Tour lernen musste, so wie ich. Du wirst schon wissen, wann die Zeit gekommen ist, es ihm zu überschreiben. Wenn er genug Verantwortungsgefühl hat, um für euch beide zu sorgen.«
Gussie schüttelte den Kopf. »Hör auf mit diesem morbiden Geschwätz. Du wirst nervös, weil Ben noch nicht zu Hause ist. Mach dir nicht zu viel Sorgen. Er ist ein guter Junge und wird bald kommen.«
Ben verbrachte einen herrlichen Tag. Ein großes Schiff war den Fluss hinaufgekommen, die Southern Star