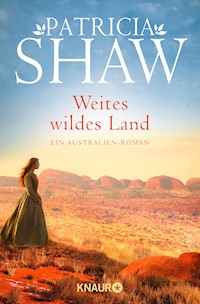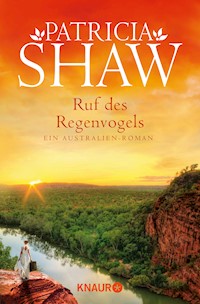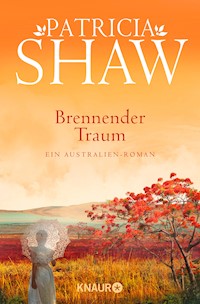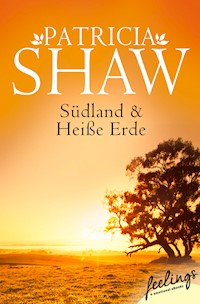
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pioniergeist und Abenteuerlust, große Gefühle und tödliche Gefahr: Teil 1 und 2 der Tal-der-Lagunen-Serie in einem Band! »Südland« erzählt auf unerreicht fesselnde Weise von der Eroberung des fünften Kontinents im 19. Jahrhundert – und vom erbitterten Widerstand der Ureinwohner, deren mythische Welt gegen die Siedler aus Europa keine Chance hatte. Über mehr als hundert Jahre spannt sich der Bogen dieses australischen Epos, in dem ganze Familiendynastien für ihren Traum von einem neuen Leben kämpfen. »Heiße Erde« Australien um die Mitte des 19 Jahrhunderts: Wie ein Buschfeuer flammt die Leidenschaft zwischen der jungen Politikertochter Laura und dem Farmer Paul McNamara auf. Doch bald müssen sie erkennen, dass sie im Kampf um die heiße Erde des Landes auf verschiedenen Seiten stehen, denn Lauras Vater will gegen die Farmer die Abspaltung von Pauls Heimatprovinz Queensland erzwingen. Durch die Lügen eines skrupellosen Geschäftemachers wird Paul dazu verleitet, einen Rachezug gegen die Aborigines zu beginnen. Der Sturm der Ereignisse reißt alle mit sich, harte Pioniere, Glücksritter, ehrgeizige Politiker und die mutigen Frauen des Grenzlandes. »Südland« und »Heiße Erde« sind historische Romane, Familiensagen und Abenteuergeschichten zugleich. »Südland + Heiße Erde« ist ein eBook von feelings –emotional eBooks*. Mehr von uns ausgewählte romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks Genieße jede Woche eine neue Liebesgeschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1881
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Patricia Shaw
Südland & Heiße Erde
Zwei Romane in einem Band
Knaur e-books
Über dieses Buch
Pioniergeist und Abenteuerlust, große Gefühle und tödliche Gefahr: Die ersten beiden Teile der Tal-der-Lagunen-Saga jetzt in einem Band!
»Südland«erzählt auf unerreicht fesselnde Weise von der Eroberung des fünften Kontinents im 19. Jahrhundert – und vom erbitterten Widerstand der Ureinwohner, deren mythische Welt gegen die Siedler aus Europa keine Chance hatte. Über mehr als hundert Jahre spannt sich der Bogen dieses australischen Epos, in dem ganze Familiendynastien für ihren Traum von einem neuen Leben kämpfen.
»Heiße Erde« Australien um die Mitte des 19 Jahrhunderts: Wie ein Buschfeuer flammt die Leidenschaft zwischen der jungen Politikertochter Laura und dem Farmer Paul MacNamara auf. Doch bald müssen sie erkennen, dass sie im Kampf um die heiße Erde des Landes auf verschiedenen Seiten stehen, denn Lauras Vater will gegen die Farmer die Abspaltung von Pauls Heimatprovinz Queensland erzwingen. Durch die Lügen eines skrupellosen Geschäftemachers wird Paul dazu verleitet, einen Rachezug gegen die Aborigines zu beginnen. Der Sturm der Ereignisse reißt alle mit sich, harte Pioniere, Glücksritter, ehrgeizige Politiker und die mutigen Frauen des Grenzlandes.
Inhaltsübersicht
Südland
Ein Australien-Roman
Aus dem Englischen von Peter Robert und Peter Pfaffinger
Die Geschichte Australiens
liest sich nicht wie Historie,
sondern wie die wunderbarsten Lügen …
Sie ist voller Überraschungen und Abenteuer,
voller Ungereimtheiten und Unwahrscheinlichkeiten,
aber es ist alles wahr;
es ist alles wirklich so gewesen.
Mark Twain
Vereinigte Staaten 1957
1. Kapitel
Eine schwarze Limousine glitt durch die VIP-Einfahrt des La-Guardia-Flughafens und wurde von den Wachposten an der zweiten Kontrollstelle durchgewinkt.
Eduardo Rivadavia beugte sich vor und tippte dem Fahrer auf die Schulter.
»Wissen Sie, wohin Sie fahren müssen?«
»Ja, Sir«, versicherte ihm der Chauffeur. »Wir sind rechtzeitig da.«
Eduardo schüttelte den Kopf und ließ sich zurücksinken. Flughäfen kamen ihm immer noch wie ein Labyrinth vor, und als er jetzt zwischen Reihen von Privatmaschinen hindurchfuhr, die ihre Nasen in die Luft streckten, fragte er sich, wie die Besitzer ihre Maschinen jemals fanden.
Er zündete sich eine Zigarre an und lehnte sich noch weiter zurück, so daß man ihn von draußen nicht sehen konnte. Er haßte diesen Wagen. Aber als argentinischer Botschafter bei den Vereinten Nationen hatte er keine andere Wahl, als sich in dieser langen, häßlichen Limousine in New York herumkutschieren zu lassen.
Wenn der Nieselregen nicht gewesen wäre, hätte er vielleicht die Gelegenheit genutzt und sich einige dieser kleinen Flugzeuge genauer angesehen. Seine Schwester Maria lag ihm die ganze Zeit in den Ohren, daß er eins kaufen sollte. Sie hatte einen Texaner geheiratet und lebte in Dallas. Da die übrige Familie in Argentinien wohnte, machte Maria sich Sorgen, daß Eduardo in New York einsam sein könnte.
Er seufzte. Jetzt, wo sein einziges Kind im Begriff war zu heiraten, würde Maria ihn um so mehr drängen, ein Flugzeug zu kaufen. Er konnte sie nicht davon überzeugen, daß eine solche Extravaganz problematisch wäre. Bei der Wirtschaftskrise in Argentinien würde die Nachricht, daß einer ihrer Diplomaten sich ein Privatflugzeug anschaffte, geradezu eine Einladung zu Nachforschungen sein. Sie begriff nicht, daß einem Botschafter Grenzen gesetzt waren. Die Rivadavia-Unternehmen würden dieses Flugzeug kaufen, argumentierte sie; es würde die Regierung keinen Pfennig kosten. Er konnte ihr nicht klarmachen, daß die Öffentlichkeit kein Interesse an solchen Feinheiten haben würde. Die Opposition würde dafür sorgen, daß er in den Ruch der Korruption kam. Wie auch immer, er mochte lieber die großen Passagiermaschinen, und die Betriebsamkeit der Flughäfen gefiel ihm.
Maria war schon immer so gewesen: Was sie hatte, das sollten auch die anderen haben. Ihre Begeisterung für neue Spielsachen, wie Eduardo es nannte, war zum Familiengespött geworden. Und da ihr Mann, Hank Wedderburn, ein Privatflugzeug besaß, würde sie der Rivadavia-Familie keine Ruhe lassen, bis auch die Verwandtschaft ein Flugzeug besaß.
Es regnete immer noch. Es war dieser öde, graue, gedämpfte Regen, der beinahe schüchtern wirkte, als hoffte er, die hochtrabenden New Yorker würden keine Notiz von ihm nehmen. Rivadavia stippte seine Zigarre aus und machte das Fenster zu.
Ich sollte glücklich sein, sagte er sich. Meine Tochter heiratet heute. Sie heiratet einen netten jungen Mann, der sich etwas aus ihr macht; einen sensiblen Burschen aus Verhältnissen, die unseren eigenen nicht unähnlich sind, aber von so weit weg! Wer hätte sich träumen lassen, daß sie einen Australier heiraten würde?
Elena hatte ihn ausgelacht.
»Daddy! Warum sagst du dauernd ›so weit weg‹. Argentinien ist auch weit weg von allem, also wo ist da der Unterschied? Und wir werden auf einer Ranch wohnen. Für mich ist das schon komisch. Ich bin von der Ranch weg, um nach New York zu gehen, und jetzt lande ich auf einer anderen Ranch.« Eine andere Ranch, hatte sie gesagt, als ob sie bloß ein Stück weiter unten an der Straße läge. Junge Leute! Sie hatten meistens keine Ahnung, worauf sie sich einließen. Er hatte noch nicht herausbekommen, was für eine Ranch das war, außer daß sie dort auch Viehzucht betrieben. Er hatte keine Lust gehabt, ihren Bräutigam allzusehr auszuhorchen, und bis jetzt nur in Erfahrung gebracht, daß die Ranch auf keiner Karte verzeichnet und weit von einer Stadt entfernt war.
Luke MacNamara hatte ihm erzählt, das Haus sei komfortabel und Elena werde es dort gut haben, aber die Maßstäbe waren ja verschieden. Was meinte er mit gut? Seine Tochter Elena Maria Rivadavia de Figueroa war einen hohen Lebensstandard gewöhnt, wie alle Rivadavias seit Generationen; aber das Paar war so begeistert von der gemeinsamen Zukunft, daß es seine Fragen nicht ernst nehmen würde. Er wünschte, seine Frau wäre noch am Leben; jetzt hätte er sie gebraucht. Sie wäre resoluter gewesen.
Normalerweise hätte er mit den Eltern des jungen Mannes gesprochen, bevor er seine Erlaubnis gab, aber da Lukes Vater tot war und seine Mutter heute morgen aus Australien kommen sollte, hatte es keine Gelegenheit gegeben, weitere Fragen zu stellen, abgesehen von der diskreten Überprüfung seitens der argentinischen Botschaft.
Na schön. Sollten sie miteinander glücklich werden. Sollten sie doch heute alle im Glück schwimmen! Eduardo zog es vor, deprimiert zu sein. Hank und Maria waren so aufgeregt wegen der Heirat, als ob es um ihre eigene Tochter ginge. Er schätzte, daß er an diesem Tag keine Ruhe mehr finden würde.
Ostern hatten sie Luke mit nach Hause genommen, damit er die Familie kennenlernte, und Luis, Eduardos Bruder, war von seinem Wissen über Vieh beeindruckt gewesen. Das hatte Eduardo Mut gegeben. »Biete ihm einen Job an!«
»Das habe ich getan«, hatte Luis ihm erklärt, »aber er will nach Hause.«
»Was zum Teufel macht er dann in Nordamerika?«
»Seine Familie ist gar nicht so viel anders als unsere«, sagte Luis. »Wie du wollte er in die Welt hinaus, aber jetzt erkennt er, daß er am Land hängt. Wir haben nicht alle so ein Talent wie du, so mühelos ins Geschäftsleben einzusteigen. Er ist eher so wie ich; er kommt mit dem Landleben besser zurecht.
Wir sind alle stolz auf dich, Eduardo, und dieser junge Mann hat große Achtung vor dir, aber laß ihn nach Australien gehen. Laß sie gehen. Ich glaube nicht, daß du dir um Elena Sorgen machen mußt. Wenn er in New York bleiben muß, um mit Elena leben zu können, wird er sich elend fühlen. Könntest du dir vorstellen, daß ich in New York arbeite?«
»Warum nicht? Den Job in der Handelskommission, den er hat, könntest du genausogut erledigen. Da hat man’s mit Produzenten und Abnehmern zu tun.«
Luis lachte. »Aber ich müßte dort leben – das ist das Problem. Die beiden wollen auf einer Ranch leben. Ich kann’s ihnen nicht verdenken.«
Der Chauffeur brachte Eduardo wieder in die Gegenwart zurück. »Da ist das Flugzeug, Sir. Es landet gerade.«
Eduardo sah zu, wie das kleine Flugzeug zur Rollbahn herabschwebte und ausrollte. Hank und Maria kamen die Treppe herunter und eilten Schirme schwenkend zum Wagen herüber. Maria fiel ihm um den Hals. »Eduardo! Wie nett von dir, daß du uns abholen kommst! Das wäre nicht nötig gewesen! Du hast doch heute so viel zu tun.«
»Ich doch nicht. Ich war bloß im Weg. Also bin ich geflohen und hergefahren.«
Hank schüttelte ihm überschwenglich die Hand. »Wir wissen es trotzdem zu schätzen, Eduardo. Und wie sieht’s mit der kleinen Elena und ihrer Heirat aus? Wir haben noch gar kein Geschenk für sie besorgt. Wir dachten, wir warten lieber ab und schauen mal, was sie haben wollen. Maria meint, ein Scheck könnte unhöflich sein. Andere Länder, andere Sitten. Und sie heiratet einen Australier? Wie findest du das?«
Eduardo brachte ein dünnes Lächeln zustande. »Hank hat was für Australier übrig«, sagte Maria.
»Ach ja?« erwiderte Eduardo. »Wieso?«
Maria war überrascht. »Ich weiß nicht. Wieso, Hank?«
Hank zuckte die Achseln. Seine Frau faßte diese Geste so auf, als wolle er damit zum Ausdruck bringen, daß es keine Rolle spielte; sie fuhr fort: »Tante Cecilia sagt, sie ist sicher, daß es in Australien vor langer Zeit einen Zweig der Rivadavia-Familie gegeben hat. Im letzten Jahrhundert, glaubt sie.«
Ihr Bruder lächelte herablassend. »Davon habe ich noch nie etwas gehört. Aber Tante Cecilia entdeckt überall Zweige der Familie, wenn es ihr gerade paßt.«
»Sie könnte recht haben. Man weiß nie. Aber erzähl mal, was ist mit der Heirat? Ist alles organisiert? Ich wünschte, ich hätte hier sein können, um Elena zu helfen. Also, wer kommt alles?«
»Die üblichen Leute. Die Familie. Freunde. Seine und ihre. Luis und Isobel und ihre Kinder sind ins Waldorf gegangen und machen Ferien draus. Die Tanten sind bei Freunden in Connecticut. Die Garcias und andere aus Buenos Aires haben sich irgendwo Apartments gemietet, und Opa Batiste wohnt bei Onkel Julio auf Long Island …«
»Aber doch nicht ›unsere‹ Familie, Eduardo!« unterbrach Maria. »Die andere Seite! Ich habe gehört, daß ein Lord und eine Lady kommen!«
»Ja, Lord und Lady Heselwood.«
»Ich wußte gar nicht, daß es bei den Australiern Lords gibt«, sagte Hank.
»Sie sind keine Australier, sondern Engländer. Freunde der MacNamaras. Lukes Familie.« Eduardos Stimme klang, als ob er diese Erklärung schon zu oft gegeben hätte.
»Luke muß gute Beziehungen haben, wenn er adlige Freunde hat«, sagte Maria. Sie spürte, daß Eduardo nicht allzu begeistert von der Aussicht auf diese Heirat war. Sie schaute aus dem Fenster. »Ich liebe New York. Es ist ein so phlegmatischer Ort, nicht wahr? Alle machen mit solchem Feuereifer einen Schritt nach dem anderen.«
Hank lachte. »Deine Schwester zeigt wirklich die merkwürdigsten Reaktionen, Eduardo. Die meisten Leute sagen, New York ist aufregend.«
»Ach Quatsch«, rief sie. »Es ist zu berechenbar, um aufregend zu sein. Jeder, der herkommt, weiß genau, was er zu erwarten hat. Australien ist aufregend. Ich würde liebend gern nach Australien gehen. Ein Pionierland … es muß so sein wie Nordamerika in den Wildwestfilmen; diese Weite!«
»Und kein Wasser«, sagte Hank. »Das ist der Unterschied. Unsere Pioniere hatten das Glück, gut bewässertes Land zu finden. Je weiter man in Australien nach Westen kommt, desto trockener wird es. Viele Flüsse dort fließen ins Landesinnere und versickern im Sand.«
»Flüsse können nicht ins Landesinnere fließen, Hank«, entgegnete seine Frau.
»Doch, können sie. Oder nicht, Eduardo?«
Rivadavia war neugierig. »Bist du in Australien gewesen, Hank?«
»Ja, während des Krieges.«
»Warst du schon mal in diesem Land, diesem Teil, wo Luke herkommt, Queensland? Davon habe ich noch nie gehört.«
»Da bin ich dir ausnahmsweise mal weit voraus, Eduardo«, sagte Hank. »Klar war ich da, aber das ist nichts Besonderes. Mehr als zweihunderttausend GIs und Jungs von der Luftwaffe kennen diesen Teil der Welt, schätze ich.
In Australien hat’s riesige amerikanische Militärbasen gegeben, aber die meisten Soldaten war an der Küste in Townsville stationiert, einem Sprungbrett für den Krieg im Pazifik. Ich frage mich oft, wie viele von denen zurückgekommen sind. Damals gab’s in dem Land massenhaft Chancen. Gibt’s eigentlich immer noch.«
Eduardo fand die Unterhaltung endlich interessanter. »Was für Chancen?«
»Jede Menge, in allen Richtungen. Dort gibt es phantastisches, endloses Weideland. Die haben da drüben Rinderfarmen, Ranches, so groß wie Texas.«
Sein Schwager war sprachlos. Er war in dem Glauben aufgewachsen, daß in Texas alles am größten war. »Willst du mich veralbern?«
»Nein, absolut nicht. Wie groß ist diese Farm, die Ranch, die dein zukünftiger Schwiegersohn besitzt?«
»Ich wollte lieber nicht fragen.«
»Hättest du tun sollen. Macht den Australiern nichts aus. Die würden’s dir erzählen, wenn ihr Großpapa Jesse James wäre. Die Hälfte von ihnen stammt von Sträflingen ab – ist ihnen egal. Sie sind sogar stolz drauf.«
»Oh mein Gott!«
Selbst Maria war entgeistert. »Luke MacNamara stammt bestimmt nicht von einem Sträfling ab.«
»Woher weißt du das?« Hank machte sich einen Spaß daraus, die beiden aufzuziehen. Er liebte sie aufrichtig; sie hatten ihn ins Herz geschlossen und ihm das Gefühl gegeben, daß er dazugehörte, etwas, was er noch nie erlebt hatte, aber für die Rivadavias war die Familie so wichtig, daß sie diese Sticheleien ernst nahmen.
Hank erinnerte sich immer noch voller Zorn an seine Heimkehr aus dem Krieg, nachdem er monatelang im Krankenhaus gelegen hatte. Er hatte seine Eltern von San Francisco aus angerufen, um ihnen zu sagen, mit welchem Bus er kommen würde; er war zwei Tage lang durchs ganze Land gefahren, zu aufgeregt, um die Magazine zu lesen, die er gekauft hatte, um die Zeit auszufüllen, und er war an der alten Bushaltestelle ausgestiegen – nach zwei Jahren endlich wieder zu Hause. Da keiner da war, um ihn abzuholen, war er zu Fuß durch die ganze Stadt gegangen. Überrascht hatte er festgestellt, daß sie ihm viel kleiner vorkam, als er sie in Erinnerung hatte. Die Haustür war abgeschlossen, aber der Schlüssel lag immer noch am alten Platz. Also ging er durch die Hintertür hinein und fand eine Nachricht auf dem Küchentisch, beschwert von der Zuckerdose, wo seine Mutter immer ihre Nachrichten hinterließ. Dort stand, daß seine Eltern ins Kino gegangen waren.
Er hatte sofort wieder gehen wollen, aber sein Bedürfnis, zu Hause zu sein, bei seiner Familie, war zu groß. Er sehnte sich danach, ihnen zu erzählen, was er erlebt hatte. Aber als er auf den Krieg zu sprechen kam und sie sahen, wie er zu zittern begann, erklärte ihm sein Vater: »Der Krieg ist aus, Junge. Vergiß es.«
Eduardo unterbrach seine schmerzlichen Erinnerungen. »Wenn du in Townsville gewesen bist, warst du dann auch in Lukes Heimatstadt, diesem Valley of Lagoons?«
»Tal der Lagunen«, wiederholte Maria. »Das ist so ein romantischer Name. Ich liebe ihn.«
Hank schüttelte den Kopf. »Nein. Ich glaube nicht, daß es eine Stadt ist. Ich hab’s auf einer Karte gesucht, aber ich konnte es nicht finden.«
»Ich auch nicht«, seufzte Eduardo. »Luke hat es mit dem Finger für mich eingekreist, aber ich kann nur schätzen. Es scheint hundert Meilen landeinwärts von Townsville zu sein, und das liegt ja an der Küste.«
»Also nicht so ganz anders als Argentinien oder Texas, was?« Hank lachte.
Eduardo machte ein finsteres Gesicht und wechselte das Thema. »Da wären wir. Schaut euch die vielen Autos auf der Straße an. Das ist heute ein Irrenhaus da drin. Fotografen, Garderobieren, Friseure, zeternde Frauen. Warum fahren wir nicht weiter und essen irgendwo zu Mittag, wo es schön ruhig ist?«
»Nein«, rief Maria. Sie fuhr beinahe aus dem Sitz hoch. »Ich muß Elena helfen. Es gibt bestimmt eine Million Dinge, die ich tun kann.« Sie hatte schon die Beine draußen, noch bevor die Limousine vor dem Hauptportal ganz zum Stehen gekommen war.
Maria und Hank fuhren nur ein paar Minuten vor der Hochzeitsgesellschaft zur Kirche. Hank war gereizt; er haßte es, zu spät zu kommen.
»Wir brauchen uns nicht zu beeilen«, sagte Maria. »Ohne die Braut können sie nicht anfangen.«
»Das ist es nicht«, beschwerte er sich. »Ich bin gern früh am Ort des Geschehens, damit ich sehen kann, wer wer ist. Jetzt schau, sie sind alle schon drin. Wir werden beim Reingehen nur Rücken zu sehen bekommen.«
Der Platzanweiser führte sie durch den langen Gang nach vorn, während Maria die Blumen bewunderte und Hank nach bekannten Gesichtern Ausschau hielt.
»Da ist die Mutter des Bräutigams«, sagte Maria, als sie Platz nahmen, und Hank warf einen Blick zu einer attraktiven Frau mit leicht sonnengebräuntem Gesicht und blondem, weich gewelltem Haar unter einer Pillbox hinüber. Er bemerkte ihre kräftigen, geschickten Hände, als sie ihre Handschuhe und das Gebetbuch auf das schmale Bord vor ihr legte, und sah den Kontrast zu den olivbraunen, elegant manikürten Händen seiner Frau. »Wo ist ihr Mann?« flüsterte er Maria zu.
»Psst. Er ist tot! Im Krieg gefallen. Luke ist so ein hübscher junger Mann, nicht wahr?« Sie schaute zum Bräutigam hinüber, und obwohl sie nur seinen Rücken sehen konnten, nickte Hank zustimmend. Wie alle großen Männer registrierte er wohlwollend, daß dieser Bursche gute eins fünfundachtzig groß und breitschultrig, aber trotzdem schlank und schlaksig war. Es würde noch ein paar Jährchen dauern, bis er Gewicht zulegte. Er lächelte. Der Bräutigam fühlte sich offensichtlich unwohl in seiner Kleidung; er zerrte an seinem Jackett herum und zog die Krawatte gerade. Hank schaute noch einmal zu dem jungen MacNamara hinüber und versuchte, sein Gesicht zu sehen; etwas an ihm, an seiner Haltung, kam ihm bekannt vor. Was war es? Die Art, wie sich seine Schultern bewegten? Die ein wenig krumme Haltung, wie die eines Cowboys. Vielleicht erinnerte ihn das an ein paar von den Jungs daheim. Er verspürte ein sonderbares nervöses Schlingern im Magen, und der Schweiß trat ihm auf das gerötete Gesicht, seine Hände zitterten.
Maria, der dies nicht entging, nahm seinen Arm. »Was ist los, Hank? Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, ich bin okay. Ist bloß ein bißchen heiß hier drin.«
Sie sah ihn scharf an, als er ein Taschentuch herauszog und sich das Gesicht und den Hals abtupfte.
Ich werde alt, sagte er sich, das ist mein Problem. Er stand auf, als die ersten Akkorde des Heiratsmarsches erklangen. Ganz vorn im Gang stand Elena mit ihrem Vater, in helles Licht getaucht.
Hanks beunruhigende Gedanken waren vergessen, als er sich umdrehte und sich einen Moment lang in der Schönheit dieser Frau verlor, die er von klein auf heranwachsen sehen hatte. Ihr reizendes Gesicht wurde von dem Schleier weichgezeichnet, der in einer Tüllwolke von derselben Mantille herabfiel, die Maria an ihrem Hochzeitstag getragen hatte.
»Ist sie nicht wunderschön?« sagte Maria verzückt und klammerte sich an Hank.
»Ja ja«, erwiderte er und drehte sich um, um zu sehen, wie der Bräutigam reagierte.
Luke MacNamara hatte den Kopf zur Seite gewandt, wie es jeder Bräutigam tut, um seine Braut zum erstenmal verstohlen anzusehen. Die Nervosität fiel von ihm ab, und sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Dann fiel ihm ein, daß er sich wieder zum Altar umdrehen mußte.
Er sah den großen Mann, der in der ersten Reihe stand, und dachte, daß es Hank Wedderburn sein mußte, Elenas Lieblingsonkel. Deshalb begrüßte er Hank mit einem verschwörerischen Zwinkern, ehe er wieder seine korrekte Haltung zwischen den Brautführern einnahm, mit dem Gesicht zum Priester.
Hank taumelte, als ob er einen Schlag bekommen hätte. Seine Knie gaben nach, und er griff nach der Kirchenbank, um sich festzuhalten. Seine Augen verschleierten sich. Die Braut ging mit Eduardo vorbei, und die Orgelmusik schien sich zu einem Tosen zu steigern.
»Was ist denn?« Marias Stimme war ängstlich. »Hast du irgendwas?«
»Ich fühle mich nicht besonders wohl. Ich glaube, ich gehe mal für eine Minute raus.«
»Ich komme mit.«
»Nein, du bleibst hier.« Er trat aus der Bank in den Seitengang und versuchte den Eindruck zu erwecken, als ob es einen vernünftigen Grund für sein Gehen gäbe. Köpfe drehten sich neugierig um, als er durch eine Seitentür verschwand.
Draußen sammelte er sich, trat unter einen Baum und versuchte, eine Zigarette aus der Packung zu schütteln. Das Päckchen fiel ihm jedoch aus den zitternden Händen und landete im Gras. Dann ließ Hank Wedderburn seinen Tränen freien Lauf. Als die anderen aus der Kirche kamen, hatte er sich das Gesicht am Trinkbrunnen gewaschen und sein heiteres Ich gezwungen zurückzukommen, aber Maria sah, daß seine Augen rot waren. Seine jähe »Verwandlung« hatte ihr einen Schrecken eingejagt. Er mußte ihr versprechen, sobald wie möglich einen Arzt aufzusuchen.
2. Kapitel
Während der Hochzeitsfeier entschloß sich Hank, etwas in einer Angelegenheit zu unternehmen, die er vierzehn Jahre lang auf sich beruhen lassen hatte.
Aber erst ein paar Wochen später, als er wieder in seinem eigenen Büro in Dallas war, rief er eine Privatdetektei an.
Am selben Nachmittag fuhr Thomas J. Clelland im renommierten Wedderburn Building mit dem Lift zu einem Termin bei Hank Wedderburn höchstpersönlich nach oben und fragte sich, worum es bei diesem Auftrag wohl gehen mochte. Um die Überprüfung eines Geschäftspartners? Kaum. Das konnte Wedderburn über seine eigenen Kontakte besser bewerkstelligen. Probleme mit seiner Frau? Unwahrscheinlich. Solche Arrangements wurden fern vom Büro getroffen. Clevere Ehefrauen standen sich gut mit den Sekretärinnen.
Hank Wedderburn war höflich. Er wünschte Ermittlungen in einer Sache von untergeordnetem Interesse. Reine Neugier. Er hatte gehört, daß Clelland im Krieg beim Nachrichtendienst der Army gewesen war.
»Darauf würde ich nicht viel geben, Mister Wedderburn. Es hört sich eindrucksvoll an, aber ich war in Neuseeland stationiert. Hatte nicht viel zu tun, außer Akten hin und her zu schieben und das Leben dort zu genießen. Damals hab ich’s gehaßt, da unten festzuhängen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich Glück gehabt.«
»Sind Sie nach Australien gekommen?«
»Nein. Auch das hab ich verpaßt.«
»Ihre Nachforschungen würden Sie nach Australien führen. Hätten Sie Zeit?«
Clelland bemühte sich, seine Aufregung zu unterdrücken. »Ja, Sir. Wenn ich Ihnen dort von Nutzen sein kann.«
»Das können Sie. Ich möchte Informationen über einen australischen Soldaten.«
Clelland wußte, daß es zu schön gewesen war, um wahr zu sein. Er konnte den Kontakt seiner Firma mit Wedderburn nicht schon beim ersten Mal gefährden, indem er dessen Zeit und Geld verschwendete. »Ich sage nur höchst ungern nein zu einer Reise nach Australien, Mister Wedderburn, aber wenn das alles ist, was Sie brauchen, dann könnten wir diese Information auch von hier aus beschaffen.«
»Das ist genau das, was ich nicht will. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Ich möchte niemand kränken. Es geht nicht, daß jemand wie ein Elefant im Porzellanladen in den Armeeunterlagen herumstöbert. Diese Familie hat ihre eigenen Kontakte zur australischen Botschaft hier bei uns. Es wäre mir gar nicht recht, wenn jemand merkt, daß Nachforschungen über einen ihrer Leute angestellt werden. Der Mann ist tot, und er war kein Verbrecher. Mit solchen Dingen hat das nichts zu tun. Ich möchte nur, daß Sie äußerst dezent vorgehen und mir die Geschichte seines Falles bringen. Ich will nicht, daß die Angehörigen etwas davon erfahren.«
»Ist nicht leicht, ohne die Zustimmung der Angehörigen an Armeeunterlagen heranzukommen.«
»Sie werden schon einen Weg finden. Bestechen Sie jemand, wenn’s sein muß. Sie brauchen nicht zu sparen. Ich lege nur größten Wert auf Diskretion.«
Er gab Clelland ein Blatt Papier, auf dem folgendes stand: JOHN PACE MACNAMARA. VALLEY OF LAGOONS. QUEENSLAND. AUSTRALIEN …, und entschuldigte sich: »Das ist nicht viel, um damit zu arbeiten. Er ist ›im Krieg gefallen‹, wie es heißt. Nach allem, was ich weiß, hätte er auch in Perth von einem Jeep überfahren worden sein können.«
»Sicher. Ich kenne einen Burschen, der mit dem Purple Heart nach Hause kam. Er ist von einem Bullen auf die Hörner genommen worden, als er eine Abkürzung über eine Farm in der Gegend von Auckland nahm.« Er warf einen Blick auf das Blatt. »Wo ist dieses Tal der Lagunen?«
»Gute Frage. Ich bin nicht ganz sicher, aber es liegt landeinwärts von Townsville, einer Stadt an der Nordküste des Staates Queensland im Osten.«
»Ah ja. Ich weiß, wo Townsville ist. Große US-Basis im Krieg, nicht wahr?«
»Genau. Ich glaube eigentlich nicht, daß sie große Schwierigkeiten haben werden, etwas über diesen Mann rauszufinden. Wenn man all diese Truppen aus dieser kleinen Stadt abgezogen hätte, wäre sie einfach wieder in aller Stille eingeschlafen, glaube ich.«
Er brachte Clelland zur Tür und verspürte dann auf einmal das Bedürfnis, mehr zu sagen. »Hören Sie, ich will nicht, daß Sie die Sache im Blindflug angehen. Ich bin kürzlich auf den Namen dieses Burschen gestoßen. Aus heiterem Himmel. Ich glaube, ich habe ihn im Krieg kennengelernt. Dieser Bursche, dieser Australier …«
Clelland starrte ihn verlegen an.
Wedderburn hatte Tränen in den Augen. »Entschuldigen Sie. Ich konnte noch nie darüber sprechen.« Er holte tief Luft. »Ich glaube, er hat mir das Leben gerettet.«
Dieser verdammte Krieg, dachte Clelland. So viele Männer waren mit schrecklichen Erinnerungen heimgekehrt, die tief in ihrem Inneren vergraben waren. Er wartete, daß Wedderburn weitersprach.
Hank wußte sein Schweigen zu schätzen. »Danke. Jetzt, wo ich damit konfrontiert worden bin, muß ich es wissen, verstehen Sie. Mit seiner Familie möchte ich aber nicht darüber sprechen. Wenn ich mich irre, würde ich mich zu einem Narren machen. Wenn ich recht habe, könnte es noch schlimmer sein. Wozu all den Schmerz wieder zum Leben erwecken? Dann muß seine Frau alles ein zweitesmal durchmachen. Das ist eine Angelegenheit, zwischen mir und einem Burschen, der seit vierzehn Jahren tot ist. Es geht nicht darum, daß ich ihm etwas schulde – und ich bezahle meine Schulden gern; was mich all diese Jahre über gequält hat, ist, daß ich nicht weiß, wer dieser Mann war.«
»Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen, Mister Wedderburn. Benötige ich Ihre Dienstakte für diese Ermittlung?«
»Nein. Bringen Sie mir alles über den verstorbenen John Pace MacNamara, was Sie können, dann weiß ich Bescheid.«
Auf dem Rückweg durch Wedderburns Büros war Clellands Herz schwer. Die Reise nach Australien war ein Abenteuer, aber Wedderburn tat ihm leid. Männer wie er trugen das Schuldgefühl wie ein Bleigewicht mit sich herum. Die Schuld bestand darin, daß ihre Kameraden gestorben waren, während sie überlebt hatten. Es überraschte ihn, daß ein selbstbewußter Mensch wie Wedderburn nicht damit leben konnte, daß so etwas im Krieg dauernd passierte.
Clelland durchquerte das Foyer, warf einen Blick auf die lange Liste der Wedderburn-Unternehmen an der Wand und trat in die Hitze des Tages hinaus.
Als er aus Australien zurückkam, lieferte Clelland seinen Bericht in Wedderburns Büro ab. Wochen vergingen, und obwohl die Rechnung ohne Reklamationen in voller Höhe beglichen wurde, hörte er nichts. Dann rief Wedderburn an. »Können wir uns auf einen Drink treffen?«
»Unter einer Bedingung«, sagte Clelland. »Sie sagen mir, ob wir Ihnen geholfen haben oder nicht.«
»Ich sag’s Ihnen. Ich würde mir gern ein bißchen frische Luft um die Nase wehen lassen. Wie wär’s mit Lindy’s, unten am Park? Da können wir draußen sitzen.«
Hank saß bereits an einem Tisch unter den Bäumen, als Clelland kam. Da er schon einen Drink auf dem Tisch stehen hatte, holte sich Clelland einen Bourbon und brachte ihn mit. »Ich komme bewaffnet«, sagte er und schwenkte seinen Drink. »Tut mir leid, daß nur ein unscharfes Foto bei dem Bericht war, das aus einem Bataillonsmagazin stammt. Die Burschen auf dem Foto sehen für mich alle gleich aus, und ich sollte schließlich nicht zu den Angehörigen gehen.«
»Das ist schon in Ordnung, Tom. Ich brauchte kein Foto. Worauf es mir ankam, war das Timing. Haben Sie vorher schon mal was vom Kokoda Trail gehört?«
»Oh ja – das schlimme Ende des Krieges.«
»Ganz recht. Es war eine heiße, dampfende Hölle auf diesen Bergpfaden in Neuguinea. Nichts als Dschungel, und Japaner hinter jedem Busch.«
»Ja, ich erinnere mich. Die haben da oben immer um Nachschub geschrien, aber es war schwer, an sie ranzukommen. Wenn man das Zeug mit dem Fallschirm abgeworfen hätte, wäre es in irgendeiner Schlucht oder in einem Lager der Japaner gelandet. Aber ich dachte, an diesem Kampf wären nur Australier beteiligt gewesen.«
»Es gab nicht allzu viele Amerikaner in der Gegend. Wir hatten einfach das Pech, beim Losen den kürzeren zu ziehen. Gott weiß, wie wir da reingeraten sind. Wir waren grüne GIs, gerade nach Port Moresby gekommen, und gleich weiter nach Kokoda. Ich sehe immer noch diese großen, zäh aussehenden Aussies an uns vorbeimarschieren. Sie wirkten irgendwie älter als wir oder so; damals hab ich’s nicht rauskriegen können. Sie hatten sich diese verschwitzten Schlapphüte tief ins Gesicht gezogen – Gesichter aus Granit – und die Ärmel hochgekrempelt, und sie sahen wie Bataillone von Holzfällern aus. Hat uns echt umgehauen. Sie machten einen so verflucht selbstsicheren Eindruck. Im Dschungel wimmelte es nur so von Japanern, und es gab keine richtigen Kampflinien; man kämpfte mit Bajonetten, das war ein blutiges Geschäft.«
»Man lernt nie aus«, bemerkte Clelland. »Ich hatte keine Ahnung, daß welche von unseren Jungs auf dem Kokoda Trail waren.«
»Bei Gott, das waren sie, und sie sind da auch gestorben. Aber Ihr Bericht hat mir etwas über diesen Feldzug vermittelt, was ich bis jetzt noch nicht wußte. Jetzt ist mir klar, warum ich mir neben diesen Aussies so unzulänglich vorkam. Viele von ihnen hatten schon jahrelang gekämpft. Man hatte sie gerade von Tobruk zurückgebracht, um sie gegen die Japaner einzusetzen. Sie waren die berühmten Ratten von Tobruk, und ich hatte keine Ahnung. Es waren kampfgestählte Männer; kein Wunder, daß sie älter wirkten. Jedenfalls waren unsere Offiziere auch noch grün hinter den Ohren. Sie hatten keinerlei Kampferfahrung, und wir sind in ein höllisches Schlamassel reingeraten und haben zu viele Leute verloren. Da haben sie uns rausgeholt und zu einem Ort an der Küste nicht weit von Buna geschickt. Von da aus ging’s dann landeinwärts.«
»Das war bestimmt auch nicht viel besser, oder?«
»Wir hatten es immer noch mit dem stinkenden Dschungel und haufenweise Japanern zu tun, hatten aber mehr Chancen, zum Zug zu kommen. Wir konnten die Flüsse benutzen, konnten uns schneller bewegen und sehen, was sich um uns herum tat. Kokoda war kein Ort für unerfahrene Rekruten. Jedenfalls schien von da an alles gut zu gehen, bis ich eines Tages mit einer Patrouille in der Nähe des Flusses Adai war und die Japaner uns überfielen. Zwei meiner Kameraden hat’s sofort erwischt, und einen von unseren Jungs haben sie auch noch geschnappt. Ich konnte ihn die ganze Nacht lang schreien hören. Ich habe mich ins Unterholz verdrückt.
Am Morgen konnte ich hören, wie die Japaner auf der Suche nach mir den Dschungel durchkämmten.« Er leerte seinen Drink und gab dem Kellner ein Zeichen. »Noch mal dasselbe. Um es kurz zu machen, sie erwischten mich, stopften mir einen Klumpen Blätter in den Mund, fesselten mich und brachten mich zu einer Lichtung, wo sie drei Australier festgebunden hatten. Sie waren auch geknebelt, so daß wir nicht miteinander reden konnten, aber in ihrer Gesellschaft fühlte ich mich besser. Ich wollte nicht allein sterben. Sie ließen uns den ganzen Tag dort liegen, ohne Essen, ohne Wasser. An diesem Abend soffen die Japaner sich einen an, und der Gefangene, der ihnen am nächsten lag, bekam eine kleine Abreibung verpaßt. Und dann fingen zwei japanische Offiziere an, herumzuhüpfen und eine große Show mit ihren Schwertern abzuziehen. Es sah wie ein Theaterstück aus.
Als nächstes kamen sie zu uns herüber, voll bis obenhin; sie wankten und taumelten auf der Lichtung herum. Sie stellten uns auf die Beine und zogen die Knebel heraus, ließen unsere Hände jedoch hinter dem Rücken gefesselt. Dann begannen sie uns auf einem Weg von der Lichtung wegzuführen. Einer der Australier muß gewußt haben, wovon sie redeten. Ganz plötzlich trat er mit seinem Stiefel nach dem nächsten Japs und schrie, wir sollten wegrennen. Ich kann ihn immer noch hören. ›Macht, daß ihr wegkommt, verdammt noch mal. Die dreckigen Scheißkerle wollen uns abschlachten.‹
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Ich sprang mit dem Kopf voran in dieses Unterholz zurück und krabbelte um mein Leben, und ich konnte sie hinter mir alle herumschreien und brüllen hören. Die Japse waren so betrunken, daß sie von unserer Flucht völlig überrascht wurden.
Da saß ich also wieder im Dschungel. Meine Hände waren immer noch auf den Rücken gefesselt. Diesmal hatte ich jedoch mehr Glück. Ich fiel in eine Mulde. Sie war voller Farnkraut, und ich robbte ganz langsam weiter und behielt den Kopf unten. Ich dachte, alles sei bestens und ich käme immer weiter von ihnen weg, aber ich muß einen Bogen geschlagen haben. Sie hatten die Australier wieder eingefangen. Ich brauchte nicht hochzuschauen, um das zu sehen. Ich konnte sie fluchen hören; die Australier überschütteten die Japaner mit Beschimpfungen, daß mir angst und bange wurde. Ich war ganz nah bei ihnen, war aber vor Angst zu keiner Bewegung fähig. Ich konnte hören, wie die Japaner auf sie einschlugen. Schließlich war es still, und ich konnte es nicht aushalten; also hob ich den Kopf gerade so weit, daß ich sehen konnte, was da vorging.
Die Australier standen wieder in einer Reihe. Man hatte ihnen die Knöchel gefesselt und die Handgelenke vor dem Bauch zusammengebunden, und einer der Aussies fing mit dieser verrückten Krakeelerei an. ›Gebt uns unsere Hüte zurück, ihr Scheißkerle. Wir müssen in Uniform sterben.‹ Es war total irre, aber einer der Japaner muß es verstanden haben, und es klingt verrückt, aber sie hielten große Stücke aufs Protokoll oder wie immer sie es nennen, und er schickte seine Männer los, ihre Kopfbedeckungen zu suchen. Sie haben diese gottverdammten Schlapphüte dann auch gefunden.«
Er hielt inne und trank seinen Whisky mit einem großen Schluck aus. »Das habe ich noch keinem Menschen erzählt.«
»Diesmal werden Sie’s tun«, sagte Clelland, »und wenn ich Ihnen noch zehn Drinks ausgeben muß.«
»Ja … also, sie gaben ihnen die Kopfbedeckungen zurück, und die Burschen lachten und tauschten ihre Hüte und die beleidigendsten Bemerkungen über die Japaner aus, die ihnen einfielen. Die Japaner standen direkt vor ihnen, auf allen Seiten Gewehre und Bajonette. Und ich hockte mit großen Augen da und dachte, die sind alle verrückt, als einer der Australier den Kopf drehte und so tat, als ob er seinen Hut richtig aufsetzen wollte. Eine Sekunde lang sah er mich direkt an. Er blinzelte, sagte ›Kopf runter, Kumpel‹, und fuhr bruchlos mit einer Salve von Schimpfworten fort. Seine Kameraden fielen ein, und die Japaner begannen sie wieder zu prügeln, während ich mich rückwärts davonmachte, tiefer in den Dschungel hinein.«
»Glauben Sie, die Sache mit den Hüten war nur ein Ablenkungsmanöver?«
»Ganz bestimmt. Ich hätte nicht geglaubt, daß mich jemand sehen könnte, aber sie konnten es.«
»Sind die Australier am Ende davongekommen?«
Hank legte das Kinn auf seine verschränkten Hände und ließ den Blick einen Moment lang über den ordentlichen grünen Rasen und die sorgfältig beschnittenen Hecken schweifen, bevor er antwortete. Dann räusperte er sich und sagte mit angespannter Stimme: »Sie wurden enthauptet. Alle drei.«
»Du lieber Gott!«
Die beiden Männer saßen lange da und sahen zu, wie die Sonne unterging.
Hank war der erste, der wieder etwas sagte. »In der Akte, die Sie mir geschickt haben, steht, daß Sergeant John Pace MacNamara von den Japanern am 22. Dezember 1943 im Gebiet des Flusses Adai auf Neuguinea hingerichtet wurde.«
»Und er war einer dieser drei Männer?«
»Ja.«
»Wissen Sie, welcher?«
Hank antwortete nicht gleich. Er lächelte traurig. »MacNamara war derjenige, der mir zugeblinzelt hat. Derjenige, der gesagt hat ›Kopf runter, Kumpel‹.«
»Woher wissen Sie, daß es MacNamara war?«
»Weil ich dieses Gesicht nicht mehr vergessen werde, solange ich lebe. Und es hat mir erst vor ein paar Monaten erneut zugeblinzelt.«
Clelland machte große Augen.
»Nein, ich sehe keine Gespenster. Ich bin seinem Sohn begegnet. Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Allmächtiger! Haben Sie es ihm gesagt?«
»Nein.«
»Damals in Neuguinea. Wie sind Sie da entkommen?«
»Eingeborene fanden mich. Ich war neun Tage lang im Dschungel herumgekrochen, von Blutegeln übersät, von allem gebissen, was kreucht und fleucht, und halbtot. Ich war völlig hinüber. Ich muß soweit zu mir gekommen sein, daß ich jemand im Feldlazarett von den Australiern erzählt habe, denn später kam ein Offizier zu mir. Er sagte mir, sie hätten die Leichen gefunden, und fragte mich, ob ich ihre Namen wissen wollte. Er machte Anstalten, dieses Notizbuch zu zücken. Da bin ich total durchgedreht. Sie haben mir gesagt, ich hätte den ganzen Laden zusammengeschrien. Sie haben mich auf ein Schiff verfrachtet, und ich landete im Lazarett in Townsville. Dort hing ich ein paar Monate rum, dann ging’s weiter auf die Phillipinen. Und das ist das Ende der Geschichte.«
Clelland lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und tippte auf den Tisch. »Nein, das stimmt nicht. Wenn Sie mir Bericht erstattet hätten, würde ich sagen, das ist ein flauer Bericht, Soldat, versuchen Sie’s noch mal. Sie haben was ausgelassen.«
»Nein, habe ich nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so genau daran, wie ich im Dschungel herumgekrochen bin …«
»Sie sagten, sie seien enthauptet worden. Nicht wegschauen. Wenn Sie sich vom Schauplatz des Geschehens entfernt haben, woher wußten Sie das dann? Das ist der Teil, den Sie in Ihrem Inneren vergraben haben. Sahen Sie, wie es passierte?«
Hanks Gesicht hatte eine ungesunde graue Farbe angenommen. »Ich hab’s gehört. Ich hörte das Geschnatter der Japaner, dann hörte ich die Australier wieder rufen, und dann – was immer beschlossen wurde – war da wieder absolute Stille. Ich lag im Sumpf und flehte Gott an, mich dort wegzuholen, und ich weinte, ich war ja erst dreiundzwanzig, und dann hörte ich, wie die Australier zu schreien begannen. Und ich hörte den Hieb und diese entsetzliche Stille. Dann hörte ich, wie einer der Australier sie anschrie, sie sollten seinen Kameraden in Ruhe lassen … sie sollten es nicht tun, aber sie taten es … wieder dieser Hieb. Und der letzte hat kein Wort mehr gesagt. Ich glaube, mir wird schlecht.«
Als Hank zurückkam, hatte sein Gesicht wieder Farbe bekommen. »Tut mir leid, daß ich Sie mit all dem behelligt habe.«
Clelland lächelte. »Ich hab’s ja so gewollt.«
Wedderburn blickte auf. »Meine Story über Down Under hat auch eine gute Seite. Während ich in Townsville auf Urlaub war, bin ich mit drei Burschen herumgestreift, und wir sind alle als reiche Männer nach Hause gekommen.«
»Ich habe mich schon oft gefragt, wie Millionäre angefangen haben.«
Hank lachte. »Man braucht Glück.«
»Das habe ich auch schon bemerkt«, gab Clelland kläglich zu. »Um zu dem Punkt zurückzukommen, wo Sie ins Spiel kamen: Manchmal denke ich, alle Ereignisse sind miteinander verknüpft. Oder haben sogar eine andere Dimension, ich weiß nicht. Aber John Pace MacNamara hatte einen Sohn. Und dieser Sohn ist in New York aufgetaucht und hat meine Nichte geheiratet.«
Clelland kippte seinen Drink hinunter. »Machen Sie Witze?«
»Nein. Ich glaube, ich fliege mal nach Australien und schaue mich in MacNamaras Gegend um, in diesem Valley of Lagoons. Ich habe das Gefühl, daß er mir eine Einladung geschickt hat.«
Argentinien 1825
3. Kapitel
Im Jahre 1825 begleitete Viscount Forster die britische Handelsdelegation zu einer Zusammenkunft mit Mitgliedern der Regierung der Vereinigten Provinzen von La Plata nach Buenos Aires. Obwohl er nicht akkreditiert und in der Botschaft nur als Beobachter aufgeführt war, hielten ihn viele aufgrund seiner Größe von eins neunzig und seiner Haltung für den Leiter der Delegation.
Die Forsters hatten es über die Jahrhunderte hinweg fertiggebracht, sowohl überzeugte Katholiken zu bleiben als auch ihrem Land gegenüber Loyalität zu bewahren. Als Katholik konnte Forster kein öffentliches Amt innehaben, aber die britische Regierung hatte seine Dienste nützlich gefunden. Als einfacher Bürger konnte er häufig ungehinderter reisen und mehr Informationen sammeln als jene, die von der Regierung eingesetzt waren, und durch seine Religion hatte er eine gemeinsame Basis mit vielen, die einem Protestanten mit Mißtrauen begegnet wären. Forster gefiel die Rolle, die er spielte. Er genoß es, an diplomatischen Aktivitäten beteiligt zu sein, ohne sich mit den Bürokraten herumärgern zu müssen, und als unerschrockener Reisender gewann er mit seinem Charme die Zuneigung der Menschen, denen er begegnete.
Auch bei dieser Expedition mußte er wieder alle diese Eigenschaften aufbieten, um mit den stolzen Südamerikanern zurechtzukommen. Er wußte, daß ihm seine Religion bereits geholfen hatte, Vertrauen zu schaffen. Jetzt lag es an ihm, ganz diskret in Erfahrung zu bringen, welche Einstellung sie zu den Malvinen hatten. Die britische Regierung war darauf aus, diese Inseln zu annektieren, ohne dabei mehr Staub als unbedingt nötig aufzuwirbeln, und es gab Grund zu der Annahme, daß die La-Plata-Regierung einwilligen würde.
Es genügte nicht, daß die Briten in den Augen jener, die in Buenos Aires etwas zählten, im Kampf gegen die Spanier an ihrer Seite standen. Es gab ältere Konflikte, die nicht vergessen waren. 1806 waren die Briten genau in dieses Gebiet einmarschiert, in das spanische Vizekönigreich La Plata.
Der spanische Vizekönig hatte seine Sachen gepackt und sich davongemacht, und so waren die Einwohner selbst in die Bresche gesprungen und hatten die Briten zurückgeschlagen. Seit diesem Tag betrachteten sich die Nachfahren der Spanier, ermutigt von ihrem Erfolg, als patriotische Argentinier. Das war auch der Ansporn für sie, sich gegen die Spanier zu wenden und sich vom revolutionären Geist anstecken zu lassen, der in dieser Region aufloderte. Sie beschlossen, sich vom spanischen Joch zu befreien.
Forster hatte mit großem Vergnügen am gesellschaftlichen Leben in Buenos Aires teilgenommen. Als Aristokrat war er in den Häusern der Reichen und Mächtigen willkommen gewesen. Dies half ihm bei seiner Mission. Er war auf der Suche nach einem hochrangigen Argentinier, der die Annexion durch Großbritannien unterstützen und auch andere dazu ermutigen würde. Seine Wahl war auf Jorge Luis Rivadavia gefallen.
Er hatte in Erfahrung gebracht, daß die Rivadavias reiche Grundbesitzer spanischer Abstammung waren. Ihre größte Hazienda lag flußaufwärts bei Rosario. Dort lebten sie wie die russische Aristokratie mit Leibeigenen. Die Hauptquelle ihres Reichtums waren Silberminen im Norden, aber sie hatten auch riesige Ländereien, auf denen sie Herden erstklassiger reinrassiger Rinder hielten. Ihre Farmarbeiter waren Mischlinge aus Spaniern und Indianern; man nannte sie Gauchos.
Jorge Luis, der jetzt Anfang Fünfzig, jedoch kein Mitglied der Regierung war, übte eine Macht aus, die seiner gesellschaftlichen Stellung entsprach. Er galt außerdem als ein Held, weil er seine Besitztümer verlassen und an den Kriegen teilgenommen hatte. Er hatte im Norden gegen die Spanier gekämpft und war mit San Martins Armee von Mendoza aus über die Anden nach Chile marschiert, um die spanischen Stützpunkte anzugreifen. Mit den Kriegen war die Unabhängigkeit von den Spaniern erreicht worden, aber nun herrschten Gewalt und Chaos; die Führer der Provinzen kämpften um die Vorherrschaft und konnten sich nicht auf eine Regierungsform einigen. Das Militär übernahm allmählich die Macht. Das machte die britischen Pläne für die Malvinen um so dringlicher. Juntas waren berüchtigt dafür, daß mit ihnen nicht gut Kirschen essen war.
Während seines Aufenthalts in Buenos Aires hatte sich Forster auf seine zurückhaltende Art um Jorge Luis’ Gesellschaft bemüht und war entzückt, einen intelligenten Begleiter in ihm zu finden. Der Argentinier war trotz seiner guten Ausbildung – er hatte die Universität von Cordoba besucht – erpicht darauf, mehr über England und seine Verfassung zu erfahren, und er wollte einen Einblick in die Strukturen des europäischen Handels bekommen. Forster tat ihm gern den Gefallen und baute auf diese Weise geschickt und indirekt einen argumentativen Hintergrund für die britische Annexion der Inseln auf.
Als er eingeladen wurde, ein paar Tage auf Jorges Hazienda zu verbringen, war es an Forster, etwas zu lernen. Er fand den argentinischen Lebensstil faszinierend. Auf dem kühlen weißen Hof mit der schattenspendenden, von roten Rosen umrankten Pergola wurde gemütlich gespeist. Bei diesen Zusammenkünften stellte ihn Jorge den anderen Angehörigen seiner Familie vor, und Forster war überrascht, daß die meisten Männer Englisch sprachen. Jorges schöne Frau sprach jedoch nur Spanisch, aber ihr ältester Sohn Juan war immer zur Stelle, um für sie zu übersetzen. Sie waren eine Familie, die sich sehen lassen konnte. Mit seinen schwarzen Haaren, die an den Schläfen grau wurden, dem schmalen, dunklen Schnurrbart und den weißen, gleichmäßigen Zähnen entsprach Jorge weitgehend dem Bild des stolzen Lateinamerikaners, aber es entging Forster auch nicht, daß er mit seinem stämmigen Körperbau so stark wie ein Bulle wirkte. Sein Sohn Juan sah ihm sehr ähnlich, aber seine dunklen Augen waren größer, so wie die seiner Mutter, und er hatte unglaublich lange Wimpern.
Bei der ersten Gelegenheit, als seine Mutter gerade nicht am Tisch war, fragte Juan Forster nach seiner Meinung über die Regierung, aber da schaltete sich sein Vater ein. »Lord Forster ist Diplomat. Ich glaube kaum, daß er Kommentare zu unserer Innenpolitik abzugeben wünscht.«
»Man ist trotzdem interessiert«, sagte Forster aus Rücksicht auf alle beide. »Ich glaube, Sie sind mit dem Minister verwandt, Senor Rivadavia? Mir scheint, er vertritt eine vernünftige, weitsichtige Politik.«
»Er wird bald Präsident sein«, sagte Juan schnell, und Jorge schüttelte den Kopf.
»Bist du anderer Meinung, Vater?« fragte Juan herausfordernd.
»Das habe ich nicht gesagt. Es ist möglich, aber ich habe Angst um ihn; er ist ein hervorragender Minister mit einer sicheren Hand, was Handel und Wirtschaft betrifft, und einer Vision für unser Land, aber das macht ihn noch nicht zum Führer. Ich glaube, Oberst Rosas wird ihn schlagen.«
»Unmöglich!« protestierte Juan. »Rosas ist nicht zum Führer geeignet. Er macht die Gauchos zu Banditen.«
»Ganz gleich, was wir von ihm halten, der Mann hat ein ungeheures Vermögen und riesige Ländereien, wo er Männer rekrutieren und ausbilden kann.«
»Nur Dummköpfe würden ihm folgen«, rief Juan.
»Du nennst sie Dummköpfe; sie glauben, daß sie Patrioten sind. Wir haben alle unsere Träume.« Jorge wandte sich mit einer Spur von Traurigkeit in der Stimme an seinen Gast. »Wir hatten unseren. Als er wahr wurde und wir unsere Unabhängigkeit errangen, tanzten die Menschen auf den Straßen. Wir sahen eine herrliche Zukunft vor uns, und was haben wir bekommen? Anarchie. Es gibt Konflikte zwischen der Zentralregierung und den Provinzen, zwischen Stadt und Land. Caudillos wie Lopez in Santa Fe ernennen sich selbst zu Provinzdiktatoren, um die Regierung anzugreifen. Es ist sehr schwierig für Estanzieros wie uns. Wir mußten uns organisieren, um unsere Familien und unser Land gegen Indianer und Horden militanter Gauchos zu schützen, und wenn wir die Ordnung bewahren wollen, müssen wir eben auch Männer und Geld nach Buenos Aires schicken, um die Caudillos und ihre Truppen abzuwehren.«
»Könnte man Rosas als Caudillo einstufen?« fragte Forster.
»Ja«, sagte Juan.
»Nein«, widersprach sein Vater. »Er ist mächtiger und gefährlicher. Zudem gehört seine Mutter zu den Anchorenas, der reichsten Familie im ganzen Gebiet des Rio de la Plata. Wie sie sicher wissen, Lord Forster, kommt für ehrgeizige Männer nach dem Geld als nächstes der Griff nach der Macht. Er wird sich nicht mit einer Provinz zufriedengeben.«
»Aber soviel ich weiß, hat er doch mit der Zentralregierung gegen diese Provinzler gekämpft?«
»Das stimmt«, sagte Jorge. »Man schlägt nicht mit dem Hammer auf etwas ein, das einem bald gehören wird. Er hat auf der Seite der Einheit gekämpft; er hat Lopez besiegt, ist dadurch zum Helden geworden und hat von der dankbaren Regierung noch mehr Land geschenkt bekommen.«
Forster hörte Juans verärgertes Murren. »Ich habe gegen Quemalcoy gekämpft, Sir, und ich habe gesehen, was Rosas’ Männer waren: Mörder und Plünderer, aber keine Soldaten.«
Jorge lächelte stolz. »Ja. Mein Sohn hat in den Indianerkriegen gekämpft, als er siebzehn war, und er hat seine Sache gut gemacht, aber die Männer aus unseren Kontingenten gerieten mit Rosas’ aneinander. Als sie zurückkamen, begannen Heißsporne wie mein Sohn hier in der Hauptstadt öffentlich gegen Rosas aufzutreten. Sie sagen, er sähe den Estanzieros mit seinen Gauchos auf die Finger und ließe die Gauchos in der Stadt wie Barbaren wüten und man solle ihm seinen Reichtum und seine Macht nehmen.«
»Und das werden wir auch weiterhin von den Dächern rufen«, sagte Juan.
»Und wenn Rosas an die Macht kommt, seid ihr mit Sicherheit in Gefahr«, erwiderte sein Vater.
»Was sollen wir denn deiner Meinung nach tun, Vater? Die Augen davor verschließen? Die Leute müssen die Wahrheit über ihn erfahren. Wie auch immer, wir haben gewonnen. Er hat sich auf seine Haziendas zurückgezogen. Bernardino Rivadavia wird ihn nie wieder in eine Machtstellung kommen lassen.«
»Bernardino wird dabei nichts zu sagen haben«, gab sein Vater ruhig zurück. »Rosas sitzt nicht tatenlos in der Pampa, er gewinnt an Stärke und ist dabei, zum Volkshelden zu werden.« Die Musiker kamen heraus, um für sie zu spielen, und ein Geiger trat an den Tisch.
Forster war enttäuscht über die Unterbrechung. Er hätte gern mehr über diesen Rosas gehört. Offenbar war er ein Mann, den man im Auge behalten mußte.
Am nächsten Tag lud Jorge ihn ein, mit ihnen auszureiten, um sich den Besitz anzusehen. Er bemerkte, daß Jorge und seine beiden Söhne bewaffnet waren – selbst der jüngere, der erst etwa dreizehn war. Und sie wurden von einer Leibwache aus Gauchos begleitet.
»Ich mache mir einige Sorgen um Juan«, sagte Jorge, während er neben Forster herritt. »Wir werden uns schon mit genug Problemen herumschlagen müssen, auch ohne Rosas zu provozieren.«
»Vielleicht hätte er Lust, mit mir zurückzufahren, um England und Europa zu besuchen?«
»Das ist sehr nett von Ihnen, aber er wird wissen, daß ich ihn wegschicke. Kriege bringen die Dinge aus den gewohnten Bahnen. Wenn ein Soldat nach Hause zurückkommt, ist das Leben nicht mehr dasselbe. Er braucht eine Herausforderung. Da mein Vater kurz vor meiner Rückkehr gestorben war, hatte ich damals große Verantwortung zu tragen. Falls Rosas an die Macht kommt, werde ich Juan rasch außer Landes schaffen müssen, aber es wäre einfacher, wenn ich etwas für ihn planen könnte.«
Eine große Rinderherde wurde vor ihnen in einen Wald von Gehegen mit hohen Zäunen getrieben, und die Rancharbeiter winkten ihnen zu und begrüßten Jorge mit stolzem Grinsen. Forster bewunderte ihre bunten Ponchos, die breitkrempigen Hüte und die in leuchtenden Farben gestreiften Pferdedecken. Die Gehege nahmen eine große Fläche ein, und die Cowboys manövrierten die Rinder mit viel Geschrei und Peitschenknallen geschickt in die verschiedenen Sektionen. »Sehr eindrucksvoll, Jorge«, sagte Forster, aber er fand den erstickenden Staub und den Lärm von Hunderten von Tieren unangenehm. Er sehnte sich danach, in die Stille der Hazienda zurückzukehren. Als ob er die Gedanken seines Gastes gelesen hätte, schlug Jorge vor, daß sie ihren Lunch in einer Pulperia einnehmen könnten. Forster war einverstanden. Er hoffte insgeheim, daß es dort sauber war. Diese schäbigen Wirtshäuser waren nicht gerade für ihre Sauberkeit bekannt. Als Rivadavias Trupp ins Dorf kam, wurde er von einigen Bewohnern mit lautem Jubel begrüßt. Ein langer Tisch wurde unter einen ausladenden Baum gestellt und mit spitzenbesetzten Tischtüchern und schimmernden Kristallgläsern gedeckt. Forster sah bekannte Gesichter unter den Leuten, die sie bedienten. Er erkannte, daß Jorge seine Diener angewiesen hatte, alles herzubringen, was für einen klassischen Lunch erforderlich war, falls sein Gast Lust haben sollte, daran teilzunehmen. Als die Gruppe absaß und Platz nahm, begannen Gitarrenklänge zu ertönen, und Mariachis spielten ihre hellen Melodien, während prächtige Frauen herauskamen, um zu tanzen. Ihre Röcke waren ein einziges Meer wirbelnder roter Petticoats, und die Absätze trommelten im Stakkato auf den ausgelaugten, harten Boden.
Jorge gesellte sich zu ihnen und tanzte mit der Vortänzerin. Seine Präzision und seine Körperbeherrschung ließen seine Leute in Rufe des Entzückens ausbrechen.
Forster applaudierte. Er fühlte sich jetzt gelöst und genoß das Schauspiel. Er war hungrig, und das Aroma von Fleisch auf dem offenen Grill stieg ihm in die Nase. Er begann das feste Brot, die würzigen Sahnesoßen und Käsestücke zu essen, die ihm von aufmerksamen Dienern gereicht wurden, und spülte alles mit Rotwein hinunter. Sein Glas wurde jedesmal nachgefüllt, wenn er einen Schluck getrunken hatte.
Juan tanzte ebenfalls. Er war das Ebenbild seines Vaters, kräftig, von mittlerer Größe, mit guter Haltung und muskelbepackten, straffen Schultern unter der gut geschnittenen, reich bestickten Jacke. Seine schwarzen Augen verliehen ihm einen Ausdruck großer Ernsthaftigkeit, bis die blendend weißen Zähne sein dunkles Gesicht in einem Lächeln aufleuchten ließen. Wirklich gutaussehend, wie sein Vater, dachte Forster. Und natürlich wie die Mutter.
Jorge kam an den Tisch zurück, zwei Frauen in den Armen, die er wegschickte, um sich wieder zu seinem Gast zu setzen. »Ha!« rief er Juan zu, der in der Nähe stand. »Schenk mir ein bißchen Wein ein. Ich habe mich selbst übertroffen.«
»Du meinst überanstrengt«, sagte Juan, und sein Vater grinste.
»Sehen Sie, wie gut sein Englisch ist? Und es macht ihm Spaß, seinen Vater zu korrigieren.« Er nahm neben Forster Platz. »Bekommen Sie genug zu essen?«
»Ja, in der Tat. Und der Wein ist superb.«
»Gut. Es ist unser eigener Wein.« Er beobachtete Juan eine Weile trübsinnig und wandte sich dann an Lord Forster. »Waren Sie schon einmal in New South Wales?«
»Nein, bisher noch nicht. Ich hatte gehofft, von hier aus dorthin fahren und dann über das Kap der Guten Hoffnung zurückkehren zu können, aber auf dieser Reise wird leider nichts daraus. Ich muß nach England zurück.«
»Ich habe mir die Karte angesehen. Es scheint, daß sie dort ebenso ausgedehnte Weideflächen haben wie wir hier – Land, das für einen Pappenstiel erworben werden kann.«
»Ja, ich glaube, das stimmt. Aber warum interessieren Sie sich für New South Wales, wenn Sie hier dieselben Gelegenheiten haben?«
Jorge tippte mit einem Finger auf den Tisch. »Ich bin vielleicht nur ein Mann vom Lande, aber damit unsere Familie über die Generationen hinweg Bestand hatte und wir unsere gegenwärtige Position erringen konnten, mußten wir lernen, politisch zu denken und zu handeln, die Augen offenzuhalten und zu wissen, was kommt. Ich weiß zum Beispiel, daß ihr Briten die Islas Malvinas im Auge habt und daß es in unserer Regierung Männer gibt, die sagen: ›Sollen sie diese Inseln doch haben, was sind die schon? Bloß Felsbrocken in einem großen Ozean.‹ Aber ich sage, sie sind Land, und Land ist ein Geburtsrecht. Jeder Zoll Land sollte verteidigt werden. Obwohl Sie ein guter Freund sind, werde ich Ihnen in diesem Punkt Widerstand leisten.«
Forster setzte eine Miene aufmerksamen Interesses auf, während er sich Gedanken machte, wie er nach Buenos Aires zurückkommen und einen anderen Fürsprecher für seine Sache finden konnte. Die Briten würden diese Inseln bekommen; sie würden nicht zulassen, daß sie Spanien in die Hände fielen, und keine der beiden großen Nationen war an den argentinischen Ansichten interessiert.
Jorge redete immer noch. »Wir haben Probleme auf höchster politischer Ebene, und am anderen Ende der Leiter beginnen sich die Menschen zu fragen, warum sie kein Land besitzen. Wenn ich ein Peon wäre, würde ich vielleicht die gleichen Fragen stellen, aber ich bin keiner. Ich gehöre zu den großen Familien, die dieses Land gegründet haben, und wir sagen, der Boden gehört uns, während wir den Lärm der Revolution hören.«
»Ihre Leute hier scheinen sehr zufrieden zu sein, Jorge.«
»Das stimmt, aber werden es ihre Kinder ebenfalls sein, oder die Kinder ihrer Kinder? Ich bezweifle es. Und sagen Sie mir eins: Wieso seid ihr Briten so zuversichtlich, daß es euch gelingen wird, New South Wales zu behalten, obwohl ihr in Nordamerika gescheitert seid?«
»Aha!« Forster lächelte. »Diesmal werden wir nicht wieder denselben Fehler machen. Wir haben vor, diese Kolonie zu behalten. Sie wird britisch bleiben.«
»Freut mich, das zu hören. Falls es stimmt, wird es einen stabilisierenden Einfluß haben. Diese Kolonie wird blühen und gedeihen.«
»Haben Sie die Absicht, Juan dorthin zu schicken?«
»Ja, wenn es für seine Sicherheit erforderlich ist. Und ich möchte dort auch in Land investieren. Wenn die Rivadavias Rinderfarmen in New South Wales wie auch in Argentinien besäßen, wären wir sicherer. Falls wir gezwungen wären, Argentinien zu verlassen …« Jorge hob die Schultern.
»Der Gouverneur von New South Wales würde Investitionen unserer Freunde in Argentinien gewiß willkommen heißen«, sagte Forster. »Und wenn ich etwas tun kann, um Ihnen zu helfen, lassen Sie es mich wissen.«
»Das werde ich. Es ist eine Herausforderung, die meinen Sohn reizen wird. Das weiß ich. Er kann als Konquistador in die Welt hinausziehen, statt hier die Stimme zu sein, die dem Donner Einhalt zu gebieten versucht.«
Irland 1825
4. Kapitel
Ein naßkalter, grauer Nebel hing in den Straßen von Dublin und erschwerte es John Pace MacNamara, seinen Führer im Auge zu behalten. Die dahinschlurfende Gestalt unterschied sich mit ihrem hochgeschlagenen Mantelkragen und der tief ins Gesicht gezogenen Mütze in nichts von den anderen. Pace hatte nicht erfahren, wo der Treffpunkt war; man hatte ihm nur gesagt, daß er diesem Burschen folgen sollte. »Aber so wie der durch die Gassen schleicht, als ob ihm der Teufel folgen würde und nicht ein Freund«, murmelte Pace vor sich hin, »werde ich bei meinem Glück irgendwann dem falschen Mann hinterherlaufen.«
Der Führer bog schon wieder um eine Ecke, und Pace lief ihm nach, wich entgegenkommenden Fußgängern aus, verlor ihn im Nebel einen Moment lang aus den Augen und sah ihn dann im trüben gelben Licht eines Wirtshauseingangs wieder, als er im Inneren verschwand. Was glaubt er, was ich bin? Ein Bluthund? Soll ich vielleicht seine Fährte erschnüffeln?
Er zog die Schultern nach vorn und ging mit festen Schritten durch die schmale Gasse, als ob er an dem Wirtshaus vorbeilaufen wollte. Dann drehte er sich abrupt um und trat in das Halbdunkel heruntergedrehter, flackernder Lampen und den Rauch von Torfkohle. Es war so dunstig wie draußen auf den Straßen. Er schob sich ruhig durch die Menge, ohne etwas zu suchen; er wartete auf ein bekanntes Gesicht oder eine vertraute Stimme. Als er an die Bar kam, bestellte er sich ein Porter. Der Wirt nickte, schenkte das Bier ein und brachte es ohne einen Blick zurück zu einer Nische am anderen Ende des Raumes. Pace folgte ihm.
Hinter ihm machten sich ein paar Burschen, die irgendetwas feierten, auf dem Gang breit und schnitten damit den Zugang zu diesem Teil der Bar ab. Scheinbar zufällig, aber es entging MacNamara nicht, als er in die Nische glitt und ihnen dabei das Gesicht zuwandte. Seine Augen waren wachsam; er musterte die Anwesenden mit einem raschen Blick. In dieser Stadt konnte man Freunde nicht von Feinden unterscheiden. Er bemerkte mit Bedacht, daß es nur ein paar Meter bis zu der nicht verriegelten Seitentür waren. Das beruhigte ihn keineswegs. Er fragte sich, ob er in eine Falle gelaufen war.
Ein älterer Mann kam müde durch die Seitentür. Er ließ sich Zeit. Pace tat so, als ob er ein paar Messingtafeln an einem entfernten Kaminsims betrachten würde, aber er sah, wie der Bodenriegel einrastete, als der Mann die Tür zumachte. Er spannte die Muskeln an, aber der Neuankömmling schlurfte herüber, rieb sich die Hände in den schwarzen Fäustlingen und rutschte auf den Platz neben ihm.
Der Wirt fand einen Weg durch die lärmenden Zecher und brachte ein weiteres Glas Porter zu der Nische. Ohne den Kopf zu heben, sah der ältere Mann zu, wie die weiße Schürze verschwand, bevor er etwas sagte. »Kennst du mich?« Seine Stimme war rauh.
»Ja«, nickte Pace, obwohl er bis jetzt kein Zeichen des Wiedererkennens von sich gegeben hatte. Dan Ryan war einer der Organisatoren des Widerstands gegen die Briten. Niemand schien genau zu wissen, welche Rolle Ryan eigentlich spielte, und nur wenige hatten den Mann je zu Gesicht bekommen. Pace hatte ihn zweimal bei geheimen Versammlungen gesehen.
»Sie sind dir auf der Spur, mein Junge«, sagte Ryan.
»Das behaupten sie jetzt schon eine ganze Weile.«
»Aber diesmal wissen sie, wen sie suchen. Du stehst auf der Abschußliste.«
MacNamaras Miene änderte sich nicht. »Ist das so?«
»Es ist so. Du bist gewarnt worden, aber du willst ja nicht hören. Deshalb bin ich selbst gekommen.«
»Die Mühe hätten Sie sich sparen können.«