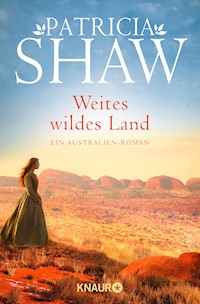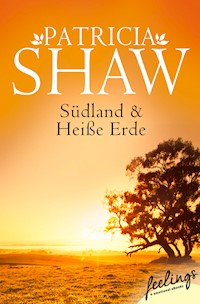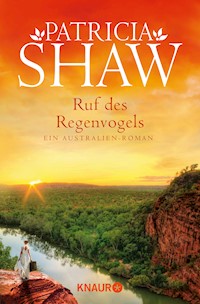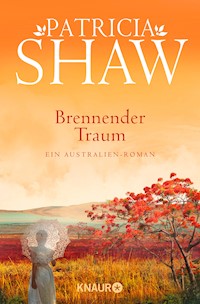9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Saga aus dem Tal der Lagunen
- Sprache: Deutsch
Australien 1850: Wie ein Buschfeuer flammt die Liebe auf zwischen der jungen Politikertochter Laura und dem Farmer Paul McNamara. Doch bald müssen sie erkennen, dass sie im Kampf um die heiße Erde des Landes auf verschiedenen Seiten stehen, denn Lauras Vater will gegen den Willen der Farmer die Abspaltung von Queensland erzwingen. Dann lässt Paul sich durch eine Lüge zu einem Rachefeldzug gegen die Aborigines verleiten. Im Sturm der Ereignisse werden sie alle mitgerissen: harte Pioniere, Glücksritter, skrupellose Politiker und die mutigen Frauen des Grenzlandes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Patricia Shaw
Heiße Erde
Ein Australien-Roman
Aus dem Englischen von Veronika Cordes und Susanne Dickerhof-Kranz
Knaur e-books
Über dieses Buch
Wie ein Buschfeuer flammt die Leidenschaft zwischen der jungen Politikertochter Laura und dem Farmer Paul McNamara auf. Doch bald müssen sie erkennen, dass sie im Kampf um die heiße Erde ihres Landes auf verschiedenen Seiten stehen, denn Lauras Vater will gegen die Farmer die Abspaltung von Pauls Heimatprovinz Queensland erzwingen. Der Sturm der Ereignisse reißt alle mit sich, harte Pioniere, Glücksritter, ehrgeizige Politiker und die mutigen Frauen des Grenzlandes.
Inhaltsübersicht
Wir leben in Taten, nicht in Jahren,
In Gedanken, nicht in Atemzügen,
In Gefühlen, nicht nach dem Zifferblatt einer Uhr.
Wir sollten Zeit nach Herzschlägen bemessen.
Wirklich lebt nur der,
Der ständig sinnt – spürt, dass Handeln aus Großmut
Am meisten vermag.
Philip James Bailey
Prolog
Missmutig ritten die beiden jungen Mädchen den Pfad zur Hauptstraße entlang, die stadtauswärts führte. Beide saßen im Damensattel und trugen einfache weiße Blusen und lange dunkle Röcke. Laura hatte einen unauffälligen Filzhut aufgesetzt, Amelia einen Strohhut, dessen bunte Bänder in der feuchten Luft schlaff herunterhingen.
Sie waren, nicht zuletzt dank der Bemühungen ihrer Väter, eng befreundet – herzlich wenig Familien in dieser kleinen ländlichen Gemeinde konnten es sich leisten, ein Pferd für ihre Töchter zu halten, geschweige denn solch edle Vollblüter, wie sie jetzt ihre Reiterinnen willig durch das rauhe Gestrüpp trugen. War Amelias Vater allein schon wegen seines Wohlstands geachtet, so hatte Lauras Vater sich darüber hinaus auch als Parlamentarier einen Namen gemacht.
Wie Amelia häufig und beharrlich zu sagen pflegte, gehörten sie und Laura zur jungen Elite von Rockhampton, und sie konnte böse werden, wenn Laura sie wegen dieser Anmaßung auslachte und meinte: »Sei nicht albern! Von wegen gute Gesellschaft! Das sind alles Menschen wie du und ich.« Ihre gesellschaftliche Stellung war Anlass langer und heftiger Auseinandersetzungen, zumal es nicht viel gab, worüber sie sich sonst hätten streiten können. Und jedes Mal führte eine solche Diskussion zum gleichen Ergebnis: dass Amelia Roberts, im Gegensatz zu Laura Maskey, großen Wert auf derlei Dinge legte.
»Warum mussten wir diesen langweiligen Weg nehmen?«, maulte Amelia.
»Ist eine Abkürzung«, erklärte Laura. »Außerdem ist es hier kühler und viel interessanter.«
»Was du nicht sagst. Die Fliegen sind entsetzlich lästig.«
»Dann bind dir das Netz um.«
»Ich werd’ doch nicht dieses hässliche Ding über meinen guten Hut ziehen. Komm, wir reiten zu mir, mir ist heiß, und mir reicht’s.«
»Was sollen wir denn bei dir?«
»Ich weiß nicht, wie’s mit dir ist, aber ich werde ein kaltes Bad nehmen. Es dürften bereits an die achtunddreißig Grad sein.«
»Wie schön wäre es jetzt am Meer!«, seufzte Laura. »Ich würde so gerne schwimmen gehen. Es ist ein herrliches Gefühl, im Salzwasser zu baden.«
»Ja, und dir die Haut ordentlich von der Sonne versengen zu lassen.«
»Mir doch egal.«
Die Pferde trugen sie aus dem Buschwerk auf die offene Straße. Amelia atmete erleichtert auf. »Hier weht wenigstens ein kleines Lüftchen.«
»Und jede Menge Staub fliegt in der Luft herum. Wir brauchen Regen.«
»Kommst du nun mit zu mir?«
»Meinetwegen«, stimmte Laura, die jetzt gleichauf mit Amelia ritt, zu. »Wenn ich nach Hause komme, wird mich Mutter nur in Arbeit einspannen. Sie erwartet ein paar Damen zum Tee.«
Amelia nickte verständnisvoll. Ihr Vater war verwitwet; bei ihr daheim würde keine Mutter ein aufmerksames Auge auf die beiden jungen Damen haben.
An einer Straßenbiegung bemerkte Laura einen abzweigenden Pfad. »Wohin führt der?«, fragte sie Amelia.
»Runter zur Murray-Lagune.«
Beim Weiterreiten meinte Laura: »Zu ärgerlich, dass Frauen nicht zur See hinunterdürfen. Warum eigentlich?«
»Weil da die Herren der Schöpfung schwimmen und Damen dort nichts verloren haben.«
»Eben. Und warum dürfen wir dort nicht schwimmen? Warum müssen wir diese Hitze ertragen, während die sich in der Lagune erfrischen? Ungerecht ist das.«
»Dir bleibt ja immer noch der Fluss, vorausgesetzt, du lässt die Krokodile nicht an dich rankommen«, grinste Amelia.
»Sehr komisch! In der Lagune soll es übrigens auch eine Art Floß geben, von dem aus man ins Wasser springen kann.«
Amelia hielt ihr Pferd an. »Was die wohl anhaben?«
»Wer?«
»Die Männer, du Dummkopf. Beim Baden.«
»Woher soll ich das wissen?« Laura wartete, bis Amelia einen Steigbügel zurechtgerückt hatte, dann nahm sie den Hut ab und schüttelte die vom Schweiß feuchten Locken.
»Hat dir das dein Bruder nicht verraten?«, fragte Amelia.
»Leon würde mir nicht mal sagen, wie spät es ist.« Sie lachte. »Wahrscheinlich tragen sie lange Unterhosen. Carter Franklin, unser Bankdirektor, geht auch dorthin zum Schwimmen. Es muss ein Bild für die Götter sein, dieser Fettwanst in Unterzeug.«
»Du bist gemein«, kicherte Amelia. »Vielleicht haben sie ja auch gar nichts an. Würde mich schon interessieren.«
»Mich auch«, feixte Laura.
»Dann trau dich doch und überzeug dich selbst.«
Laura starrte sie an. »Du bist wohl übergeschnappt. Ich kann doch nicht einfach dort aufkreuzen. Die würden mich auf der Stelle erschießen.«
»Dann versteck dich im Gebüsch, damit man dich nicht sieht.«
»Du meinst, sie heimlich beobachten?«
»Warum nicht? Wäre doch ein Mordsspaß. Und wir wären die einzigen Mädchen, die Bescheid wüssten.«
»Warum tust du es dann nicht?«
»Weil ich dich zuerst herausgefordert habe. Na los, Laura Maskey. Nur Mut!«
Laura, die dazu neigte, erst zu handeln und dann zu denken, zögerte nicht lange. Amelia hatte ja recht. Die Männer zu bespitzeln war bestimmt ein Spaß. Es geschah diesen selbstsüchtigen Kerlen ganz recht. »Und wo bleibst du so lange?«, fragte sie Amelia.
»Um hier zu warten, ist es zu heiß. Ich reit’ schon mal vor und sorge dafür, dass uns die Köchin einen leckeren Nachmittagstee zubereitet.«
»Mit warmen Hefebrötchen und Brombeermarmelade«, forderte Laura als Belohnung für ihr Wagnis.
»Geht in Ordnung«, lachte Amelia.
Laura ließ ihr Pferd wenden und galoppierte die Straße zurück, bis zur Abzweigung, die zur Lagune führte. Willig trabte der Vollblüter den ausgetretenen Pfad entlang, beschleunigte das Tempo jedoch, als er die Witterung von Wasser aufnahm, so dass Laura ihn am kurzen Zügel nehmen musste. Den Hut unter den Sattel geschoben, dirigierte sie das Tier behutsam in den Schutz des Unterholzes, umsichtig Zweige zur Seite biegend, geduckt, wo es galt, dicken Ästen auszuweichen.
Die Rufe und das Lachen vor ihr bestärkten sie nur in ihrem Vorhaben. Das Pferd schien zu verstehen, dass ein prickelndes Abenteuer angesagt war; leichtfüßig bewegte es sich durch das spärliche grüne Unterholz, bis ihm Laura den Kopf tätschelte. »Pst jetzt«, flüsterte sie. »Ganz ruhig. Nicht weiter.«
Unendlich vorsichtig bog sie einen belaubten Ast zur Seite, um zu sehen, wo sie sich befand, und fuhr zusammen, als sie direkt zu einer kleinen Mole hinüberblickte. »Es geht los!«, murmelte sie zufrieden, denn ihr Versteck gewährte volle Sicht auf die nicht weiter als fünfzig Schritt von ihr entfernten Schwimmer.
Sie musste sich zusammenreißen, um nicht loszulachen. Warum war Amelia bloß nicht mitgekommen! Hier gab es etwas zu sehen, mehr als ein Dutzend Mannsbilder, die sich in der Lagune, an der Mole und auf einer im tieferen Wasser verankerten Plattform tummelten, die als Sprungbrett diente.
Mit schweißüberströmtem Gesicht saß Laura, von Insekten umschwirrt, in ihrem heißen Versteck und setzte ihre Beobachtungen fort. Der große See wirkte so kühl und einladend, dass sie darüber beinahe vergaß, weshalb sie gekommen war. Als sie jetzt die Schwimmer genauer musterte, war sie erst einmal perplex, um kurz darauf loszuprusten und in ihrem Bemühen, sich nicht zu verraten, schier am Lachen zu ersticken. Keiner der Männer trug auch nur einen Faden am Leibe! Wie Gott sie erschaffen hatte, planschten sie herum! Männer, ob dick oder dünn, groß oder klein, rannten die Mole entlang und sprangen zwischen die Schwimmenden; andere wiederum kletterten auf die Plattform und scherzten ausgelassen mit ihren Kumpanen, allesamt im Adamskostüm.
»Wie obszön!«, kicherte Laura in sich hinein und wischte sich das Gesicht mit dem Taschentuch ab. Laura Maskey, die mit ihren zwanzig Jahren noch nie einen nackten Mann gesehen hatte, war hingerissen.
Unvermittelt raschelte etwas im Unterholz. Laura, die im Busch aufgewachsen war, reagierte instinktiv. Eine Schlange? Das Pferd jedoch war noch schneller. Wie von der Tarantel gestochen, bäumte es sich auf und brach durch das schützende Geäst. Laura klammerte sich an den Kastanienbraunen, der nun ins Freie schoss – auf verbotenes Terrain! Es gelang ihr, ihn zu bändigen, noch ehe er allzu weit das sandige Ufer entlanggaloppiert war, aber als sie ihn kehrtmachen ließ, konnte sie das wütende Geschrei der Männer hören. Na, wenn schon! Ihr blondes Haar wehte im Wind, als sie dem Pferd die Zügel freigab und sich, übermütig lachend, aus dem Staub machte. Gewonnen! Sollten die jählings Überraschten ihrer Empörung doch Luft machen. Was konnten sie ihr schon anhaben? Sie waren entdeckt, sie hatte sie in ihrer ganzen Pracht gesehen.
Für die beiden jungen Mädchen war dies lediglich ein weiterer Schabernack. Aber steter Tropfen höhlt den Stein, und die Eskapade sollte für die Tochter von Fowler Maskey, dem Parlamentsmitglied und Wahlkreisabgeordneten, weitreichende und tragische Folgen haben. Provinzstädte sind nun einmal in der Regel konservativ und anfällig für Tratsch, ganz besonders, wenn sie wie diese hier am Fluss gerade erst vor zehn Jahren gegründet worden waren und um Anerkennung kämpften. Ihre Bewohner, die das Stigma einer Goldgräbersiedlung ablegen wollten, achteten auf ihren guten Ruf – um mit Amelia zu sprechen, »auf ihre gesellschaftliche Stellung« – und strebten nach Ansehen und Geltung. Nachbarn wurden scharf beobachtet, Familienzwiste hinter geschlossenen Fensterläden ausgetragen, manche Kirchgänger benahmen sich auffällig, und keiner war sich der angespannten Stimmung deutlicher bewusst als Lauras Vater, dessen Zukunft als Abgeordneter vom Wohlwollen der Bevölkerung abhing. Und Fowler Maskey war ein ehrgeiziger Mann.
Erstes Kapitel
Die Sonne ging wie geschmolzenes Gold über dem Meer um Moreton Island auf, ließ das klare Wasser der Bucht noch intensiver funkeln. Singende Wale tummelten sich nach ihrer langen Reise aus südlicheren Gefilden darin, ohne zu ahnen, dass todbringende Harpunen ihrer harrten. Die abklingende Flut hob glitzernde Mangroven aus der dampfenden Dunkelheit; Scharen aufgeregt zwitschernder Vögel flatterten auf, um ihr Tagewerk an den Uferböschungen und den flachen Gestaden der vielen Flussläufe zu beginnen. Unbehelligt überflogen sie die kleinen Boote, die sich auf über dreißig Meilen von der Küste zur Stadt drängten, labten sich am Nektar der roten und weißen Blüten der Lampenputzerbäume, die den Strand säumten, und stießen aus dem hohen Eukalyptus hinunter auf alles, was nach Beute aussah.
Es war das Zeitalter der großen Kanäle; der breite Brisbane River war zu einer wichtigen Wasserstraße für die Hauptstadt des riesigen neuen Staates Queensland geworden. Die Bewohner der blühenden Stadt erinnerten sich ungern daran, dass ihr an einer Biegung des Flusses gelegenes Zuhause früher einmal eine Strafkolonie gewesen war. Und wenn sie spazieren gingen, dachten sie längst nicht mehr daran, dass Männer in Ketten, von der Peitsche angetrieben, sich abgemüht hatten, in einer subtropischen Wildnis Straßen zu planieren und wuchtige Regierungsgebäude zu errichten. Sie kamen von den Britischen Inseln, hatten unter Fieber, Unterernährung und den Misshandlungen ihrer Aufseher gelitten und waren gestorben, ohne dass ihnen irgendjemand eine Träne nachgeweint hatte, ohne je zu erfahren, dass ihre Schinderei nicht umsonst gewesen war. Sie hatten den Grundstein zu einer Stadt gelegt und den Weg für ihre Nachfahren und andere unerschrockene, zähe Pioniere geebnet.
Erst dreißig Jahre waren vergangen, seit das Strafgefangenenlager von Moreton Bay nach wütenden Protesten aus der Bevölkerung aufgelöst und das Grenzland von Brisbane für Siedler zugänglich gemacht worden war. Vielen Häftlingen fehlte nach ihrer Entlassung das für die Heimfahrt nötige Geld, und so blieben sie zwangsläufig in Australien. Andere ließen sich aus freien Stücken dort nieder, bis an ihr Lebensende von ihren früheren Bewachern argwöhnisch beobachtet. Sie wurden Zeuge, wie der neue, immer noch vom ersten Premier, Sir Robert Herbert, regierte Staat einen Tiefschlag einstecken musste, den ihm ausgerechnet das Mutterland verpasste.
Gouverneur Sir George Ferguson Bowen, der sich mit Herbert das Privileg teilte, an der Spitze der noch jungen Kolonie zu stehen, verließ sein trautes Heim am Fluss und bestieg in Begleitung seines Adjutanten, Captain Leslie Soames, seine Kutsche. Wäre es ihm als Repräsentant Ihrer Majestät nicht verboten gewesen, hätte er, wie jeder gewöhnliche Sterbliche, die kurze Strecke auf der staubigen Straße zu Fuß zurückgelegt.
Sein Verhalten war ungewöhnlich. Normalerweise rief er die Parlamentarier in seinem Amtssitz zusammen, aber diesmal wollte Bowen vermeiden, die Herren der Presse aufzuscheuchen. Eine Versammlung im Regierungsgebäude deutete auf politische oder gesellschaftliche Veränderungen hin, und in beiden Fällen sorgten die davon betroffenen Abgeordneten – allein schon, um sich wichtig zu machen – für Verbreitung, noch ehe sie tatsächlich Bescheid wussten.
Um jedem Verdacht zuvorzukommen, sein Erscheinen habe offiziellen Charakter, hatte er sich für einen seiner Meinung nach schlichten Anzug entschieden. Doch seine Gattin, Gräfin Diamentina, sorgte dafür, dass er sich jederzeit als Inbegriff der Eleganz präsentierte. Selbst in dem schwülen Klima verwarf er Anzüge aus Seide oder Baumwolltuch, wie sie in Mode gekommen waren; er fand sie hässlich und für seine exponierte Stellung unangebracht. An diesem Tag trug er einen schwarzen Rock, am Stehkragen mit einer Borte verbrämt, Kniehosen und spiegelblanke Stiefel und über dem Seidenhemd eine leichte Wollweste sowie eine seidene Krawatte, die von einer Perlennadel gehalten wurde.
Als er lächelnd das Portal des Parlamentsgebäudes betrat, entledigte er sich nonchalant seines grauen Zylinders und der Handschuhe. Die Leute in der Eingangshalle starrten ihn an, verbeugten sich kurz und machten ihm Platz. Lediglich einer, der vorwitzige Reporter des Brisbane Courier, verstieg sich zu der Frage »Was führt Sie hierher, Herr Gouverneur?«.
Bowen neigte huldvoll das Haupt, um zu zeigen, dass er gut gelaunt und durch nichts aus der Ruhe zu bringen war. »Ach, Sie sind’s, Mr. Kemp! Bestimmt wissen Sie schon, dass die Regatta wegen des unvorhersehbaren Regens heute Morgen abgesagt werden musste.«
Die Umstehenden kicherten. Jeder wusste, dass Tyler Kemp ein begeisterter Kanute war.
»Der Premier erwartet Sie?« Kemp ließ sich nicht beirren.
»Das möchte ich doch annehmen.« Bowens Lächeln war noch immer verbindlich. Für eine Terminabsprache war keine Zeit geblieben, die Angelegenheit war dringend.
»Was steht denn heute an?«, wollte Kemp wissen.
»Ein rein freundschaftlicher Besuch. Wissen Sie, ich habe noch nie etwas davon gehalten, mich im Elfenbeinturm zu verschanzen, und was wäre an einem trüben Tag anregender als unser Parlament?«
Kemp gab nicht so leicht auf. »Das Parlament tagt, Sir. Werden Sie darauf bestehen, vorgelassen zu werden?«
Bowen warf einen Blick auf seine goldene Taschenuhr, schob sie wieder ein. »Die Sitzung dürfte eben zu Ende gegangen sein.«
Wie zu erwarten, war der Premier von seiner Anwesenheit unterrichtet worden und hatte, wie Bowen erleichtert feststellte, keine Zeit verloren, dem Besucher entgegenzueilen.
»Exzellenz! Guten Tag. Treten Sie doch näher. Wir gehen wohl am besten in mein Arbeitszimmer.«
»Gerne.« Der Premier musste über sein plötzliches Auftauchen überrascht sein, war allerdings klug genug, es sich nicht anmerken zu lassen. Politiker durch und durch, pflegte er in Gegenwart unbeteiligter Dritter häufig zu bemerken: »Nicht vor den Kindern.« Auch heute hielt er sich an diese Regel.
Bowen verkörperte, was man allgemein unter einem ranken, schlanken Mann verstand, Herbert dagegen war um einiges größer und auch sehr viel kräftiger gebaut. Als er, gefolgt von einem Adjutanten, mit dem Gouverneur auf sein Arbeitszimmer zusteuerte, trat Tyler Kemp den Rückzug an. Nicht einmal er mischte sich in die Angelegenheiten dieser beiden imponierenden Persönlichkeiten.
»Tee oder Kaffee?«, fragte der Premier.
»Kaffee bitte. Für Soames auch.«
Mit vizeköniglichem Segen nahm Herbert seinen Platz hinter dem ausladenden Mahagonischreibtisch ein und tauschte mit dem Gouverneur ein paar Belanglosigkeiten aus, wohl wissend, dass der eigentliche Grund des Besuchs beizeiten zur Sprache kommen würde. Bowen war dankbar für den Aufschub; er hatte schlechte Nachrichten zu überbringen und wollte dabei nicht unterbrochen werden.
Schon bald darauf war Herberts junger Sekretär mit einem Servierwagen zurück, auf dem oben ein silbernes Kaffeeservice und unten eine Schale mit Keksen stand. »Soll ich eingießen, Sir?«, fragte er.
Herbert nickte. »Exzellenz, darf ich Ihnen meinen neuen Sekretär, Joe Barrett, vorstellen?«
Die Porzellantassen klirrten gefährlich, als sich der Gouverneur erhob. Barrett, der mit dem Eingießen beschäftigt war und jetzt einen Händedruck tauschen sollte, geriet in Verlegenheit.
Herbert lachte. »Als Sekretär macht er sich gut, als Kellner weniger. Soames, wenn Sie so nett wären, ihm zur Hand zu gehen?«
Der Captain zog die Augenbrauen hoch, und seine dünne Nase kräuselte sich angesichts einer derart unverschämten Bitte, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als – schon um diese unwürdige Aufgabe so rasch wie möglich hinter sich zu bringen – seinem Gouverneur eilfertig und gekonnt die Tasse zu füllen.
»Hat Jura studiert, unser Joe, an der Universität von Sydney«, sagte der Premier stolz. »Sogar mit Auszeichnung. Nicht wahr, mein Sohn?«
»Ja, Sir. Benötigen Sie mich hier noch, Sir?«
»Nein danke. Wenn Sie dafür mal einen Blick auf diese Rechnung werfen könnten, die der Bauminister durchboxen möchte. Sie hat mehr Löcher als ein Paar alte Socken.«
»Sofort, Sir.« Barrett, noch unerfahren im Umgang mit solch hohem Besuch, floh.
»Die im Norden lassen sich auf blutige Auseinandersetzungen ein«, erklärte Herbert dem Gouverneur freundlich, »denn sie siedeln auf Land, das weit außerhalb der Grenzen liegt. Ich selbst stamme aus der Gegend und gönne ihnen durchaus ihre großen Grundstücke. Auch wenn uns dadurch Einkünfte verlorengehen, weil sie sich davor drücken, Pacht zu bezahlen.« Er trank zügig seinen Kaffee aus. »Wir müssen mehr Inspektoren einstellen, weitaus mehr, um dies alles zu überwachen.«
»Das hat Zeit«, winkte der Gouverneur ab. Er stand auf, musterte die Tuschezeichnungen mit Ansichten von Brisbane und rückte einen der Rahmen zurecht. »Hervorragend. Von wem stammen die?«
»Sie werden es nicht glauben.« Herbert grinste. »Von unserem Freund, Mr. Kemp.«
»Was Sie nicht sagen! Sehr talentiert. Schade, dass er sich nicht auf seine künstlerischen Fähigkeiten konzentriert.« Die Zeichnungen schienen Erinnerungen in ihm zu wecken. »Als ich zum ersten Mal hier war, wurde mir der Bericht des Finanzministers vorgelegt.«
»Ach ja.« Herbert lächelte. »Das muss ein Schock gewesen sein. Was hatten wir denn vorzuweisen? Kaum fünf Shilling in der Kasse, um einen neuen Staat zu gründen. Nicht gerade ein vielversprechender Start.« Er seufzte. »Die mageren Tage liegen ja wohl längst hinter uns. Es sei denn, Ihre Bemerkung, dass keine weiteren Inspektoren eingestellt werden können, lässt wirklich nichts Gutes ahnen.«
»Sie sagen es.«
»Dann raus damit! Vergällen Sie mir das Weihnachtsfest.«
»Es geht das Gerücht um – wohlgemerkt, bisher ist es tatsächlich nichts weiter als ein Gerücht dass die Agra und Masterman Bank in London in Schwierigkeiten steckt.«
»Allmächtiger! Malen Sie bloß nicht den Teufel an die Wand! Wir wären ruiniert. Wir haben eine Kreditzusage über eine Million Pfund, für den Eisenbahnbau und andere Dinge. Sollten diese Gelder eingefroren werden … Nicht auszudenken!« Er zog ein großes Taschentuch heraus und wischte sich den Schweiß vom Gesicht.
»Deswegen halte ich es für angebracht, im Augenblick jede weitere Ausgabe einzusparen.«
»Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Für heute Abend habe ich eine Ausschusssitzung anberaumt, die letzte in diesem Jahr. Ich werde unverzüglich die Zügel anziehen. Und beten.«
Mit Befriedigung nahm der Gutsbesitzer und Abgeordnete von Rockhampton, Fowler Maskey, Anfang Februar zur Kenntnis, dass in Herberts Kabinett Uneinigkeit herrschte. Der jetzt fünfzigjährige Fowler war ein einflussreicher Mann, nicht zuletzt dank des Vermögens, das er von seinem Vater, einem der bedeutendsten Schafzüchter und Großgrundbesitzer von New South Wales, geerbt hatte. Vor seinem Tod hatte John Dunning Maskey im Vertrauen darauf, dass in dem neuen Staat beste Zukunftsaussichten bestanden, in der Gegend von Rockhampton weitere Ländereien erworben.
Fowler hatte seinem Vater rückhaltlos vertraut. Er war mit seiner Familie in den Norden gezogen, hatte sich, ehrgeizig wie er war, ein Haus gebaut und sich als einer der Ersten in der neuen Stadt niedergelassen, obwohl seine Frau Hilda die Hitze im Sommer unerträglich und sein inzwischen zweiundzwanzigjähriger Sohn Leon die provisorische, nicht besonders hübsche Ansiedlung am Fluss grässlich fand. Leons Proteste waren auf taube Ohren gestoßen. Weder verstand er sich aufs Argumentieren, noch konnte man ihm, mangels Interesse für Schafe oder Rinder, die Verwaltung einer der Maskeyschen Ländereien anvertrauen. Er war ein drahtiger, gutaussehender junger Mann mit blondem Haar und den blauen Augen seiner Mutter. Fowler zeigte sich gern mit ihm. Er war gesellig, ein passabler Kricketspieler, wusste mit Karten geschickt umzugehen, und jede Gastgeberin schätzte ihn als Bereicherung ihrer Feste. Sein Vater verglich ihn mit einer umherschwirrenden Biene, die die neuesten Nachrichten, Stimmungen und Entwicklungen auskundschaftete.
Fowlers Gattin Hilda war dafür, dem Sohn mehr Verantwortung zu übertragen. »Was soll denn aus ihm werden, wenn er weiterhin nur seine Zeit vertrödelt?« Fowler kümmerte das nicht. Er hatte nichts mit Dynastien im Sinn, dachte nur an sich und seine ehrgeizigen Ziele. Wenn er einmal nicht mehr da war, orakelte er, würde Leon ein paar Jahre in Saus und Braus leben, so lange eben, bis das Erbe verprasst war.
Als Leon erklärt hatte, er wolle lieber in Brisbane leben, war Fowler einverstanden gewesen. »Aber ja doch. Wo immer du willst, sofern du für dich selbst aufkommst.«
»Das ist nicht fair«, hatte ihm Leon vorgehalten. »In Rockhampton hab’ ich nichts weiter zu tun, als deinen Diener zu spielen.«
»Du trägst dazu bei, dass dein Vater Karriere macht«, hatte Fowler geantwortet, »und wenn du ohne mein Einverständnis woanders leben willst, bekommst du nicht einen Penny von mir.«
Leon war geblieben. Nachmittags traf man ihn meist an der Murray-Lagune, in der dort entstandenen Männerbadeanstalt. Die Abende verbrachte er im Criterion Hotel oder im Herrenclub auf der Quay Street, beides vom elterlichen Haus aus zu Fuß gut zu erreichen.
Zu Fowlers Überraschung sagte seiner Tochter Laura die Stadt durchaus zu. Sie liebte das stattliche Haus mit dem schmiedeeisernen Geländer um die vordere Veranda und dem umlaufenden Balkon im oberen Stockwerk. Direkt an der Quay Street gelegen, ermöglichte es zu Hilda Maskeys Leidwesen kein zurückgezogenes Leben, während Laura ganz und gar nichts dagegenhatte, das pulsierende Treiben um sich herum zu spüren. Im Gegensatz zu ihrem Bruder genoss sie es, auf der Veranda zu sitzen und mit den Vorbeikommenden, Freunden oder Fremden, zu plaudern.
Sie war ein eigensinniges junges Mädchen, groß und kerngesund, mit ebenso seidenweichem Blondhaar wie ihr Bruder. Nur war sie ungestümer als er, hin und wieder sogar mehr als ihr guttat, aber sie würde ja sowieso bald heiraten, und dann wäre Fowler diese Sorgen los. Kürzlich hatte sie ihn bestürmt, sie zu den Goldfeldern außerhalb Rockhamptons mitzunehmen, doch sie musste warten, er war zu beschäftigt. Gold. Fowler lächelte. Rockhampton hatte sich über Nacht zu einer Stadt gemausert, dank des Goldrauschs im nahe gelegenen Canoona. In kurzen Zeitabständen war man auf weitere Minen gestoßen. Großartig, dass neben der bereits blühenden Viehwirtschaft auch noch Goldfelder im eigenen Wahlkreis ausfindig gemacht wurden.
Der alte John Maskey hatte zweifelsohne eine kluge Entscheidung getroffen. Für einen Parlamentarier waren die Zukunftsaussichten in Rockhampton mehr als günstig, sofern er seine Trümpfe richtig ausspielte. Und Fowler würde genau das tun. Zu Hilda hatte er gesagt: »Ich erwarte, dass mich meine Familie voll und ganz unterstützt. Wenn ich hier bin, wirst du so viele Einladungen geben wie möglich, und wenn ich mich in Brisbane aufhalte, kannst du wohltätige Verpflichtungen übernehmen. So was macht immer einen guten Eindruck.«
»Was für wohltätige Verpflichtungen?«
»Woher soll ich das wissen? Das ist Frauensache. Und spann Laura mit ein.«
»Laura?«, war Hilda hochgefahren. »Die tut doch sowieso nicht, was ich ihr sage! Die gibt sich nur mit den Pferden ab, ist ständig unterwegs. Deine Schuld. Du lässt ihr völlige Freiheit.«
»Dann beschaff ihr einen Ehemann, das wird sie zur Ruhe bringen.«
Derart lässig tat Fowler solche »Nebensächlichkeiten« ab, um für seine Pläne einen klaren Kopf zu bewahren. Er stand an dem großen Fenster am Ende des Flurs und tat so, als wolle er frische Luft schnappen, tatsächlich lag er aber zwischen der Tür zum Kabinettszimmer und seinem Büro auf der Lauer. Sobald die ehrenwerten Herren auftauchten, wollte er, der kleine Hinterbänkler, sich auf dem Weg in sein eigenes Zimmer unter sie mischen. Premier Herbert war zwar ein Verfechter von Solidarität im Kabinett, aber frisch gewagt ist halb gewonnen, und vielleicht konnte sich Fowler einen Minister schnappen, in dessen Ohren noch Herberts Standpauke nachhallte und der deshalb mit seinen Gedanken ganz woanders war. Fowler war sich sicher, dass Premier Herbert die Zügel entglitten waren und dass es nicht viel bedurfte, ihn aus dem Sattel zu heben.
Und da drängten sie bereits heraus, mit unheilverkündenden, bestürzten Gesichtern. Er gesellte sich zu ihnen, bestrebt, das Stimmengewirr zu entschlüsseln, mit dem die Parlamentarier ihrem Unmut Luft machten. Ein großer Fisch ging ihm ins Netz: der Finanzminister. »Wir unterstützen voll und ganz Raffs Petition, das Werften-Projekt in Brisbane zu fördern, Sir. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht.«
»Alles zu seiner Zeit«, schnappte der Finanzminister und eilte an ihm vorbei.
Fowler passte sich dem Schritt des Postministers an. »Mächtig schwül heute, wie?« Und als der Minister lediglich nickte, fuhr Fowler fort: »Vielleicht interessiert es Sie, dass bei mir ganze Säcke voll Beschwerden wegen der Post eingehen.«
»Sie haben doch den Telegraphen, oder nicht?«, knurrte der Postminister, und Fowler grinste in sich hinein. Natürlich hatten sie den bekommen, obwohl sich dieser alte Knabe hier dagegen ausgesprochen hatte. Ein paar lumpige Pfund als Unkostenbeitrag für die Wahlkampagne der Parlamentarier hatten genügt, um die Bewilligung durchzusetzen. »Haben wir, und wir sind Ihnen auch sehr dankbar dafür, aber die Goldgräber können es sich nicht leisten, jedes Mal zu telegraphieren, wenn sie Verbindung mit ihren Lieben daheim aufnehmen wollen. Reichlich aufgebracht sind sie. Ihrer Meinung nach reicht eine Postzustellung alle zwei Wochen bei weitem nicht aus.«
»Wenden Sie sich doch an den Premier«, meinte der Minister, als sie den Treppenabsatz erreichten. Und dann, als sich ihre Wege trennten, rief er ihm noch über die Schulter nach: »Oder Macalister.«
»An wen?«, fragte Fowler verdutzt, aber die Tür des Ministers fiel bereits ins Schloss.
Arthur Macalister war Abgeordneter für Ipswich und zudem Arbeits- und Landwirtschaftsminister. Wieso sollte er sich an ihn wenden? Er war ein Nichts, ein bärbeißiger Haudegen, auf dessen Meinung keiner etwas gab. Fowler jedoch würde mit ihm sprechen, und zwar sofort. Er kramte in seinem Büro herum, bis er zwei Flaschen Whisky gefunden hatte, verstaute sie in einer Tüte und machte Arthur seine Aufwartung.
»Lieber Freund«, sagte er, nicht ohne die hektische Atmosphäre in Macalisters Büro wahrzunehmen, »verzeihen Sie die Störung, aber meine Nachlässigkeit … Ich hätte Ihnen dies hier schon zu Weihnachten vorbeibringen sollen, eine kleine Aufmerksamkeit meiner Wähler, aber ich bin nicht dazugekommen. Das Ausbaggern des Fitzroy River geht dank Ihrer tatkräftigen Unterstützung zügig voran.«
»Guter Mann«, sagte Macalister und verstaute den Whisky zwischen Landkarten in einem prallvollen Schrank, ohne Fowler auch nur einen Tropfen anzubieten. »Nehmen Sie Platz, Maskey, ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen.«
Eine Messingblumenschale auf einem Sockel hinter seinem Gastgeber reflektierte Fowlers frisches, blühendes Gesicht, das ein breites Grinsen zeigte. Er konnte nur hoffen, dass es von der Zerrspiegelung kam. Wenn es Ärger gab, durfte er keine Schadenfreude zeigen. Er kniff die wulstigen Lippen zusammen, um jeden falschen Eindruck zu vermeiden.
Arthur war Vertreter einer aufmüpfigen Meute von Kohlebergarbeitern. Er konnte seine Erregung nur schwer unterdrücken, und an seinem rechten Auge, oberhalb des buschigen Barts, zuckte es nervös. »Man will ihm das Genick brechen!«, hechelte er.
Das Genick brechen! Großer Gott! Fowlers Gedanken überstürzten sich. Wie sicherlich alle anderen Politiker in diesem Gebäude auch, überlegte er, ob er sich um die Nachfolge bewerben sollte. Mit wem konnte er rechnen? Ob sich der eine oder andere Gunstbeweis jetzt auszahlte? Premier von Queensland werden, der mächtigste Mann im Staat! Dass er einen eigenen Staat im Norden, mit Rockhampton als Hauptstadt und natürlich ihm als Premier, angestrebt hatte, war unwichtig geworden. Sollten die Separatisten doch sehen, wo sie blieben! Dies hier war weitaus lohnender. Beinahe hätte er aufgelacht. Sollte er gewinnen, würde der Staat intakt bleiben, er würde die Spaltung verhindern.
»Menschenskind, haben Sie mich verstanden?«
»Ja. Ich habe es kommen sehen. Herbert ist nicht sehr beliebt, dennoch überrascht es mich.« Es sah ganz danach aus, als könne er sich Macalisters Unterstützung sicher sein, und zudem konnte ihm der Schotte die eine oder andere Stimme im Süden zuschanzen.
»Nicht sehr beliebt? Das ist noch untertrieben. Der Mann ist wahnsinnig. Wenn wir auf ihn hören, werden wir alle unseren Sitz verlieren. Er versteift sich darauf, an allen öffentlichen Baumaßnahmen den Rotstift anzusetzen und höhere Steuern und Abgaben einzuführen.«
»Was Sie nicht sagen.« Jeder wusste, dass Herberts Pfennigfuchserei nicht auf Begeisterung stieß, aber dies ging zu weit.
»Wenn Sie mich fragen«, fuhr Macalister fort, »müssen wir ihm das Handwerk legen. Sind Sie auch dafür?«
»Muss ich wohl«, entgegnete Fowler. »Die Zukunft des Staates ist wichtiger als ein einzelner Mann, der noch dazu nichts von Finanzen versteht. Das habe ich schon immer gesagt. Wir brauchen an der Spitze einen Mann, der sich darüber im Klaren ist, dass die wirtschaftliche Situation in Queensland davon abhängt, ob das Gleichgewicht zwischen Investition und Expansion gefunden werden kann. Wenn er jetzt einen Rückzieher macht, waren alle bisherigen Anstrengungen vergebens.«
»Ganz meine Meinung. Sollte ich gewählt werden, wird genau nach diesem Rezept verfahren.«
»Wie?«, fuhr Fowler hoch. »Sie bewerben sich um das Amt?«
»Gewiss doch, und ich bitte Sie um Ihre Unterstützung. Wenn man bedenkt, was für taube Nüsse einige meiner Kollegen sind, kann ich nur sagen, es war ein Fehler von Herbert, Sie bei der Kabinettsbildung zu übergehen. Sie können sich drauf verlassen, dass mir dieser Fehler nicht unterläuft.«
Das schlug doch dem Fass den Boden aus! Fowler glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Mit Speck fängt man Mäuse – der älteste Trick der Welt. Macalister Premier? Grotesk!
»Herbert biedert sich der vizeköniglichen Sippe an, das ist sein Problem«, hob Macalister wieder an. »Was für mich nicht in Frage kommt. Die können mich mit ihrem albernen Getue nicht beeindrucken.« Er sah Maskey durchdringend an, sein Auge zuckte warnend. »Ich darf also mit Ihnen rechnen?«
»Natürlich«, sagte Fowler. Mochten seine Träume, an der Spitze des Staates zu stehen, auch schwinden – dafür wurde die Separatistenbewegung unvermittelt wieder zu einer Triebfeder.
Die beiden Männer tauschten einen Händedruck, und Fowler machte sich auf, seine eigenen Chancen auszuloten. Da er feststellen musste, dass er nur unter »ferner liefen« rangierte, versprach er noch zwei weiteren Herren, die Stimmenjagd auf das hohe Amt machten, hoch und heilig seine Unterstützung.
»Von denen wird sowieso keiner Bob Herbert ausbooten«, meinte er zu Leon, der immer gern nach Brisbane mitkam. »Du gehst jetzt raus und hörst dich um. Wenn ich schon für Herbert stimmen muss, will ich auch etwas für mein Geld haben.«
Er zündete sich seine Pfeife an und machte sich daran, eine Erklärung für die Rockhamptoner Presse abzufassen. Darin stellte er Herbert als Verräter des Nordens hin, als einen Regierungschef, der die Bedürfnisse der braven Bürger aus dem Norden und Südosten des Staates nicht beachtete und ihnen nicht nur sein Engagement, sondern auch die öffentlichen Gelder vorenthielt. Als sein Aufsatz sich allmählich in ein beißendes Pamphlet gegen den Premier verwandelte, kam Leon aufgeregt zurück. »Herbert hat abgedankt!«
»Was?« Fowler stieß beinahe das Tintenfass um.
»Er hat abgedankt, wirklich! Gerade eben. Die Gründe dafür will er später bekannt geben.«
»Zum Teufel mit seinen Gründen – wenn man tot ist, ist man tot. Und wer soll sein Nachfolger werden?«
»Keine Ahnung.«
»Dann stell’s fest, du Dummkopf. Geh runter in die Bar. Schmeiß ein paar Runden, kostspielige Drinks, das zieht die Fliegen an.« Er zerknüllte die Presseerklärung und warf sie in den Papierkorb.
Zwei Tage später gab der neue Premier, Arthur Macalister, die Zusammensetzung seines Ministeriums bekannt; Maskeys Name wurde nicht genannt. Fowler machte sich sofort an die Abfassung einer neuen Presseerklärung, in der er Herbert über den grünen Klee lobte und behauptete, er sei von einer Horde Nichtsnutze vertrieben worden, die nicht einmal einen Hühnerstall in Schuss zu halten wüssten. Wer habe denn diesen sturen schottischen Erbsenzähler zum Premier gewählt, einen Mann, der von nichts eine Ahnung habe und dem die Zustände im Norden gleichgültig seien? Er rief die Bewohner von Rockhampton auf, sich geschlossen aus dem Würgegriff des Südens zu befreien und die Bildung eines neuen Staates zu fordern. Südliche Grenze sollte der Wendekreis sein. Dass Rockhampton in dessen unmittelbarer Nähe Hauptstadt werden sollte, brauchte nicht eigens erwähnt zu werden.
Fowler entdeckte Leon auf der Veranda, wo er mit zwei jungen Damen zusammensaß und gemütlich Tee trank, und winkte ihn zu sich. »Geh ins Hotel und pack deine Sachen. Sofort. Du fährst nach Hause.«
»Warum? Was habe ich denn getan?«
»Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern darum, was du tun wirst. Du kannst das Nachmittagsschiff noch erreichen, es läuft um vier Uhr aus. Ich möchte, dass du der Redaktion unserer Zeitung eine Erklärung aushändigst und ein paar Termine für mich vereinbarst. Ich habe dir alles aufgeschrieben, du kannst die Anweisungen unterwegs durchlesen.«
»Aber ich habe Miss Lynton versprochen, heute Abend mit ihr ins Theater zu gehen.«
»Sie wird sich eben eine andere Begleitung suchen müssen. Dies hier ist wichtiger als zuzusehen, wie jede Menge Schwuchteln auf der Bühne herumhopsen. Jetzt mach schon. Vielleicht kann ich für nächste Woche eine Rückpassage ergattern, wenn nicht, dann eben in zwei Wochen. Du kümmerst dich jedenfalls darum, dass alles weisungsgemäß erledigt wird. Wenn ich nach Hause komme, muss die ganze Stadt wachgerüttelt sein, und in der Quay Street soll mich ein vielköpfiges Empfangskomitee erwarten.«
»Von welchem Schiff soll ich dich abholen?«
»Ich werde telegraphieren.«
Nachdem Leon abgereist war, verließ Fowler frühzeitig das Regierungsgebäude, um eine gewisse Mrs. Betsy Perry in Spring Hill zu besuchen.
»Fowler, du garstiger Schlingel! Ich glaubte schon, du hättest mich vergessen.«
»Du weißt doch, dass das nicht stimmt.« Lächelnd und mit Besitzermiene trat er ein. Immerhin gehörte das Haus ihm. »Die Wahl eines neuen Premiers stand an, aber nachdem das über die Bühne gegangen ist, darf ich mich wohl ein wenig entspannen, meinst du nicht auch?« Übermütig puffte er sie zwischen die vollen Brüste.
»Nicht doch«, kicherte sie. »Erst das Geschäftliche. Die Abrechnung der Mieteinnahmen und die Gästeliste. Es war derart viel Betrieb, dass ich für die Weihnachtsfeiertage noch zusätzlich jemanden einstellen musste.«
Der Flussdampfer keuchte stromaufwärts. Leon zog es vor, in seiner Kabine zu bleiben – auf Deck war es unerträglich heiß. Wie konnte es einen nur nach Rockhampton ziehen, meilenweit weg von der Küste und ihrer ständig frischen Brise? Rockhampton lag am Flussufer, zwischen zwei Bergketten, die das Städtchen im tropischen Sommer in einen Backofen verwandelten. Noch schlimmer war es in der feuchten Jahreszeit. Schon Brisbane war im Sommer heiß genug, in Rockhampton aber, mehr als dreihundert Meilen nördlich und entsprechend näher am Äquator, war es schier nicht auszuhalten.
Leon stellte sich London vor, wo er noch nie gewesen war, malte sich das kühle Wetter dort und ein herrliches Leben aus. Jeder, der etwas auf sich hielt, fuhr nach England – nannte es gar sein Zuhause! –, und genau das würde er eines Tages auch tun, jawohl, das würde er! Er träumte davon, im fernen England ein wundervolles neues Leben zu beginnen und vor der Abreise seinem Vater noch gründlich die Meinung zu sagen, ihm zumindest einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Wenn er nur das nötige Geld hätte!
Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, seiner Mutter telegraphisch seine Rückkehr anzukündigen; hätte er es getan, würde sie ihn abholen, und er wollte seine Freiheit genießen. Das, was er für Fowler zu erledigen hatte, konnte warten.
Eifrige Goldschürfer stießen ihn beiseite, weil sie so schnell wie möglich an Land wollten. Leon sah sie voller Verachtung an. Es war bekannt, dass man sein Leben aufs Spiel setzte, sobald man sich zehn Meilen aus Rockhampton entfernte, und dass die Eingeborenen jeden Fußbreit ihres Landes verteidigten. Zu Recht, wie Leon fand; er hatte durchaus Verständnis für ihr Tun und scherte sich nicht darum, wen sie umbrachten. Ihm war es nur recht, wenn die Schwarzen gewinnen und damit den Untergang dieser elenden Stadt besiegeln würden. Nicht, dass er diese Meinung laut geäußert hätte – man hätte ihn dafür aufgeknüpft, denn die meisten Leute sahen in den Schwarzen nur Tiere, Ungeziefer sogar, von dem es den Bezirk zu säubern galt. Auf wen von diesen rohen Kerlen an Bord wohl ein grauenhafter Tod wartete, überlegte er zynisch.
Als er die Quay Street hinunterging, nickte er dem einen oder anderen Bekannten zu, Viehzüchtern, deren Farmen im Tal des Fitzroy River lagen oder jenseits der Hügel. Von den Schwarzen ließen sich diese Männer nicht einschüchtern; sie bekämpften sie weiterhin, und eines Tages, keine Frage, würden sie endgültig gesiegt haben, auch wenn dafür ein entsprechender Preis zu zahlen war. Die meisten von ihnen und auch ihre Viehtreiber zierten Speernarben; für sie waren es Kriegsverwundungen. In der Bar des Criterion Hotels kam es nicht selten vor, dass Männer, wenn sie dazu aufgefordert wurden, die Hose herunterließen oder sich das Hemd auszogen, um ihre Wundmale zur Schau zu stellen, und dabei stolz verkündeten, wie viele Schwarze – meist Frauen und Kinder – sie getötet hatten. In Brisbane hatte Leon den Leuten klarzumachen versucht, was im Norden wirklich vor sich ging, dass Hunderte von Eingeborenen hingemetzelt wurden. Keiner hatte sich dafür interessiert, höchstens den Spieß umgedreht und gefragt, wie viele Weiße die Schwarzen denn auf dem Gewissen hätten. Aufs Diskutieren verstand sich Leon nicht, und noch weniger gelang es ihm, seine Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass das Land den Aborigines gehörte. Einzig Tyler Kemp hatte ihm zugehört und einen Artikel darüber verfasst, von dessen Veröffentlichung seine Zeitung allerdings absah. Und dann – wie konnte es anders sein – hatte Fowler davon Wind bekommen.
»Was ist bloß in dich gefahren?«, schnauzte er. »Einem Reporter derartige Lügenmärchen aufzutischen!«
»Das sind keine Lügenmärchen.«
»Und ob sie das sind. Wenn die Schwarzen Ärger kriegen wollen, dann kriegen sie ihn. Basta. Und du hältst verdammt noch mal ab sofort deinen Mund. Verstanden?!«
»Ja.«
»Noch nicht trocken hinter den Ohren, aber alles besser wissen wollen! Ich sollte dich eine Zeitlang auf eine Farm abschieben, damit dir die Tatsachen klarwerden. Ich möchte wissen, wie du dich aus der Affäre ziehst, wenn die Schwarzen mit ihren Speeren auf dich losgehen! Diese Farmer sind das Salz der Erde, von ihren Herden hängt die Zukunft Queenslands ab. Ohne uns kann der Süden doch gar nicht existieren – wir hier im Norden rackern uns ab und züchten Vieh, damit sich die in Brisbane auf die faule Haut legen können.«
Leon war erleichtert gewesen, als der Vater auf sein Lieblingsthema kam: der Norden Queenslands gegen den Süden. Fowler Maskey hoffte, eines Tages Premier eines unabhängigen Staates mit Namen Capricornia zu werden. Es war anzunehmen, dass der Vater dieses Ziel auch erreichen würde.
Er betrat das vergleichsweise dunkle Innere des Criterion Hotels und bestellte sich erst einmal ein Bier, um seinen Durst zu löschen, und dann, um die Lebensgeister wieder anzuregen, noch ein Gläschen Rum. Lässig an der Theke lehnend, fiel ihm auf, dass in dem überfüllten Raum mehr Unruhe als sonst herrschte.
»Was ist los?«, fragte er den Barkeeper.
»Die Schwarzen haben die Aberfeld-Farm überfallen. Haben Ken McCraig getötet, und einer seiner Leute, Tommy Pike, der seinem Boss zu Hilfe kommen wollte, wurde so schwer verwundet, dass er tags darauf ebenfalls gestorben ist.«
»Um Himmels willen! Und was ist mit Mrs. McCraig? Sie ist eine Freundin meiner Mutter.«
»Die arme Frau. Sie hat’s überstanden, und die beiden kleinen Mädchen sind auch in Sicherheit. Unterm Bett versteckt hatte sie sie.«
»Sie wird wohl jetzt die Farm aufgeben«, meinte Leon. Aber der Barkeeper schüttelte den Kopf.
»Von wegen. Sie will unbedingt bleiben. Ihr Bruder aus Sidney soll den Betrieb übernehmen.«
Ganz typisch, fand Leon. Wenn diese Sippschaften von Viehzüchtern einmal Land ergattert hatten, konnte sie nichts mehr davon vertreiben. Sein Großvater war genauso gewesen, hatte mit einer Schaffarm angefangen und sich dann auf Rinderzucht verlegt, und seine Farmen zogen sich mittlerweile von Bathurst aus quer durch Queensland. Geleitet wurden sie von Verwaltern; Fowler und Onkel William strichen nur die Gewinne ein. Wie reich sein Vater wohl war? Gut eine Million besaß er bestimmt. Und doch zog er es vor, in diesem elenden Kaff zu bleiben. Macht, ja natürlich. Geld bedeutete Macht, und es lockte Schmarotzer an, die hofften, es würde etwas für sie abfallen.
Captain Cope, besser bekannt als Bobby, hatte Leon entdeckt und kam auf ihn zu. Leon hegte Bobby gegenüber gemischte Gefühle. Bobby war gebildet und ein exzellenter Gesprächspartner, doch unterstand ihm, wie anderen weißen Offizieren auch, eine aus dem Süden stammende, übel beleumundete Eingeborenentruppe der berittenen Polizei, die mit Uniformen, Gewehren und entsprechender Munition ausgerüstet war und deren Order lautete, unter den schwarzen Stammesangehörigen, Aborigines wie sie selbst, »aufzuräumen«, was sie auch gnadenlos taten. Leon hatte sie durch Rockhampton reiten sehen; sie waren ihm nicht wie Soldaten, sondern wie eine Gangsterbande vorgekommen. Selbst unter den Viehtreibern auf den Farmen war der Einsatz einer Eingeborenenpolizei umstritten. Bobby ließ Einwände jedoch nicht gelten. »Sie haben einen Job zu erledigen«, erklärte er Leon, »und sie erledigen ihn. Das ist unangenehm, aber nötig.«
»Es heißt, sie brächten ganze Familien um«, erwiderte Leon.
»Nur in Ausnahmefällen. Wenn man plündernde Dingos ausrotten will, muss man die Jungen gleich mit beseitigen, sonst vermehren sie sich wieder, und das Problem bleibt.«
»Ich finde das abscheulich«, hatte sich Leon entrüstet.
»Ist es auch, Freundchen. Aber das braucht dich doch nicht zu kümmern, oder?«
Bobby stürzte sich begeistert auf Leon. »Schön, dass du wieder da bist. Wie wär’s mit einer Partie Billard vor dem Essen?«
»Gerne«, gab Leon zurück. »Bist du denn nicht im Einsatz?«
»Bloß nichts übereilen. Es sind schon genug Leute unterwegs. Ich breche morgen früh mit meiner Truppe auf, und dann knöpfen wir uns die Mörder vor.«
Oder jeden, dessen Hautfarbe schwarz ist, argwöhnte Leon. Wenn doch nur irgendjemand die Schwarzen vor diesen erst unlängst rekrutierten Truppen warnen würde! Zumindest hätten sie dann eine faire Chance – sofern man Speere gegen Gewehre als fair bezeichnen konnte. Und Cope würde in eine Falle reiten …
Nachdem er dem Herausgeber der Zeitung Fowlers Stellungnahme übergeben hatte, hielt Leon seine Pflicht und Schuldigkeit fürs Erste getan. Morgen würde er darangehen, den Separatisten Dampf zu machen, sobald sie Fowlers Tirade gegen Macalister und das Parlament verdaut hatten.
Schon als er das Haus betrat, hörte er das von Weinkrämpfen begleitete Zetern der Mutter. Wenn sich Hilda Maskey einen ihrer Gefühlsausbrüche leistete, dann sorgte sie dafür, dass alle Welt und sogar der Hund ihn mitbekamen. Eigentlich schade, dass sie sich diese Anfälle in Fowlers Anwesenheit verkniff. Ihr Mann wollte Ruhe und Frieden im Haus, und Hilda hatte gelernt, sich zu fügen.
Leons Ankunft überraschte sie. Erstaunt fuhr sie herum. »Wann bist du angekommen?«
»Gerade eben«, sagte er und warf den Hut auf die Kredenz. »Aber ich weiß bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Mutter.«
»Tut dir leid?«, schrie sie auf und hielt sich am Esszimmertisch fest. »Was hilft das schon? Diesmal ist sie zu weit gegangen. Vater wird außer sich sein! Und mir wird er mal wieder die Schuld geben!«
»Wer ist zu weit gegangen?«, fragte Leon verblüfft.
»Niemand«, kam es von Laura, die lässig in einem Ledersessel hinter der Tür saß. »Mutter ist durchgedreht.«
»So nennst du das?« Die schluchzende Hilda wischte sich mit einem bereits feuchten Taschentuch übers Gesicht. »Was soll ich denn sonst tun, wenn meine Tochter Schande über die Familie bringt? Leon ist eben erst zurück, und auch er weiß es bereits. Die ganze Stadt spricht darüber.«
Leon zog seine Jacke aus und öffnete den Kragen. »In der Stadt spricht man darüber, dass Ken McCraig ermordet wurde. Ich würde gern erfahren, warum du so aufgelöst bist.«
»Ach ja, der arme Ken. Ich habe bereits an Mrs. McCraig geschrieben und sie für eine Weile zu uns eingeladen, aber jetzt bin ich heilfroh, dass sie nicht hier ist.«
»Wieso?« Er sah Laura an, die nur die Schultern zuckte und sich mit der Hand durch das volle blonde Haar fuhr, um ihrem Nacken ein wenig Kühlung zu verschaffen. Leon riss die Fenster auf.
»Nicht doch«, wehrte die Mutter ab. »Das bringt nur die Hitze herein.«
»Ich lasse sie raus«, gab er zurück. »Sieh dir diese Wand an, sie beginnt bereits zu schimmeln. In diesem Klima muss man die Fenster offen halten, sonst fängt es an, muffelig zu riechen. Also, was ist schiefgegangen?«
»Dann weißt du es also noch gar nicht! Gott sei Dank! Es ist besser, wenn du es von mir erfährst. Deine Schwester, dieses schamlose Ding, ist heute zur Murray-Lagune geritten.«
»Du hast was getan?«, rief Leon. »Du bist zum Badegelände geritten?«
»Ja«, sagte Laura trotzig. »Warum denn nicht? Ist doch nur vier Meilen stadtauswärts, und gefährlich war es auch nicht.«
Leon war ebenso entsetzt wie seine Mutter. »Bist du wahnsinnig? Dort haben doch nur Männer Zutritt.«
»Dann sollte es so etwas auch für uns geben. Ich würde so gerne schwimmen gehen und finde es ungerecht, dass wir vor uns hin schwitzen müssen, während sich die Männer in diesem kleinen See erfrischen können.«
»Da siehst du’s!« Hildas Stimme überschlug sich fast. »Keinerlei Schamgefühl. Über ein derartiges Ansinnen solltest du nicht einmal in Gegenwart deines Bruders sprechen.«
»Ich hoffe nur, dass weit und breit kein Mann zu sehen war«, meinte Leon naserümpfend.
»Doch, jede Menge, Leon. Sie hatten viel Spaß daran, ins Wasser und wieder hinaus zu springen. Wie große, fette Frösche.«
»Allmächtiger! Mutter hat recht. Du bist schamlos.«
»Nein, bin ich nicht. Wenn jemand schamlos ist, dann doch wohl eher Männer, die splitternackt herumtollen. Und wenn ich drandenke, dass sie uns das Schwimmen verbieten, wo« – sie lachte – »wir doch weniger zu verbergen haben als sie.«
»Du hast sie belauert!«, rief er. »Wenn dich bloß niemand gesehen hat.«
»Müssen sie wohl«, sagte sie, »sonst hätte es Mutter nicht erfahren.«
»Mrs. Mortimer hat es mir erzählt«, stammelte Hilda. »Sie weiß es von ihrem Mann und fand, ich sollte es wissen.«
»Sie konnte nicht schnell genug hier aufkreuzen«, sagte Laura naseweis. »Hat bestimmt einen neuen Weltrekord aufgestellt.«
Leon konnte es noch immer nicht glauben. »Was ist, wenn mich jemand darauf anspricht? Nicht auszudenken!«
»Du kannst ja sagen, ich sei nicht deine Schwester, sondern nur das Hausmädchen«, schlug Laura vor.
Leon fand das alles andere als komisch. »Ich möchte bloß wissen, wie Vater das aufnimmt.«
»Hab ich ihr auch gesagt«, jammerte Hilda. »Fowler wird einen Tobsuchtsanfall bekommen.«
Fowlers Tobsuchtsanfälle ließen Laura völlig kalt. Bühnenzauber war das, wie seine Reden auch. Glaubten denn die Leute wirklich diesen ganzen Mist, den er ihnen auftischte, als wäre er ein Priester und könnte sie als Einziger vor Hölle und Verdammnis bewahren? In der Morgenzeitung war der Artikel abgedruckt, den Leon gestern überbracht hatte. Er hatte ihn als Pressemitteilung deklariert, aber Cosmo Newgate, der Herausgeber, hatte ihn in der Spalte der Leserbriefe veröffentlicht. Laura wartete beim Frühstück ungeduldig auf Leon, um es ihm zu zeigen. Und dann war er an der Reihe, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen, dieser Maulheld. Warum er niemals wagte, Fowler die Stirn zu bieten, blieb Laura ein Rätsel. Bei der Mutter war es nicht anders. Dabei könnte sie, wenn sie es darauf anlegte, ihrem Mann das Leben verdammt schwermachen und ihn auf Trab bringen; stattdessen stöhnte und seufzte sie in einem fort, gab sich zufrieden mit ihrer Unzufriedenheit, nahm seine Schikanen hin und glaubte, sie gehörten zu ihrem Schicksal als Ehefrau.
Hilda war durchaus einmal glücklich gewesen, damals, als sie auf dem Familienstammsitz in Bathurst gelebt hatten. Dort hatte sie den Trubel der reichen und angesehenen Gesellschaft genossen und sich als hervorragende Gastgeberin etabliert. Fowlers ehrgeizige Pläne jedoch hatten sie ihren Freunden und ihrer Familie entzogen und in dieses entlegene Städtchen in Queensland verschlagen, während sich ihr Mann als Abgeordneter des Wahlkreises und Mitglied des Parlaments schon bald häufiger in Brisbane aufhielt als zu Hause. Ein Segen, fand Laura, obgleich sich die Mutter auch darüber beklagte.
Laura hatte ihre Kindheit auf dem Stammsitz der Familie genossen. Ihr Herz gehörte den Pferden und allen anderen Haustieren, und sie war glücklich, bis man sie nach Sydney ins Internat schickte. Während Leon gerne an seine Schulzeit zurückdachte, war ihre Erinnerung mehr als finster. Die Lehrerinnen reagierten pikiert auf ihre Ausdrucksweise, die sie von den Männern auf dem Hof und in den Schafpferchen übernommen hatte; sie wurde streng bestraft, weil es ihr an Arbeitseifer mangelte und sie sich unhöflich und aufmüpfig aufführte, ein Wildfang, dessen Benehmen nicht geduldet werden konnte. Als sie schließlich ausriss und sich zu ihrem Onkel in Sydney flüchtete, wurde sie vom Unterricht ausgeschlossen. Von der nächsten Schule flog sie, weil sie immer wieder auf eigene Faust den nahe gelegenen Strand aufsuchte. Man verstand einfach nicht, dass Schulmauern für ein Mädchen wie Laura nicht nur »Gefängnis«, sondern auch eine Herausforderung bedeuteten. Angestachelt von ihren Klassenkameradinnen, die es aufregend fanden, eine Rebellin unter sich zu haben, hatte sie sich sogar in die hohen Wellen der Coogee Beach gestürzt – für sie ein unvergessliches Erlebnis: die prickelnde, kristallene Frische der Brandung, die unbeschreibliche Wucht der Brecher …, ein Polizist hatte sie festgenommen, als sie aus dem Wasser kam.
Das war das Ende ihrer Schulzeit. Laura erhielt die Erlaubnis, auf Bondi, dem Gut von Onkel William und seiner verrückten Frau, zu bleiben, obwohl ihr der Vater aus der Ferne die Prügel ihres Lebens androhte. Achtzehn Monate später, als sich die Familie nach Rockhampton einschiffte, war alles vergessen. Laura hatte sich stets nach dem Landleben zurückgesehnt und sich geschworen, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Ihren Freunden erzählte sie, sie wolle einen Schafzüchter heiraten und sich einen Stall voller Pferde halten. Oder aber eine eigene Farm kaufen. Wo doch Onkel William, der seiner Nichte sehr zugetan war, versprochen hatte, sie in seinem Testament zu berücksichtigen. Sollte er tunlichst auch, dachte Laura. Ihr Aufenthalt auf Bondi war der Maskey-Familie sehr gelegen gekommen. Williams Frau, Tante Freda, war anfällig für unschöne »Anwandlungen«, wie ihre Handgreiflichkeiten taktvoll umschrieben wurden. Dann ging sie mit dem Messer auf die Bediensteten los, die trotz aller Überredungskünste Williams bald das Weite suchten, so dass Laura die Rolle der Haushälterin übernahm, schon weil sie es als Einzige verstand, Tante Freda zu beschwichtigen.
»Sie hat Angst«, erklärte Laura. »Das ist alles. Sie sucht Schutz. Sie hört von irgendwoher Stimmen, die ihr einreden, dass man sie umbringen will und dass sie sich verteidigen muss.«
Als die arme Freda schließlich in einer Irrenanstalt landete, benötigte William Lauras Dienste nicht länger. Zumal er, als Freda dann starb, nach London übersiedelte. Nach dieser anstrengenden Zeit auf Bondi fand Laura Rockhampton eigentlich gar nicht so übel. Sie liebte es, die Uferböschungen des tief unter ihr fließenden Fitzroy River entlangzureiten oder im Schatten der Trauerweiden zu sitzen, eins zu werden mit dem sacht wogenden Grün. Manchmal versuchte sie, die Postkartenidylle in ihrem Skizzenbuch festzuhalten, fand aber immer, dass ihre Bemühungen dem großartigen Fluss nicht gerecht wurden.
Das Hausmädchen brachte ein an Leon adressiertes Telegramm, das die Mutter aufriss. »Euer Vater kommt mit dem nächsten Linienschiff nach Hause«, verkündete sie.
Laura runzelte die Stirn. »Du kritisierst ständig an mir herum. Dabei benimmst du dich äußerst ungehörig, wenn du anderer Leute Post öffnest.«
»Ein Telegramm ist keine Post«, gab Hilda zurück. »Außerdem ist es von deinem Vater.«
»Aber das wusstest du doch erst, nachdem du es geöffnet hattest.«
»Ich wäre dir dankbar, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern würdest. An deiner Stelle würde ich lieber über mein eigenes Benehmen nachdenken. Glaub nur nicht, dass dein Vater nichts von deiner neuesten Eskapade erfährt.«
»Bestimmt wird er das«, sagte Laura sarkastisch. Sie zerteilte gekonnt eine saftige Mango, löste ein Segment heraus und saugte das süße Fruchtfleisch aus der Haut. Damit herauszurücken, dass Amelia, die Tochter von Boyd Roberts, einer der führenden Persönlichkeiten der Stadt, sie dazu angestachelt hatte, war wohl nicht ratsam.
Sie grinste in sich hinein. Amelia! Alle lobten sie in den höchsten Tönen! Wie entzückend sie stets aussähe in ihren rosa oder blauen Kleidern, den ausgefallenen Hüten und mit ihren aufgesteckten schwarzen Locken, die das Gesicht einrahmten! Dabei war Amelia hinter ihrer hübschen Fassade ein richtiger Teufel und durchtriebener als ein Affe auf der Stange, ohne sich allerdings jemals erwischen zu lassen. Heimtückisch konnte sie sein und, wie Laura hin und wieder fand, geradezu niederträchtig. Sie belauschte jeden, der ihr großes, luftiges Haus hoch oben auf dem Berg betrat, und gab dann alles brühwarm an Laura weiter. Wenn die beiden Mädchen nachmittags sittsam mit Amelias Vater und dessen Freunden zusammensaßen, kam es zuweilen vor, dass Laura mit einem Mal Alkohol, für gewöhnlich Cognac, in ihrem Kaffee schmeckte, den sie, von Amelia scheinheilig beäugt, ohne eine Miene zu verziehen trinken musste, weil sie wusste, dass auch die Freundin Alkohol in ihrer Tasse hatte.
Mr. Roberts war ein großer, gutaussehender Mann Ende vierzig, mit dunklem, an den Schläfen ergrauendem Haar und einem schmalen Schnurrbart. Nach seinem Abschied vom Regiment hatte er auf einer Reise in den Norden auf spektakuläre Weise sein Glück gefunden – Boyd Roberts war, wie es hieß, einer der ersten Goldschürfer, der in Canoona einen Volltreffer gelandet hatte und mit prallen Satteltaschen in Rockhampton einritt. Kein Wunder, wenn man ihn angesichts seines wachsenden Wohlstands – mittlerweile gehörten ihm zwei Minen – mit dem legendären König Midas verglich. Seine Frau dagegen war nicht vom Glück begünstigt und vor einigen Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.
Roberts hatte sich ein Haus auf dem Berg über der Stadt gebaut und ausreichend Personal eingestellt, um sein Töchterchen Amelia, für das ihm nichts zu teuer war, umsorgen zu lassen. Laura hielt Amelias Ansprüche für eher bescheiden. Sie machte sich nichts aus Reisen, aus dem, was in der großen, weiten Welt vor sich ging; sie interessierte sich ausschließlich für Kleider und kostbaren Schmuck, womit sie der Vater auch reichlich verwöhnte – Dinge, die ihr bei der Ausführung ihres Plans, sich den richtigen Ehemann zu angeln, halfen. Mit achtzehn wusste sie genau, was sie wollte: heiraten und bis in alle Ewigkeit in diesem Haus, das sie Beauview getauft hatte, zusammen mit ihrem Vater leben.
Unentwegt wurden Mr. Roberts heiratswillige junge Damen zugeführt, die Amelia als Bedrohung empfand, so dass ihnen bei ihren Besuchen regelmäßig die erstaunlichsten Dinge zustießen: Ihre Handschuhe verschwanden, oder sie hatten mit einem plötzlich auseinanderbrechenden Rohrstuhl zu kämpfen, oder eine Maus verfing sich in ihrem Rock. Spitzfindiger war dagegen Amelias Art, den Besucherinnen Komplimente zu machen. Sie ließ sich lang und breit über ihre Kleider aus, ihre Frisuren, ihren Schmuck, brachte nervöse junge Frauen dazu, ausschließlich von sich und ihrer Garderobe zu sprechen, wohl wissend, wie sehr den Vater diese Art der Unterhaltung langweilte. Für wild entschlossene Witwen wie auch für zartbesaitete ledige Damen konnte ein Besuch in Beauview wahrhaftig zu einem Desaster werden – und Amelia zog dabei die Fäden, ohne dass der liebenswürdige und charmante Boyd Roberts das jemals zu bemerken schien.
Endlich erschien Leon zum Frühstück, in seinem weißen Rüschenhemd und sandfarbenen Kniehosen wie aus dem Ei gepellt. Er entdeckte sofort das Telegramm auf dem Tisch. »Von Vater?«
»Ja, mein Schatz«, sagte Hilda. »Er kommt mit dem nächsten Schiff.«
Leon nickte lässig. »Ich muss den Empfang für ihn vorbereiten. Ihr beide kommt natürlich auch.«
»Natürlich«, lächelte Hilda.
»Vaters Leserbrief ist abgedruckt worden«, sagte Laura unschuldig.
»Was denn für ein Leserbrief?« Leon griff bereits nach der Zeitung, fand, was er suchte, und ließ sich auf den Stuhl fallen. »Mein Gott! Das wird er mir in die Schuhe schieben«, sagte er niedergeschlagen.
»Warum denn, mein Schatz?«, fragte Hilda. »Was macht das schon aus? Solange er seine Meinung zum Ausdruck bringen kann …«
»Das macht sehr viel aus. Jeder Idiot kann einen Leserbrief schreiben. Eine Stellungnahme von Cosmo würde im Nachrichtenteil abgedruckt und nicht ganz hinten versteckt. Das gäbe seinen Argumenten zusätzlich Nachdruck.«
»Du glaubst also, Cosmo ist gegen einen neuen Staat im Norden?«
»Er hält sich mit seiner Meinung noch zurück. Fest steht nur, dass er mit Vater als Premier nicht einverstanden ist.«
»Wen will er dann?«, fragte Hilda. »Wo doch dein Vater so viel Erfahrung hat. Kein anderer kann es mit ihm aufnehmen.«
»Ausgenommen Mr. Roberts«, warf Laura ein.
»Roberts?« Leon war verblüfft. »Der interessiert sich doch gar nicht für Innenpolitik.«
»Tut er wohl.« Laura schmunzelte. »Das weiß ich von Amelia.«
Hilda setzte klirrend ihre Teetasse ab. »Hat man Worte! Reicht es nicht, wenn wir einen derart gefährlichen Kerl in unserer Stadt dulden müssen? Muss er jetzt auch noch mit dem Parlament liebäugeln?«
»Mutter!«, fiel ihr Laura ins Wort. »Ich weiß nicht, wer dir solche Geschichten erzählt. Mr. Roberts ist nicht gefährlich. Er ist, ganz im Gegenteil, ausgesprochen nett.«
»Was weißt du denn schon?«, sagte Leon. »Dieser Mann hat draußen auf den Goldfeldern einen schlechten Ruf. Er soll sich die ersten Claims in Canoona widerrechtlich angeeignet haben, die Starlight-Mine gehört angeblich einem alten Schotten, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist.«
»Warum hat man ihn dann nicht vor Gericht gestellt?«, begehrte Laura auf.
»Weil keiner bereit war, sich mit Roberts und seinen Handlangern auseinanderzusetzen. Bis heute nicht.«
»Ich glaube dir nicht. Außerdem beschäftigt er Grubenarbeiter und keine Handlanger.«
»Geh lieber nicht mehr in sein Haus«, warnte Hilda Laura. »Deinem Vater ist das bestimmt nicht recht. Zudem habe ich gehört, dass er sich seinen Geliebten gegenüber ziemlich ungebührlich verhält.«
»Tut er nicht! Amelia passt schon auf! Jede Geliebte, wie du sie nennst, wäre froh, wenn sie zehn Minuten durchhielte.«
»Ach ja?«, meinte Leon interessiert, aber Laura wollte aus Loyalität zu ihrer Freundin nicht näher auf das Thema eingehen.
Sommerregen hatte kurz vor Fowlers Rückkehr die Stadt unter Wasser gesetzt, so dass Leon ihn alleine an der Anlegestelle abholte. Verärgert griff er nach dem Schirm, den Leon ihm reichte. »Wo ist deine Mutter?«
»Im Criterion, zusammen mit Laura. Im Hotel findet ein Empfang für dich statt, aber sehr viel Leute sind nicht gekommen.«
»Diese Angsthasen! Nur wegen ein paar Regentropfen!«
»Nicht deswegen. Sie feiern in der Kneipe unten an der Straße. Sie sind auf eine weitere Goldader gestoßen, offenbar auf eine dicke, im Crocodile Creek.«
Obwohl Fowler sich das merkte und darin einen neuerlichen Beweis für die politische Schwäche des Südens sah – der reiche Norden überflügelte mit seinen Steuern den Süden –, tat dies seinem Unmut keinen Abbruch. Er stürmte in den Speisesaal des Hotels, wo auf weißgedeckten Tischen ein kleiner Imbiss wartete, auf der einen Seite ein kaltes Büfett und auf der anderen Seite Getränke. Dazwischen nicht mehr als ein Dutzend Leute, die eher schuldbewusst herumstanden.
Seine Frau kam auf ihn zu und küsste ihn. »Willkommen daheim, mein Lieber. Wie war es in Brisbane?«
Fowler beachtete sie nicht. »Ist das alles?«, zischelte er Leon zu. Für gewöhnlich erschienen mindestens hundert Leute zu seinen Versammlungen. Gold hin, Gold her, Leon hätte sich mehr ins Zeug legen müssen. »Mit dem, was hier aufgefahren ist, könnte man eine ganze Armee satt kriegen«, sagte er und zog Leon beiseite. »Du machst mich nur lächerlich. Geh schon und sorg für mehr Publikum.«
»Wo soll ich das denn herkriegen?«
»Ist mir völlig egal. Aus der Bar! Von der Straße! Schau nach, wer sich im Hotel aufhält. Bring sie hier rein!«
Fowler zwang sich zu einem professionellen Lächeln und begrüßte die wenigen Getreuen einzeln. »Umso mehr bleibt für uns«, scherzte er und nahm sich einen Whisky. »Also dann, greift tüchtig zu. Es ist genug da! Ich sag euch was, Leute, es ist schön, wieder zu Hause zu sein.« Er schüttelte Hände, sprach zwei Damen seine Hochachtung dafür aus, den Elementen getrotzt zu haben, und bemühte sich, nicht wie gebannt zur Tür zu starren, als eine seltsame Mischung Fremder in den Raum drängte.
»Sieht aus, als müsstest du ihnen das nächste Mal was Ausgefalleneres bieten«, meinte Laura, die neben ihm stand.
»Was meinst du mit ›was Ausgefalleneres‹?«
»Ich weiß nicht. Wenn es um Konkurrenz geht, reicht eben eine kostenlose Abspeisung nicht, um sie in deine Versammlungen zu locken. Wirklichen Hunger leidet hier niemand.«
Mit dem Ausgefallenen hatte sie durchaus recht; auch diesen zarten Hinweis merkte Fowler sich. Aber Konkurrenz? »Was für Konkurrenz?«
»Mr. Roberts tritt bei den nächsten Wahlen gegen dich an.«
Diese Nachricht traf Fowler völlig unvorbereitet, aber er war gut im Pokern. »Na und?«, sagte er. »Als Abgeordneter von Rockhampton dürfte es für mich nicht schwer sein, den Sitz für Queensland oder Capricornia zu beanspruchen.«
»Capricornia? Soll so der neue Staat heißen?«
»Bietet sich doch geradezu an. Rockhampton liegt am Wendekreis des Steinbocks, lateinisch capricornus.« Er hatte sich auf ein Gespräch mit seiner Tochter nur eingelassen, um die Zeit zu überbrücken; jetzt, da man sich an der Tür drängte, begab er sich dorthin, um die Neuankömmlinge zu begrüßen.