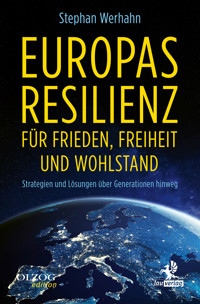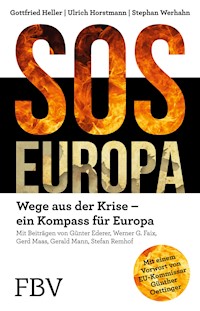
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europa steht mal wieder – wie so oft in der Geschichte – am Scheideweg: Die einen wollen ein zentralistisches kopflastiges Europa, die anderen präferieren eine föderale Union von weiterhin selbstständigen Nationalstaaten, Regionen und Kommunen. Doch nicht nur der Streit über die zukünftige Ausrichtung Europas droht das große Friedensprojekt zu zerstören. Terrorangriffe, Flüchtlingskrise, wirtschaftlicher Niedergang und eine Zentralbank, die Amok läuft – selten fand sich Europa mit so vielen Baustellen konfrontiert. Die Politik scheint unfähig, die dringend notwendigen Reformen anzupacken, stattdessen investiert sie wertvolle Ressourcen in bloßen Machterhalt oder teure Wahlgeschenke. Doch wie kann Europa gegenüber der globalen Konkurrenz künftig bestehen? Wie können die inneren und äußeren Spannungen, die Europa bedrohen, abgebaut werden? Wie entfesselt man Europa, um die digitale Revolution zu bestehen? Und was können die Bürger dafür tun? Gottfried Heller, Ulrich Horstmann und Stephan Werhahn zeigen Wege aus der Krise hin zu einem neuen Europa, das den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2016
© 2016 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Veit Ladstetter
Korrektorat: Hella Neukötter
Umschlaggestaltung: Laura Osswald, München
Umschlagabbildung: Shutterstock/Urheberrecht: Ridvan EFE; Shutterstock/Urheberrecht: fluke samed
Satz: Carsten Klein, München
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-89879-984-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86248-911-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86248-912-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Über dieses Buch
Vorwort von Günther Oettinger
Europa erneuern mit einem klaren ordnungspolitischen Kompass – Plädoyer für eine föderale Union zur Sicherung von Freiheit und Demokratie. Den Euro-Albtraum beenden – Europa entfesseln
Großbritannien und Frankreich wollten die Wiedervereinigung verhindern
Frankreich setzte sich gegen Deutschland durch
Die Besetzung der wichtigsten Posten der EZB
Die Grundprinzipien der Währungsunion wurden verraten
Italien will geldpolitische Manipulationen statt Reformen
Hätte man nur auf Ludwig Erhard gehört …
Großbritannien ist für die EU unverzichtbar
Die Flüchtlingskrise zeigt das wahre Gesicht der EU
Währungsverbünde von souveränen Einzelstaaten scheitern
Ein Exit aus dem Euro muss möglich sein
Europa braucht eine »Entfesselung des Gulliver«
Neue Wachstumsdynamik durch ein »entfesseltes« Europa
Neue Arbeitsplätze schaffen
Europa der Marktwirtschaften – Hat die Ordnungspolitik eine Chance?
Erneuerung des Föderalismus und der Geldverfassung
Europa und den Euro mit Marktwirtschaft aus der Krise führen
Die Eurokrise verstehen – eine dramatische Entwicklung
Grundsatzprogramm zur dauerhaften Bewältigung der Krise
Europa ist mehr als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft
Wertefundierung aus deutscher Perspektive
Europa braucht eine Wertefundierung
Der Irrweg des Kollektivismus
Zu früh gefreut
Zwei Trends
Gründe für diese Trends
Christliches Fundament
Subsidiarität
Echte Solidarität
Dazu als Erklärungsansatz zwei Thesen
Folgen des Kollektivismus
Interventionistische Geldpolitik
Freiheit statt Kapitalismus?
Schon Erhard warnte
Generelle Aspekte einer europäischen Verfassung
Mut zur Führung, wie Konrad Adenauer es vormachte
Ein starkes Europa ist die beste Medizin
Ungelöste Probleme
Neue geopolitische Herausforderungen erfordern eine enge Kooperation – Plädoyer für eine gesamteuropäische Immigrations- und Sicherheitspolitik. Der Alleingang der Angela Merkel und der Krieg im Nahen Osten
Für eine neue Sicherheitsstruktur in Europa
Historische Parallelen
Was ist jetzt konkret für eine neue Sicherheitsstruktur in Europa zu tun?
Geschichtsbewusst agieren und bessere Zukunftsentscheidungen ermöglichen!
Fachkräfte sichern mit gezielter Einwanderung, Qualifizierung und Integration
Auf dem Weg ins europäische Dorf! Chancen für junge hochqualifizierte Menschen auf dem europäischen Arbeitsmarkt
Neue Chancen in einem »Europa der Marktwirtschaften«. Plädoyer für eine sektorale Erneuerung. Geldflutung und fragwürdige Bonitätsratings in Europa: Die Lenkungsfunktion der Märkte wieder ermöglichen
Ein Wertekompass für europäische Banken – Ethik und Regulierung wieder in Einklang bringen
»Europa erneuern« erfordert die Überwindung nationaler Infrastrukturschranken
Private Straßenfinanzierung ist in Deutschland noch ungewöhnlich
Das inländische Bahnmonopol verfestigt sich wieder
Die inländische Energiewende ist nicht europakonform
Was ist zwischenzeitlich passiert?
Die Energiewende ist nicht europakonform
Energiebranche als »Digitalisierungsvorreiter«?
Was jetzt zu tun ist
Chancen durch die Digitalisierung in Europa
Was sollte die »Digitalmacht Europa« tun?
»Kreative Zerstörung« zulassen bei fairen ordnungspolitischen Regeln
Sektorale Aspekte einer europäischen Verfassung
Zuständigkeitsbereiche der Union und der Mitgliedstaaten nach dem Vertrag von Lissabon 2007
Europa erneuern mit Ludwig Erhards zeitlosen Grundsätzen. Die Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards sichert unternehmerische Innovationen
Moral statt sozial – Europa mit Maß und Ziel
Soziale Gerechtigkeit
Moral statt sozial
Bürgertum
Ordnung
Freiheit
Tatkraft
Solidarität
Anstand
Bürgerbewegung
Epilog
Schlussappell
Anhang
Eine föderale Struktur für Europa
Rede von Papst Franziskus vor dem Europaparlament in Straßburg am 25.11.2014
Plädoyer für ein konföderales Europa
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Die Autoren des Buchs
Günter Ederer
Werner G. Faix
Gottfried Heller
Dr. Ulrich Horstmann
Gerd Maas
Prof. Dr. Gerald Mann
Günther Oettinger
Dr. Stefan Remhof
Stephan Werhahn, Ph. D., M. Sc.
Ausgewählte Literatur und Quellenangaben
Anmerkungen
Der Jugend in Europa gewidmet,
der nächsten Generation europäischer Bürger,
für Freiheit, Demokratie und Wohlstand
»Es wäre aus meiner Sicht wenig glücklich, wenn wir die Welt wieder in sog. ›Großräume‹ aufspalten wollten, die in sich selbst Genüge zu finden versuchten. Das würde die Spannungen selbst innerhalb der freien Welt noch verstärken. Eine Vielzahl von Nationalstaaten mag im Widerstreit der Interessen zu Reibungen, zu Spannungen und, wie wir erfahren haben, selbst zu kriegerischen Verwicklungen führen. Aber je mehr größere wirtschaftliche und politische Räume mit Machtanspruch auftreten, umso gefährlicher werden zwangsläufig die Gegensätze, wenn auch nicht von Anfang an der Wille zur Verständigung, zur Versöhnung und zur Zusammenarbeit lebendig ist. […]
Wehe dem, der glaubte, man könnte Europa etwa zentralstaatlich zusammenfassen, oder man könnte es unter eine mehr oder minder ausgeprägte zentrale Gewalt stellen. Nein – dieses Europa hat seinen Wert auch für die übrige Welt gerade in seiner Buntheit, in der Mannigfaltigkeit und Differenziertheit des Lebens.«1
Über dieses Buch
Dieses Buch »SOS Europa: Wege aus der Krise – Ein Kompass für Europa« will den Leser aufrütteln und zugleich Mut machen: Terrorangriffe wie in Paris bedrohen das friedliche Zusammenleben elementar. Das stellt auch Europa und die Zusammenarbeit der Einzelstaaten vor ganz neue Herausforderungen.
Andere schlechte Nachrichten traten durch die Terroranschläge vorübergehend in den Hintergrund, so die ausufernden Rettungsprogramme, Staatsanleihenkäufe der EZB, die Risiken durch die Bankenunion, die anhaltend geringe Solidarität in der Flüchtlingskrise und die Rechtsverletzungen der Währungspolitik, auch zwischen Einzelstaaten. Sie verunsichern ebenfalls nach wie vor. Auch wir Autoren sind voller Sorgen.
Aber es gibt auch Ansätze und Konzepte, die Mut machen. Das ist die Leitidee für ein Institut wie das »Institut Europa der Marktwirtschaften«, welches an den aktuellen politischen Themen teilnimmt und den Diskurs mit klarem demokratischen und rechtsstaatlichem Kompass verfolgt.
Europa steht mal wieder – wie so oft in der Geschichte – am Scheideweg: Wollen wir ein zentralistisches kopflastiges Europa – bislang ohne einen Verfassungsauftrag – oder eine föderale, subsidiäre Union von weiterhin teilselbstständigen Nationalstaaten, Regionen und Kommunen mit klaren Zuständigkeiten?
Unseres Erachtens ist Europa nicht nur eine Ansammlung von Problemen, sondern – bei richtigen Maßnahmen und Schritten – auch die große historische Chance und Vision. Die aktuellen Diskussionen verstellen den Blick auf die historischen Wurzeln Europas, sich bietende Lösungsmöglichkeiten und langfristige Chancen. Die Demokratie, die angesichts vermeintlich alternativloser Entscheidungen zur Euro-Rettung in den Hintergrund trat, und die freiheitssichernde Ordnungspolitik mit einer föderalen Ausrichtung sind neu zu entdecken.
Viele Fragen werden angegangen, z. B.: Welche ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und Verfassungsstrukturen braucht Europa? Wie kann der Wettbewerb in Europa wieder verbessert werden? Besteht überhaupt der Wille zu einer wettbewerbsfreundlichen und föderalen Gestaltung Europas? Wie kann Europa gegenüber der globalen Konkurrenz künftig bestehen? Wie können die inneren und äußeren Spannungen, die Europa bedrohen, abgebaut werden? Wie entfesselt man Europa, um die digitale Revolution zu bestehen? Macht Europa seine »Hausaufgaben«? Was können die Bürger dafür tun?
Chancen liegen unseres Erachtens in einer europäischen Politik der Marktwirtschaften, die längst zu einem freizügigen und offenen Binnenmarkt mit klaren Wettbewerbsregeln und Rahmenbedingungen mit einer nachhaltigen globalen Verantwortung hätte werden können.
Wir möchten mit diesem Buch für eine subsidiäre und marktkonforme Gestaltung Europas werben. Dies sichert auch Freiheit und Demokratie – im Sinne der europäischen Gründungsväter Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi und Robert Schuman sowie von Ludwig Erhard. Ein so verstandenes Europa bietet u. E. enorme Möglichkeiten, vor allem für die Jugend, die nächste Generation europäischer Bürger.
München, im Mai 2016
Gottfried Heller, Ulrich Horstmann und Stephan Werhahn
mit Günter Ederer, Werner G. Faix, Gerd Maas, Gerald Mann
und Stefan Remhof
Vorwort von Günther Oettinger
Die Europäische Union als Friedensunion und Wertegemeinschaft ist nach wie vor ein Vorbild für viele andere Regionen in der Welt. Ein Vorbild für Befriedung durch Verrechtlichung und politische Integration auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer und rechtsstaatlicher Werte. Gleichzeitig kann die Europäische Union ihre Rolle in der Welt nur dann kraftvoll ausüben, wenn sie selbst wirtschaftlich stark bleibt. Die Kraft des Wirtschaftsmodells, das nach den Verträgen dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft folgt, muss im Zeitalter der Digitalisierung der globalisierten Wirtschaft jeden Tag neu errungen werden. Außerdem müssen wir heute bereits die Weichen stellen, damit Europa morgen und übermorgen in der Lage ist, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.
Die Welt durchläuft mit der Digitalisierung eine gesellschaftliche und industrielle Revolution. Europa darf die Chancen dieser Revolution nicht verschlafen. Zu viel steht auf dem Spiel. Denn die Digitalisierung birgt für Deutschland und Europa vielfältige Möglichkeiten, da wir über eine exzellente industrielle Basis verfügen. Es gilt heute, mit diesen Pfunden im internationalen Wettbewerb zu wuchern und sicherzustellen, dass wir durch beherzte Fortschritte in Europa im Bereich »Industrie 4.0« im Bereich von Informations- und Datensicherheit und auch im Bereich von Cloud Computing den Investitionsstandort Europa stärken. Ziel muss sein, Wertschöpfungsketten und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa zu erhalten und zukunftsfähig zu machen.
So wie der Erfolg des Binnenmarkts für Güter die Friedensunion, die Wertegemeinschaft und die Soziale Marktwirtschaft in der Vergangenheit wirtschaftlich beflügelt und getragen hat, so benötigen wir heute einen digitalen Binnenmarkt in Europa. Nur so kann Europa in der Zukunft sein Sozialmodell erhalten und seine Erfahrungen als Friedensunion und Wertegemeinschaft stark und glaubwürdig in die Welt tragen.
Europa erneuern mit einem klaren ordnungspolitischen Kompass – Plädoyer für eine föderale Union zur Sicherung von Freiheit und Demokratie. Den Euro-Albtraum beenden – Europa entfesseln
(Gottfried Heller)
Im Zentrum des Europrojekts standen große Erwartungen an die europäische Wirtschaft, die dynamisch wachsen und mehr Jobs schaffen sollte. Dieser Anspruch wird durch die Schlusserklärung der Lissabon-Agenda großspurig auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am 22. und 23. März 2000 formuliert:
»Die Union hat sich heute ein neues strategisches Ziel für das kommende Jahrzehnt gesetzt: das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen – einen Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren Zusammenhalt zu erzielen.«2
Diese nicht nur aus heutiger Sicht vermessen klingende Lissabon-Agenda sollte der Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum dienen und war als flankierende Ergänzung zum Euro gedacht, die ihre Wirkung zusammen mit der Gemeinschaftswährung entfalten sollte. Es herrschte Aufbruchstimmung: Der alte Kontinent sollte mit neuem Leben erfüllt und in Schwung gebracht werden.
Der Enthusiasmus war auch über den ganzen Kontinent hinweg hörbar, als am 1. Januar 2002 zur Einführung des Euro-Bargelds die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit dem Text von Schillers Gedicht »An die Freude« intoniert wurde. Diese soll als Europa-Hymne ein Symbol für die gemeinsamen Werte und die »Einheit in Vielfalt« sein.
Was ist aus dem Überschwang der Gefühle geworden?
Von 2000–2010, also während der Laufzeit der Lissabon-Strategie, brachte China ein astronomisches Wirtschaftswachstum von real 171 Prozent zustande. Die Wirtschaft der Welt wuchs im Durchschnitt um 47 Prozent, in Osteuropa um 45 Prozent, in Lateinamerika um 39 Prozent. Weit abgeschlagen wegen der schweren Immobilienkrise die Wirtschaft der USA mit einem Wachstum von 18 Prozent, danach die der EU mit 17 Prozent – und als einsames Schlusslicht die der Eurozone mit lediglich 12 Prozent. Selten lagen Wunsch und Wirklichkeit weiter auseinander, als es in Europa unter dem Euro der Fall ist.
Und wie steht es mit mehr und besseren Arbeitsplätzen?
In den Mittelmeerländern herrscht Massenarbeitslosigkeit. Im Dezember 2015 waren 24,5 Prozent der Griechen arbeitslos, in Spanien waren es 21 Prozent, in Portugal 12 Prozent und in Italien 11,5 Prozent. Noch schrecklicher sieht es bei der Jugendarbeitslosigkeit aus: Mit 49 Prozent ist in Griechenland fast die Hälfte aller Jugendlichen arbeitslos; ähnlich schlimm ist es in Spanien mit 46 Prozent, in Italien mit 38 Prozent und in Portugal mit 31 Prozent. Es ist eine Katastrophe: eine verlorene Jugendgeneration!
Die von der Politik erhoffte Aufbruchstimmung von 2000 hat sich ins Gegenteil – in eine Abbruchstimmung – verkehrt. Der Euro hat unendlich viel menschliches Leid und wirtschaftliches Unheil gebracht.
Großbritannien und Frankreich wollten die Wiedervereinigung verhindern
Um eine Antwort auf die Gründe für diese eklatante Fehlentwicklung zu finden, muss man um 25 Jahre zurückblicken und untersuchen, wie alles mit der Wiedervereinigung Deutschlands begann.
Als sie im Jahr 1989 in greifbare Nähe rückte, war dies weder für den französischen Staatspräsidenten FranÇois Mitterrand noch für die britische Premierministerin Margaret Thatcher ein Anlass zur Freude. Mitterrand flog sogar in die Sowjetunion zu Staatspräsident Gorbatschow, um die Wiedervereinigung zu verhindern. Wäre da nicht der US-Präsident George H. W. Bush Sr. gewesen, hätten die »eiserne Lady« Thatcher und Mitterrand die deutsche Wiedervereinigung am liebsten verhindert. Thatcher lenkte schließlich ein mit den Worten:
»Wir müssen uns an die Vorstellung gewöhnen, dass es in Europa künftig ein Land geben wird, das stärker ist als alle anderen.«3
Für die Briten schied der Beitritt zu einer europäischen Währungsunion jedenfalls auf unabsehbare Zeit aus.
Ironie der Geschichte: Ausgerechnet Margaret Thatcher, die uns Deutschen nicht besonders gewogen war, sagte:
»Wenn ich Deutsche wäre, würde ich die Bundesbank und die D-Mark auf alle Fälle behalten.«4
Hätten die deutschen Politiker diesen wertvollen Rat bloß befolgt, dann wäre uns das heutige Schlamassel erspart geblieben.
Die französische Folgerung war genau umgekehrt. Frankreich setzte voll und ganz auf Europa, aber mit der Absicht, das erstarkende Deutschland politisch stärker einzubinden und den deutschen Schaffensdrang zu bändigen. Das Mittel dazu war, die D-Mark abzuschaffen und die in Europa dominierende Bundesbank zu entmachten. An deren Stelle sollte eine Gemeinschaftswährung und eine europäische Zentralbank gesetzt werden, die dem direkten Einfluss der Deutschen entzogen war. Welche Bedeutung Frankreich der mächtigen Bundesbank beimaß, zeigte sich daran, dass Mitterrand die D-Mark als »Force de Frappe« der Deutschen, also als deutsche »Atomwaffe«5 bezeichnet hatte.
Es war für Frankreich zutiefst demütigend – ein Prestigeverlust –, wenn es wiederholt gezwungen war, den Franc gegenüber der D-Mark abzuwerten. Allein während Mitterrands Regentschaft geschah das zwei Mal.
Aber auch Kanzler Kohl lag daran, durch eine Einbindung und Verankerung Deutschlands in Europa alte Ängste der Nachbarländer zu dämpfen. Sein Traum war die Europäische Union – ein Bundesstaat –, eine romantische Vision, die niemand sonst mit ihm teilte. Kohl begründete die Einführung des Euro im Bundestag mit folgenden Worten:
»Der Euro stärkt die Europäische Union als Garanten für Frieden und Freiheit. [...] Von der heutigen Entscheidung [...] hängt es wesentlich ab, ob künftige Generationen in Frieden und Freiheit, in sozialer Stabilität und auch in Wohlstand leben können.«6
Frankreich setzte sich gegen Deutschland durch
Beim EG-Gipfeltreffen in Maastricht vom 9.–11. Dezember 1991 hatte Kohl einem Zeitplan zugestimmt, den Mitterrand und der italienische Ministerpräsident Andreotti zu nächtlicher Stunde ausgeheckt hatten, nämlich der Bildung einer »Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion« (EWWU). Sie sollte spätestens im Jahr 1999 ihre Arbeit aufnehmen. Auf Kohls Anliegen, verbindliche, vertragliche Regelungen zu einer politischen Union festzulegen, gingen sie gar nicht ein. So musste Kohl sich mit der bloßen Einführung des Euro zufriedengeben.
Daher brüstete sich Mitterrand vor einer Gruppe von Kriegsveteranen mit den Worten, der Maastrichter Vertrag sei für Frankreich besser als der Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg! (Dieser Vertrag war einer der wesentlichen Gründe, die letztlich zum Zweiten Weltkrieg führten.)
Über die politische Union gab es mit Frankreich keinen Konsens, damals nicht und heute auch nicht. Präsident Chirac sagte bei der Einführung des Euro später sogar:
»Ich werde nicht akzeptieren, dass Europa sich in einen Superstaat verwandelt oder dass es seine Institutionen nach denen der Vereinigten Staaten formt.«7
Es hat sich seit dem französischen Präsidenten De Gaulle an der französischen Außenpolitik nichts geändert: Der sprach nie von einem Bundesstaat, sondern von einem »Europa der Vaterländer«, einem lockeren Staatenverbund.
Das Motiv Frankreichs für die Beseitigung der D-Mark und die Einführung der Gemeinschaftswährung war schon seit De Gaulle, dass Deutschland nur eine »herausgehobene Junioren-Rolle« zukomme. Deutschland sollte zwar mächtiger sein als die anderen Staaten des europäischen Festlands, aber weniger mächtig als Frankreich. Als »Grande Nation« erhebt Frankreich den Anspruch der politischen Führerschaft. Daher muss es Deutschland überragen. Um das zu schaffen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Man versucht, durch eigene Leistung an die Spitze zu kommen. Das ist mühsam und anstrengend. OderMan bändigt den, der oben ist. Letzteres ist weit weniger mühsam, weil es nicht durch Anstrengung, sondern durch politische Schachzüge erreicht werden kann.Daher ist es nur die halbe Wahrheit, wenn man sagt, der Euro sei ein politisches Projekt. Die ganze Wahrheit lautet: Der Euro ist ein politisches französisches Projekt zum Zwecke der Bändigung des teutonischen Tatendrangs.
Nehmen wir als Beispiel den Maastricht-Vertrag: Die Franzosen haben alle Verträge, die auf dem Papier durchweg die deutsche Handschrift trugen, brav unterschrieben:
Kein Land haftet für die Schulden anderer Länder (No-Bailout-Klausel).Die Europäische Zentralbank (EZB) ist politisch unabhängig, und ihre Statuten entsprechen den strengen Regeln der Deutschen Bundesbank. Um die Bedenken der Deutschen, die mehrheitlich gegen den Euro waren, zu zerstreuen, siedelte man die EZB in Frankfurt an.Das Budgetdefizit eines Landes darf 3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung nicht übersteigen (eine Art Schuldenbremse). Seine Gesamtverschuldung darf 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts nicht übertreffen.Danach sorgt man dafür, dass alle Südländer mit ins Boot kommen, auch unter Missachtung der Eintrittskriterien.
Bei der Frage, welche Länder der Währungsunion bei der Gründung angehören sollten, bestand Frankreich auf einem Sondergipfel der EU im Mai 1998 daher darauf, dass neben Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und den Niederlanden auch Portugal und Spanien dabei sein müssten. Noch krasser war die Forderung des französischen Präsidenten Chirac, dass auch Italien mit einer Staatsschuldenquote von 120 Prozent und Belgien mit 130 Prozent, die die vorgegebene Höchstgrenze von 60 Prozent somit um das Doppelte übertrafen, gleich von Anfang an mit aufgenommen werden müssten. Frankreich, als eines der romanischen Länder, hatte ein starkes Interesse daran, weil es in den südlichen Nachbarländern natürlich Verbündete sah, und drängelte gemeinsam mit den Südländern, bis die Regierung Kohl nachgab.
Der Schulterschluss mit Frankreich war für Kanzler Kohl, ungeachtet deutscher Interessen, ebenso wie die Wünsche anderer EU-Regierungen, wichtiger. Für ihn bildeten Deutschland und Frankreich einen Schicksalsbund, bei dem Paris der Vortritt gebührte. Es heißt, dass sich Kohl zur Regel machte, die französische Trikolore dreimal zu grüßen.
Für Kohl war der Euro der entscheidende Baustein für die Europäische Union. Für Chirac dagegen war der Euro, genauso wie zuvor für Mitterrand, nicht ein Schritt zum vereinten Europa, sondern ein Instrument französischer Machtpolitik, um die Dominanz der D-Mark zu beseitigen.
Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, Dwight D. Eisenhower, soll gesagt haben, französische Unterhändler zögen es vor, erst zu unterschreiben und dann zu diskutieren. Ganz in diesem Stil hat sich die französische Diplomatie bei der Einführung des Euro verhalten.
Mit der Aufnahme der hochverschuldeten romanischen Club-Med-Länder hat man, unter eklatanter Missachtung der Eintrittskriterien, den EZB-Rat majorisiert. Denn dort hat jedes Mitglied eine Stimme, Zwergstaaten wie Luxemburg, Malta oder Zypern genauso wie Deutschland.
Die Besetzung der wichtigsten Posten der EZB
Als Nächstes besetzt man alle Schaltstellen mit den eigenen Leuten. Der erste EZB-Präsident, der Holländer Wim Duisenberg, bekam auf massiven Druck der Franzosen nur eine halbe Amtszeit von 1998–2003. Dann kam der Franzose Jean-Claude Trichet bis 2011. Als Axel Weber, der damalige Präsident der Deutschen Bundesbank, der als Nachfolger Trichets vorgesehen war, wegen der Mehrheitsverhältnisse im EZB-Rat auf das Amt verzichtete, galt der Italiener Mario Draghi als neuer Favorit für diesen Posten.
Auch Angela Merkel unterstützte Draghi von Anfang an. Denn seine Vita las sich für sie als Idealbesetzung für das Amt. Als ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler lehrte er von 1975–1991 als Professor an diversen Universitäten in Italien. Von 1991–2001 war er Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums und von 2002–2005 Vice Chairman und Managing Director bei der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs in London. Von 2006–2011 war er Gouverneur der Banca d’Italia, also der Präsident der italienischen Zentralbank.
Kurz: Er war erfahrener Investmentbanker und vor allem auch Zentralbanker mit dem Wissen aller Kniffe und Machenschaften bei der Banca d’Italia, die in Italien die Rolle des Staatsfinanzierers spielt.
Als Beispiel sei genannt: Es wurde bekannt, dass unter der Führung Draghis als Gouverneur der italienischen Zentralbank die Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) riskante Geschäfte tätigte und die italienische Zentralbank noch im Oktober 2011 der strauchelnden Bank einen wertpapierbesicherten Kredit in Höhe von zwei Milliarden Euro gab, aber weder Öffentlichkeit noch das italienische Parlament darüber informierte. Durch diese geheime Rettung der MPS landete zweifelhafter Wertpapierschrott bei der Banca d’Italia, und die MPS erhielt dafür im Gegenzug Staatsanleihen, deren Zins- und Schuldendienst vom Steuerzahler getragen wird. Draghi legte damit den Grundstein für ein europäisches Schattenbankensystem unter Führung der nationalen Notenbanken – ein System, das hauptsächlich dafür geschaffen wurde, Geschäftsbanken und deren Eigentümer auf Kosten der Steuerzahler vor Insolvenz bzw. Verstaatlichung zu schützen.
Er wusste also aus seiner früheren Praxis, wovon er redete, als er am 26. Juli 2012, als die Existenz des Euro auf dem Spiel stand, wortgewaltig ankündigte:
»Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats zu tun, was immer nötig ist, den Euro zu erhalten«, und er schob noch die Drohung nach: »Und glauben Sie mir, es wird genug sein.«8
Das war eine Bestandsgarantie für seine Landsleute und die übrigen Club-Med-Länder. Und wir wissen, was für einen früheren italienischen Notenbanker die Worte »im Rahmen unseres Mandats« und die Worte »Whatever it takes« bedeuten: Ihm ist jedes Mittel recht!
Daher überrascht es nicht, dass Draghi die gleiche Praxis jetzt in der Eurozone verfolgt, nur in weitaus größerem Stil: Am Tag, nachdem er verkündet hatte, die EZB werde ab März 2015 jeden Monat für bis zu 60 Milliarden Euro Staatsanleihen – darunter auch Schrottpapiere – kaufen, wurde bekannt, dass es im EZB-Rat keine Abstimmung über dieses beispiellose Ankaufprogramm gegeben hatte.
Um das Personal-Tableau der Eurozone zu vervollständigen: Der Stellvertreter Draghis im EZB-Rat ist der Portugiese Vitor Constâncio und die Präsidentin der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ist die Französin Danièle Nouy. Als die EZB im Frühjahr 2015 die ELA-Kredite (Emergency Liquidity Assistance – das sind Notfall-Liquiditätshilfen für Banken zur Überbrückung temporärer Engpässe) für griechische Banken fast täglich letztlich bis auf 90 Milliarden Euro erhöhte, hat Madame Nouy standhaft behauptet, die griechischen Banken seien nicht pleite, obwohl man mit bloßem Auge erkennen konnte, dass sie nicht illiquid, sondern insolvent waren.
Auf Druck Frankreichs wurde Pierre Moscovici, ein linker Sozialist und gescheiterter französischer Finanzminister, von der EU-Kommission zum Währungskommissar ernannt, der über die Einhaltung der Stabilitätskriterien wachen soll. Da hat man den Gärtner zum Bock gemacht. Mit ihm an der Spitze können die Defizitsünder in Südeuropa ruhig schlafen.
Fazit: Den EZB-Rat haben die Franzosen mit ihren Verbündeten in Südeuropa majorisiert, und auch alle Schlüsselstellen der EZB und der Kommission sind im Sinne Frankreichs besetzt. Mit dieser romanischen Übermacht haben sie alle Verträge und Gesetze systematisch hinter verschlossenen Türen nachverhandelt und schleichend ausgehöhlt.
Da der Euro ein französisches politisches Projekt ist, werden sie weitermachen in Richtung Transferunion. Dann haben sie die Deutschen im Sack. Die Franzosen sind auf gutem Weg. Der neue EU-Präsident Jean-Claude Juncker, vormals luxemburgischer Ministerpräsident, der die französische Agenda – Vergemeinschaftung der Schulden und der Spareinlagen bei Banken, Eurobonds und Transferunion – vollumfänglich teilt, passt genau in die Club-Med-Intrigenclique. In meinen Augen ist er das trojanische Pferd der Franzosen in der Eurozone.
Er hat in einem »Spiegel«-Interview 1999 in entlarvender Freimütigkeit gesagt:
»Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt – bis es kein Zurück mehr gibt.«9
Die Grundprinzipien der Währungsunion wurden verraten
Der Durchbruch der schleichenden Umwandlung der Währungsunion nach den Vorstellungen Frankreichs kam bei den dramatischen Verhandlungen am Wochenende vom 7.–9. Mai 2010, als Griechenland zahlungsunfähig war. Damals begruben die Staats- und Regierungschefs mit dem ersten Griechenland-Paket und dem ersten Rettungsschirm das No-Bailout-Prinzip, und gleichzeitig verstieß die EZB mit dem ersten Ankaufprogramm für Staatsanleihen von Krisenländern (also Ramschanleihen) gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung.
Zuvor hatten zwei Franzosen – der EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) Dominique Strauß-Kahn – nachdrücklich den Bailout gefordert und gleichzeitig Forderungen nach einer Beteiligung der privaten Gläubiger (einen »Haircut«) zurückgewiesen. Sie erwiesen sich als gute Lobbyisten der französischen Finanzbranche, denn in Wirklichkeit galt die Rettungsaktion den französischen Banken, die mit 70 Milliarden Euro die größte Gläubigergruppe waren, während deutsche Banken und Versicherungen nur 30 Milliarden Euro im Feuer hatten, die durchaus zu verschmerzen gewesen wären.
Auf Druck Frankreichs wurden somit mit einem Doppelschlag zwei Vertragsbrüche begangen und gleichzeitig die Steuerzahler der Eurozone zur Kasse gebeten.
Absolut schockierend dabei war, mit welcher Ungerührtheit der eklatante Gesetzes- und Vertragsbruch begangen wurde. Von deutscher Seite bezeichnete Angela Merkel die Zustimmung Deutschlands als »alternativlos«10.
Der Rettungsschirm war mit 750 Milliarden Euro ausgestattet. Er wurde am 21. Mai 2010 vom Bundestag verabschiedet und am 22. Mai 2010 von Bundespräsident Köhler im Eilverfahren unterzeichnet. Er hatte einst als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium den Vertrag von Maastricht – insbesondere unter Einschluss der No-Bailout-Klausel – entscheidend geprägt. Am 31. Mai 2010 trat Köhler von seinem Amt des Bundespräsidenten zurück.
Der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und der damalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi präsentierten dagegen die Vertragsbrüche als Erfolg ihrer Länder. Das Rettungsprogramm trage zu 95 Prozent die französische Handschrift, und Berlusconi sagte, er sei sehr zufrieden, Italien und Frankreich hätten sich durchgesetzt. Der französische Europaminister Pierre Lellouche erklärte, der Rettungsschirm laufe auf eine fundamentale Veränderung der in der EU geltenden Regeln hinaus. Er sei ein Sprung in Richtung einer Wirtschaftsregierung für die Eurozone.
Es war ja schon immer der Wunsch der Franzosen, zusätzlich zur Gemeinschaftswährung, mithilfe einer Wirtschaftsregierung auch Einfluss auf die Wirtschaftspolitik Deutschlands zu gewinnen. Der Wunsch ist verständlich, wenn man betrachtet, wie erfolgreich ihre dirigistische, zentralistische Wirtschaftspolitik ist. Gemessen an der Wettbewerbsfähigkeit steht kein großes Land Europas auf so wackeligen Beinen wie Frankreich: Der öffentliche Dienst ist aufgebläht, der Arbeitsmarkt verkrustet, der Kündigungsschutz rigide, die 35-Stunden-Woche und die Rente mit 60 unter globalen Bedingungen absurd. Der Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt schrumpft laufend. Es zeigt sich, dass alle südeuropäischen Staaten und Frankreich auf dem Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig sind. Sie haben, seitdem sie den Euro haben, nicht viel getan, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Vor dem Beitritt zur Währungsunion mussten die südeuropäischen Staaten für zehnjährige Staatsanleihen jährlich Zinsen in Höhe von 12–15 Prozent bezahlen, während Deutschland zur selben Zeit nur 5 Prozent zahlen musste. Nach dem Beitritt bekamen sie die gute Bonität der harten D-Mark quasi geschenkt und mussten nur noch fast so geringe Zinsen zahlen wie Deutschland. Ihre Zinslast hatte sich ohne große Anstrengung über Nacht gedrittelt, obwohl ihre strukturellen Defizite unverändert bestehen blieben. Das war ein unverdientes Geschenk des Himmels. Sie hatten aber nicht begriffen, dass man sich die Bestnote jeden Tag erarbeiten muss.
Die Ökonomen der DZ Bank haben ausgerechnet, wie stark sich die Zinslasten, dank der ungenierten Mandatsüberschreitung der EZB, für die hochverschuldeten südeuropäischen Krisenländer verringert haben. Über ein Jahrzehnt kommen sie auf weit mehr als eine Billion Euro Einsparung, während der deutsche Staat nur eine minimale Entlastung durch Zinsersparnis von etwa zehn Milliarden Euro hatte. Die ultraexpansive Zinspolitik der EZB nützt ausschließlich der staatlichen Schuldenfinanzierung Italiens, Spaniens und Frankreichs. Allein Italien sparte in den letzten sieben Jahren 500 Milliarden Euro an Aufwendungen.
Und es kommt noch besser: In den kommenden Jahren wird sich die Ersparnis für die Italiener bis zum Jahr 2022 auf 670 Milliarden Euro summieren, wenn alte Anleihen mit höheren Coupons auslaufen und durch niedrig verzinste Papiere ersetzt werden.
Auch der spanische Staat könnte 300 Milliarden Euro sparen. Beide Länder könnten so ihre Schuldenquote – ohne eigenes Zutun – zusammen um ca. eine Billion Euro reduzieren. Die Südländer sind also die großen Nutznießer des Euro und nicht Deutschland, wie uns Frau Merkel weismachen will.
Italien will geldpolitische Manipulationen statt Reformen
Nun fordern die Italiener ein zweites Geschenk: Die bisher gute Bonität Deutschlands soll ihnen durch gemeinschaftliche Euroanleihen weiterhin zu niedrigen Zinsen verhelfen. Frankreich und Italien sind sich einig: Südeuropa müsse von Deutschland mit Eurobonds, Konjunkturprogrammen und einer Schuldengarantie Deutschlands gerettet werden. Darüber hinaus solle die EZB die Staatsschulden garantieren und mit noch mehr Geld höhere Investitionsraten generieren, um so die Schuldenlast zu lindern. Da sträuben sich einem die Haare, nicht nur weil es ein unverschämtes Ansinnen ist, sondern auch, weil Italien sich zu den ungezwungenen Verhältnissen zurücksehnt, um weiterwursteln zu können wie zuvor – aber mit deutscher Schuldenübernahme!
Mit anderen Worten: Besonders Italien – ein reformunfähiger, in vielen Belangen nahezu gescheiterter Staat, zu dem die Bürger ein misstrauisches, fast feindseliges Verhältnis haben – fordert lautstark, dass es wie vor dem Eurobeitritt weitergehen solle. Die EZB soll nicht nur Retter der letzten Instanz sein, sondern soll von vornherein als Staatsfinanzierer fungieren, wie es bei der Banca d’Italia üblich war – eine Praxis, mit der der italienische EZB-Präsident Draghi dank seiner früheren Tätigkeit bestens vertraut ist. Dass die Zinsen italienischer zehnjähriger Staatsanleihen heute nahe bei null liegen, ähnlich wie die deutschen, obwohl das Land auch unter Ministerpräsident Matteo Renzi bisher keine nennenswerten Reformen durchgeführt hat, ist der Beweis für die cleveren, aber fragwürdigen geldpolitischen Manipulationen von Herrn Draghi. Der Verdacht liegt nahe, dass er unter dem Vorwand, die EZB müsse eine Deflation abwenden, mittels eines Anleiheankaufprogramms – auch von minderwertigen Staatsanleihen der Südländer – von monatlich 60 Milliarden Euro neues Geld druckt. Im März 2016 wurde das Volumen sogar auf 80 Milliarden Euro monatlich aufgestockt. Dies ist ein gefährliches Unterfangen, wovor auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann wiederholt gewarnt hat.
Eine große Gefahr besteht auch darin, dass Deutschland, infolge der finanziellen Überbelastung, seine Ratingbestnote verliert. Wir sollten die Warnung beherzigen, die dem ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln zugeschrieben wird, und uns entsprechend wappnen:
»Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, indem Ihr die Starken schwächt. Ihr könnt den Menschen nie auf Dauer helfen, wenn Ihr für sie tut, was sie für sich selber tun sollten und könnten.«11
Für die Südeuropäer und Frankreich heißt das, ihre Wirtschaft so fit zu machen, dass sie im Euroclub wie Gleiche unter Gleichen leistungs- und wettbewerbsfähig sind.
Und für Deutschland und die wenigen Gleichgesinnten darf die Haftungs- und Spendenbereitschaft nur als Hilfe zur Selbsthilfe für eine begrenzte Zeit gelten.
Der von Kanzlerin Merkel eingeführte Fiskalpakt sieht Haushaltskontrollen, eine Schuldenbremse und Sanktionen vor. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass er nicht wirklich praktiziert und eingehalten wird. Stattdessen wird Deutschland, obwohl der Hauptzahlmeister in der Eurozone, wegen der Austeritätspolitik angefeindet und gehasst. Es ist nicht zu erwarten, dass die von Deutschland geforderten Reformen stattfinden.
Griechenland ist und bleibt ein Fass ohne Boden. Ein gängiger Spruch in der EU lautet ja: »In Brüssel wirds erdacht, in Deutschland wirds gemacht, in Italien wird gelacht« (und dann ab in den Papierkorb).
Die Schwierigkeiten, die inzwischen zu einer Dauerkrise geführt haben, können nicht mit noch mehr Transferzahlungen und auch nicht durch institutionelle Mechanismen behoben werden. Sie wurzeln vielmehr in den kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, sozialen und mentalen Unterschieden der europäischen Völker.
Ein Philosoph und Politiker früherer Tage äußerte sich zu diesen unterschiedlichen Mentalitäten mit folgenden Worten:
»Wenn man Steuern erheben will, braucht man einen rechtschaffenen Bürger, der bereit ist, Steuern zu zahlen – man kann nicht alle Leute kontrollieren. Diese Rechtschaffenheit gibt es heute nicht mehr in Italien, nicht in Spanien und nicht in Frankreich – die Sitten sind dafür zu verderbt. Diese Rechtschaffenheit findet man heute nur noch bei den Deutschen.«12
Wer könnte ein so vernichtendes Urteil über die Bürger dieser drei romanischen Staaten gefällt haben? Es war der Italiener Niccolò Machiavelli, ein Staatsphilosoph und Politiker, der solches vor 500 Jahren aussprach. Es hat sich also seit damals nichts geändert im Verhalten verschiedener europäischer Völker im Verhältnis zu ihrem Staat.
Daran werden auch eine in Brüssel verfügte, zentrale Finanzpolitik und ein Fiskalpakt nichts ändern. Nur eine in nationaler Verantwortung stehende Wirtschafts- und Sozialpolitik kann mit der Nähe zu ihren Bürgern deren Sorgen und Nöten gerecht werden.
Hätte man nur auf Ludwig Erhard gehört …
Ludwig Erhard hat die Voraussetzungen für ein funktionierendes Zusammenleben in dem vielfältigen europäischen Kontinent in einer Rede mit dem Titel »Europäische Zwischenbilanz« in Wien am 8. Februar 1961 mit folgenden Worten umrissen:
»Der Segen einer freizügigen Wirtschaftspolitik und einer auf Freiheit aufgebauten gesellschaftlichen Ordnung beruht ja gerade darauf, dass jedes Volk sein arteigenes Leben führen kann und trotzdem an den Segnungen des weiten Raumes teilhat, soweit nur Freiheit und Zusammengehörigkeit die Völker verbindet.«13
Mit den Worten »dass jedes Volk sein arteigenes Leben führen kann« hat Ludwig Erhard schon vor über 50 Jahren die Form eines europäischen Zusammenschlusses angesprochen. Erhard hat nie von einer Gemeinschaftswährung gesprochen und auch nicht von einem Bundesstaat. Der Euro sollte in der romantischen Vorstellung von Kanzler Kohl als Klebstoff die europäischen Staaten enger zusammenbinden und letztlich zu einem Bundesstaat führen.
Nun erweist er sich stattdessen als Sprengstoff. Er entzweit die Geber- und Nehmerländer. Anstatt Harmonie und Freundschaft herrschen Hass und Zwietracht. Die Geberländer fühlen sich ausgenommen und die Nehmerländer – Griechenland, Italien, Spanien, Portugal – fühlen sich unter einem »Diktat« der Deutschen bevormundet und schlecht behandelt.
Die Väter des Euro sind fatalen Irrtümern aufgesessen: zum einen, dass man eine so schwerwiegende Entscheidung, wie die Einführung einer Gemeinschaftswährung, von oben herab einfach verfügen könne, und zum anderen, dass man Völker, die in Mentalität, Lebensart, Arbeitseinstellung und Steuerehrlichkeit grundverschieden sind, problemlos zusammen in ein Boot nehmen könne.
Die Mehrheit der Deutschen wollte die D-Mark behalten. Kanzler Kohl hätte die Warnung von Erhard beherzigen sollen:
»Europäische Integration ohne entsprechenden Widerhall in der Öffentlichkeit verwirklichen zu wollen, ist ein Unding.«14
Die Franzosen saßen ebenfalls einem Irrtum auf: In ihrer Vorstellung sollte die dominante D-Mark durch eine Gemeinschaftswährung, den Euro, ersetzt werden, um auf diese Weise die Wirtschaft Deutschlands und seinen politischen Einfluss einzugrenzen. Doch während die Wirtschaftskraft Deutschlands seit Jahrzehnten stetig wuchs, hat sie in Frankreich schleichend abgenommen. Inzwischen ist aus Frankreich ein überbürokratisiertes, reformunfähiges, wirtschaftlich schwaches Land mit einem aufgeblähten Wohlfahrtsstaat geworden. Politischer Einfluss basiert aber auf wirtschaftlicher Potenz und militärischer Macht. Die französische Hegemonie stützt sich dagegen nur noch auf eine nukleare Waffe, die »Force de Frappe«, die das Land nicht benutzen kann, und eine Armee, die es innerhalb Europas nicht braucht.
Hinzu kommt, dass sich die Mitte der EU durch die hinzugekommenen ehemaligen sowjetischen Vasallenstaaten nach Osten verschoben hat.
Dass Deutschland als führende Exportnation langfristig mehr vom Euro profitieren würde als Frankreich und dass das Land überdies jetzt auch noch zur Rettung der Südeuropäer zur Kasse gebeten wird, damit hatte es nicht gerechnet.
In einer Kolumne in der »Financial Times« vom 4. November 2010 schrieb Samuel Brittan:
»Ich kann nicht im Namen Frankreichs sprechen. Aber sicher werden eines Tages seine Regierenden feststellen, dass keiner ihrer erfindungsreichen Währungspläne, die sie in den letzten Jahrzehnten entworfen haben, ihnen die Oberhand über Deutschland geben wird, die sie sich so ersehnt haben.«15
Mit dem »Front National« von Marine Le Pen, der sich eines wachsenden Wählerzulaufs erfreut und der einen Austritt aus dem Euro anstrebt, hören sich die prophetischen Worte Brittans zunehmend realistisch an.
Die französische Europapolitik steckt in einem unlösbaren Dilemma: Einerseits will Frankreich als Staat souverän bleiben, aber andererseits kollidiert dies mit den zentralisierenden Tendenzen in Brüssel. Frankreich will möglichst wenig Macht an Brüssel abgeben, aber gleichzeitig mit der Gemeinschaftswährung Euro, beispielsweise einer Bankenunion, einer Einlagensicherung, einer Arbeitslosenversicherung etc. möglichst viele europäische nationalstaatliche Einrichtungen vergemeinschaften.
Dieser Konflikt besteht seit der Zeit, als die britische »eiserne Lady« Margaret Thatcher in ihrer berühmten Rede 1988 in Brügge unverblümt davon sprach, die Souveränität der europäischen Staaten sei so weit wie möglich zu erhalten. Ihre institutionellen und wirtschaftlichen Verschiedenheiten müssten kein Nachteil sein.
Ganz im Gegenteil, die einzelnen Länder könnten im freien Markt miteinander konkurrieren, um auf diese Weise das Bestmögliche für die Wirtschaft und die Konsumenten herauszuholen.
Bildlich dargestellt, schwebt Frankreich ein großes europäisches Haus vor, in dem es die Hausordnung festlegt und die Verwaltung besorgt. Großbritannien dagegen möchte, dass jeder in seinem Haus wohnen bleibt, dass aber die Zäune niedergerissen werden und dass somit dem Handel und Wandel nichts im Wege steht. Es soll also so weit wie möglich ein freier Wettbewerb nach innen und außen zum Nutzen aller Beteiligten stattfinden.
Großbritannien ist für die EU unverzichtbar
Die Briten hatten immer eine etwas erweiterte Freihandelszone im Sinn. Dass Brüssel zunehmend mehr Macht an sich zog und sich zu einem bürokratischen Monster entwickelte – mit einem immer dichteren, unüberschaubaren Geflecht von Verträgen und Regulierungen –, war den Briten schon zu Zeiten Maggie Thatchers ein Dorn im Auge. Inzwischen haben sich immer mehr Wähler einer Partei namens UKIP zugewandt, die den Austritt Großbritanniens aus der EU, kurz den »Brexit«, betreibt. Premierminister David Cameron hat daher beschlossen, die Briten über Austritt oder Verbleib in einem Referendum am 23. Juni 2016 abstimmen zu lassen.
Regierungschef Cameron möchte den »Brexit« verhindern und mit einigen Reformen seine Landsleute zum Verbleib überzeugen.
Dabei geht es um vier zentrale Punkte:
EU-Mitglieder, die wie Großbritannien nicht der Währungsunion angehören, sollen vor Diskriminierung geschützt werden. Davon würde vor allem das für das Land wichtige Londoner Bankenviertel profitieren.Die Formel von der »immer engeren Union der Völker Europas«16 in den EU-Verträgen soll nicht zwingend zu mehr politischer Integration führen.Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas soll verbessert werden.Die Briten wollen Einwanderern aus anderen EU-Staaten einen Teil der Sozialleistungen vier Jahre lang vorenthalten. An einer solchen Regelung hat sogar Deutschland ein Interesse.Das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu verbessern, war schon in der ambitionierten Lissabon-Agenda 2010 enthalten und wurde meilenweit verfehlt.
Letztlich soll ein Ergebnis erzielt werden, das einerseits die britischen Wähler davon überzeugt, beim Referendum gegen den »Brexit« zu stimmen, das aber andererseits am Status quo in der EU möglichst wenig ändert.
Ein Austritt der Briten würde die EU in ihren Grundfesten erschüttern. Der Schaden wäre für Deutschland am größten, denn London steht ähnlich wie unser Land für Marktwirtschaft und Freihandel.
Gerade für Deutschland sind enge Beziehungen zu Großbritannien unverzichtbar, weil das Land ein wichtiges Gegengewicht zum herrschsüchtigen, zentralistischen Frankreich darstellt. Als zweitgrößter Nettozahler der EU würde Britanniens Abgang ein riesiges Loch in den EU-Haushalt reißen. Es bedarf keiner großen Fantasie, dass Deutschland dann eine noch größere Last zu tragen hätte.
Anstatt der von Kanzler Kohl und seinen politischen Gesinnungsgenossen vertretenen Meinung, dass Deutschland und Frankreich einen Schicksalsbund bildeten, ist realpolitisch für unser Land eine Äquidistanz zu Großbritannien und Frankreich aus heutiger Sicht essenziell. Wir sollten unsere politischen Beziehungen genauso unromantisch und eigennützig gestalten, wie es der ehemalige französische Präsident Charles de Gaulle ausdrückte:
»Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.«17
Deutschland hat also ein besonders großes Interesse, dass der »Brexit« abgewendet wird. Dies auch im Hinblick auf die große diplomatische Expertise Londons. Darüber hinaus ist Großbritannien wie Frankreich Atommacht und ausgestattet mit dem Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Deutschland teilt mit Großbritannien viele Interessen: Das Land steht beispielhaft für demokratische Traditionen des Westens und tritt für marktwirtschaftliche Lösungen anstelle eines Übermaßes an staatlichem Interventionismus ein.
In vielen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen liegt London auf einer Linie mit Deutschland, sei es die Haushalts- oder Sozialpolitik. Das Land hat sogar viel beherzter und mutiger den ausgewucherten Sozialstaat getrimmt als Deutschland.
Vieles, was Cameron an der EU kritisiert und für reformbedürftig hält – eine Dezentralisierung zugunsten der nationalen Parlamente und eine Deregulierung des bürokratischen Monsters in Brüssel –, liegt auch im Interesse Deutschlands. Das Vereinigte Königreich ist ein Teil Europas, wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Das einzigartige europäische Projekt, ein Projekt im Werden, braucht seine Mitwirkung mit seiner politischen Kompetenz im Management eines einstmals riesigen Commonwealth.
Großbritannien könnte an diese Tradition anknüpfen und, anstatt ein passives Mitglied zu bleiben, eine führende Rolle in der EU übernehmen.
Es gibt vor allem einen Bereich, in dem die EU die Führung Großbritanniens braucht und in dem sie, wie niemand sonst, eindeutig am besten qualifiziert ist, und das ist die Außenpolitik.
Die EU braucht die Professionalität der britischen Diplomaten und die globale Sicht ihrer Eliten. Seitdem die Briten ein Imperium verloren haben, waren sie auf der Suche nach einer neuen Rolle in der Welt. Jenseits des Kanals ist ein Imperium im Entstehen. Sie sollten aufhören, das europäische Festland »the continent« zu nennen, sondern sich als Teil dieses »continent« zu betrachten, es mitzugestalten und zu prägen.
Mit den Konzessionen, die David Cameron bei der EU erreicht hat, sind die Chancen gestiegen, dass er das Referendum gewinnt und die Briten in der EU bleiben. Wenn es so kommt, wäre es ein großer Sieg für ihn und ein noch größerer für die EU, denn die steht in diesen Krisenzeiten näher am Abbruch als am Aufbruch.
Von der oft bemühten Forderung an die Geberländer nach Solidarität, wenn es ums Geld geht – vor allem um deutsches –, ist angesichts der dramatischen Flüchtlingsinvasion nichts übrig geblieben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Alle haben sich vom Acker gemacht. Deutschland steht allein auf weiter Flur.
Die viel beschworene europäische Wertegemeinschaft gibt es nicht. Es ist inzwischen sogar fraglich, ob Europa eine Interessengemeinschaft ist. Es handelt sich wohl eher um eine Profitgemeinschaft.
Die Motive für den Beitritt zur EU und zum Euro sind in Ost und West, Nord und Süd so verschieden, dass das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein, an Bindekraft, ja, an Glaubwürdigkeit verliert.
Die Flüchtlingskrise stellt den ganzen Zusammenhalt auf die härteste Probe. Kein europäischer Staat ist bereit, Aufnahmequoten von Flüchtlingen zu unterschreiben, solange Merkel eine Obergrenze ablehnt und eine kontrollierte und begrenzte Einwanderung nicht sichergestellt ist. Mit ihrem Sonderweg hat Merkel, die vom »Time Magazine« zur Politikerin des Jahres 2015 gekürt und von der Zeitschrift »The Economist« zur »unentbehrlichen Europäerin«18 erklärt wurde, inzwischen ihre Autorität im In- und Ausland untergraben.
Die Flüchtlingskrise zeigt das wahre Gesicht der EU
Der Soziologe Max Weber unterschied im menschlichen und politischen Verhalten zwischen »Gesinnungsethik« und »Verantwortungsethik«19. Es stellt sich die Frage, ob Angela Merkel mit ihrer gegenüber dem massenhaften Flüchtlingszustrom nach Deutschland, den sie mit ausgelöst hat, zu viel Gesinnungsethik und zu wenig Verantwortungsethik hat walten lassen und damit die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unseres Landes und unserer Bürger nicht überfordert hat. Wenn dem so ist, dann hätte sie als Bundeskanzlerin gegen ihren Amtseid verstoßen, in dem es u. a. heißt: »Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen [...] [und] Schaden von ihm abwenden [...] werde.«20.
Der Blick in den Abgrund hat vielleicht vielen vor Augen geführt, dass man das Projekt Europa mit seiner wahrlich historisch zu nennenden Erfolgsgeschichte – Frieden, grenzenlose Freiheit, Wohlstand – nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte, aber dass man es auch nicht als selbstverständlich und kostenlos ansehen sollte.